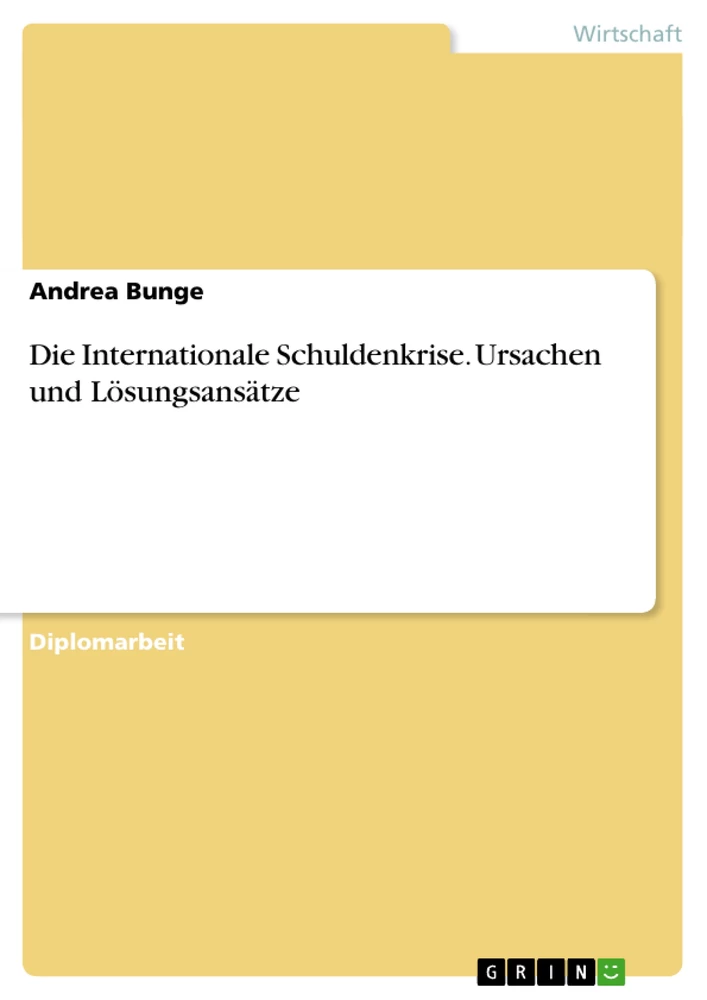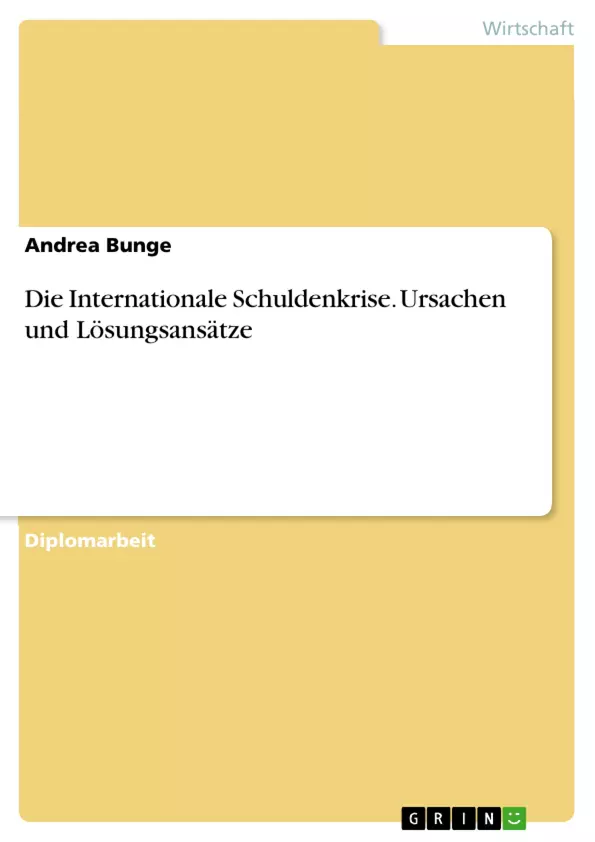Die internationale Schuldenkrise hat Ökonomen auf der ganzen Welt beschäftigt und zu Publikationen angeregt, die das Thema in mehr oder weniger komplexen Darstellungen beleuchten. Dabei erregt die politische Brisanz viele Gemüter und führt zu nicht immer objektiven, teilweise sogar zu ideologischen oder verklärenden Auseinandersetzungen mit dem Problem.
Ziel des vorliegenden Buches ist es, einen chronologischen aber auch kritischen Überblick der Schuldenkrise seit Beginn der siebziger Jahre zu geben. Diese ex-post Analyse bietet die Möglichkeit, aufgestellte Theorien mit den realen Entwicklungen zu vergleichen. Dabei werden die jeweils vorherrschenden Auffassungen sowie die Handlungsweisen der Beteiligten in den entsprechenden Situationen betrachtet und die im Laufe der Zeit schrittweise gewonnenen Erkenntnisse dargestellt. Seinen Schwerpunkt findet das Buch in der kritischen Auseinandersetzung mit den Lösungsansätzen seit dem Ausbruch der Schuldenkrise im Jahr 1982.
Zu Beginn des Buches wird anhand des Schuldenzyklusmodells die Notwendigkeit von Kreditaufnahmen im Ausland für die wirtschaftliche Entwicklung geschildert. Im Anschluss wird aufgezeigt, warum diese ökonomisch sinnvolle Verschuldung in der Praxis für viele Länder Schwierigkeiten mit sich brachte und in einer problematischen Verschuldung mündete.
In den weiteren Kapiteln wird der Umfang der Auslandsverschuldung anhand verschiedener Indikatoren wiedergegeben. Es werden die Ursachen - untergliedert nach verschiedenen Einflussfaktoren und Akteuren - analysiert, und damit zugleich der Grundstein für die Betrachtung der Lösungsansätze gelegt.
Wer hat sich in welcher Art, mit welchem Umfang und mit welchem Interesse für Maßnahmen zur Überwindung der Schuldenkrise engagiert? Die Strategien werden systematisch dargestellt und jeweils kritisch kommentiert. Im abschließenden Kapitel 5 werden neue Krisen in Lateinamerika kurz dargestellt und die Hintergründe beleuchtet, um damit die Frage nach der Wirkung der bisher untersuchten Lösungsansätze zu beantworten.
Nach einer kurzen Zusammenfassung erfolgt der Ausblick, der gleichermaßen als Plädoyer für die Einführung einer Staateninsolvenz als mögliches Verfahren im Umgang mit der Verschuldung der Entwicklungsländer verstanden werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Verschuldung und Entwicklung
- 1.1 Auslandsverschuldung und Wirtschaftswachstum
- 1.2 Schuldenzyklus Modell
- 1.3 Motive für Kreditaufnahme im Ausland.
- 1.4 Probleme in der Rücktransferphase
- 1.4.1 Das Transferproblem
- 1.4.2 Das Aufbringungsproblem
- 1.4.3 Das Akzeptanzproblem
- 1.5 Liquiditäts- vs. Solvenzproblem
- 2 Ausmaß und Struktur der Verschuldung
- 2.1 Indikatoren der Gesamtverschuldung
- 2.1.1 Bestandsgrößen
- 2.1.2 Stromgrößen
- 2.1.3 Nettotransfer und Devisenreserven
- 2.2 Schuldnerstruktur
- 2.2.1 Klassifizierung nach Einkommen
- 2.2.2 Klassifizierung nach Region
- 2.3 Gläubigerstruktur
- 2.1 Indikatoren der Gesamtverschuldung
- 3 Ursachen der Schuldenkrise
- 3.1 Exogene Faktoren
- 3.1.1 Ölpreiskrisen
- 3.1.2 Weltweite Rezession
- 3.1.3 Protektionismus in der Weltwirtschaft
- 3.1.4 Entwicklung des internationalen Zinsniveaus
- 3.2 Endogene Faktoren
- 3.2.1 Verwendung von Auslandskrediten
- 3.2.2 Importsubstitution
- 3.2.3 Preisverzerrungen
- 3.2.4 Schlechtes Schuldenmanagement
- 3.3 Die Rolle der Banken
- 3.3.1 Hohes Kapitalangebot
- 3.3.2 Gewinne mit dem Auslandsgeschäft .
- 3.3.3 Länderrisikoanalysen
- 3.3.4 Gruppenrisiken.
- 3.3.5 Kreditsyndizierung
- 3.3.6 Moral Hazard Problem.
- 3.1 Exogene Faktoren
- 4 Lösungsansätze
- 4.1 Unmittelbare Reaktion nach 1982
- 4.1.1 Vermeidung einer Wirtschaftskrise
- 4.1.2 Umschuldungen
- 4.1.2.1 Umschuldungen öffentlicher Kredite
- 4.1.2.2 Umschuldungen privater Kredite
- 4.1.2.3 Längerfristige Umschuldungen .
- 4.1.3 Die Rolle des IWF und eine kritische Betrachtung der Sta-\nbilitätsprogramme
- 4.1.4 Kritik.
- 4.2 Der Baker Plan
- 4.2.1 Notwendigkeit eines neuen Weges
- 4.2.2 Rahmenbedingungen des Bakerplans
- 4.2.3 Das Scheitern des Bakerplans
- 4.2.4 Konsequenzen
- 4.2.5 Alternative Vorschläge.
- 4.3 Marktorientierte Lösungen
- 4.3.1 Sekundärmarktinstrumente
- 4.3.1.1 Debt for Equity Swaps.
- 4.3.1.2 Debt for Bond Swaps
- 4.3.1.3 Weiterer Schuldentausch
- 4.3.1.4 Schuldenrückkauf .
- 4.3.2 Gründe für die geringe Schuldenreduktion .
- 4.3.2.1 Steuer- und bankenrechtliche Gesetzgebung
- 4.3.2.2 Vertragsklauseln in den Kreditverträgen
- 4.4 Der Brady Plan
- 4.4.1 Inhalt
- 4.4.2 Kritik.
- 4.4.2.1 Zahlungsmoral der Schuldner
- 4.4.2.2 Volumen und Umfang des Brady Plans
- 4.4.2.3 Risikotransfer der Geschäftsbanken.
- 4.4.2.4 Risikotransfer der USA
- 4.4.3 Praktische Umsetzung.
- 4.4.3.1 Das Mexiko Paket
- 4.4.3.2 Weitere Brady Pakete
- 4.4.4 Die Situation nach Brady
- 4.4.4.1 Rückkehr an den Kapitalmarkt
- 4.4.4.2 Wirtschaftspolitische Veränderungen in den Schuld-\nnerländern
- 4.4.4.3 Fazit
- 4.5 HIPC Schuldeninitiative
- 5 Neue Krisen in Lateinamerika
- 5.1 Mexiko 1994.
- 5.2 Brasilien 1998
- 5.3 Argentinien 2001.
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der internationalen Schuldenkrise und analysiert die Ursachen und Lösungsansätze für dieses globale Problem. Sie zeichnet die Entwicklung der Verschuldung in Entwicklungsländern nach und untersucht die Faktoren, die zur Eskalation der Krise geführt haben.
- Verschuldung und Wirtschaftswachstum
- Ursachen der Schuldenkrise: exogene und endogene Faktoren
- Rolle der Banken und des internationalen Finanzsystems
- Lösungsansätze und deren Wirksamkeit
- Neue Krisen in Lateinamerika
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen Verschuldung und Wirtschaftswachstum und stellt das Schuldenzyklusmodell vor. Es werden die Motive für Kreditaufnahmen im Ausland sowie die Probleme in der Rücktransferphase analysiert.
Im zweiten Kapitel werden die Ausmaße und die Struktur der Verschuldung in Entwicklungsländern anhand verschiedener Indikatoren dargestellt. Die Schuldner- und Gläubigerstruktur wird ebenfalls betrachtet.
Das dritte Kapitel widmet sich den Ursachen der Schuldenkrise. Es werden sowohl exogene Faktoren wie Ölpreiskrisen und weltweite Rezessionen als auch endogene Faktoren wie Importsubstitution und Preisverzerrungen untersucht. Die Rolle der Banken bei der Entstehung der Krise wird ebenfalls beleuchtet.
Kapitel vier analysiert verschiedene Lösungsansätze, die in Reaktion auf die Schuldenkrise entwickelt wurden. Von unmittelbaren Reaktionen nach 1982 über den Baker Plan und den Brady Plan bis hin zur HIPC-Initiative werden verschiedene Programme und deren Auswirkungen untersucht.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit neuen Krisen in Lateinamerika, wie den Finanzkrisen in Mexiko (1994), Brasilien (1998) und Argentinien (2001).
Schlüsselwörter
Internationale Schuldenkrise, Entwicklungsländer, Verschuldung, Wirtschaftswachstum, Ölpreiskrisen, Weltweite Rezession, Protektionismus, Importsubstitution, Preisverzerrungen, Schuldenmanagement, Banken, IWF, Stabilitätsprogramme, Baker Plan, Brady Plan, HIPC Initiative, Debt for Equity Swaps, Debt for Bond Swaps, Mexiko, Brasilien, Argentinien.
Häufig gestellte Fragen zur internationalen Schuldenkrise
Was sind die Hauptursachen für die internationale Schuldenkrise?
Man unterscheidet zwischen exogenen Faktoren (wie Ölpreiskrisen und Rezession) und endogenen Faktoren (wie schlechtes Schuldenmanagement und Importsubstitution).
Was ist der Unterschied zwischen einem Liquiditäts- und einem Solvenzproblem?
Ein Liquiditätsproblem ist ein kurzfristiger Engpass an Barmitteln, während ein Solvenzproblem bedeutet, dass ein Land langfristig nicht in der Lage ist, seine Schulden zu begleichen.
Was versteht man unter dem Baker-Plan und dem Brady-Plan?
Dies waren US-amerikanische Initiativen zur Lösung der Schuldenkrise in den 1980er Jahren, die auf Umschuldungen und marktorientierten Lösungen basierten.
Welche Rolle spielten die Banken in der Krise?
Banken trugen durch ein hohes Kapitalangebot, mangelhafte Risikoanalysen und das „Moral Hazard“-Problem zur massiven Verschuldung von Entwicklungsländern bei.
Was ist die HIPC-Initiative?
Die HIPC-Initiative (Heavily Indebted Poor Countries) ist ein Programm des IWF und der Weltbank zur Entlastung der am stärksten verschuldeten armen Länder.
- 4.3.1 Sekundärmarktinstrumente
- 4.1 Unmittelbare Reaktion nach 1982
- Arbeit zitieren
- Andrea Bunge (Autor:in), 2002, Die Internationale Schuldenkrise. Ursachen und Lösungsansätze, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8095