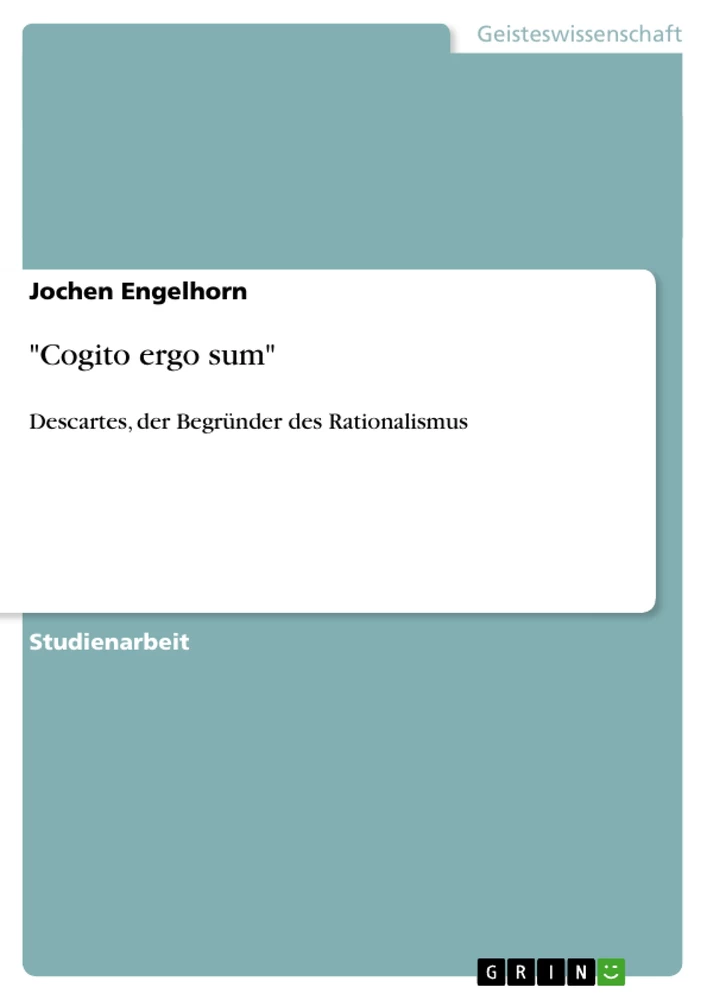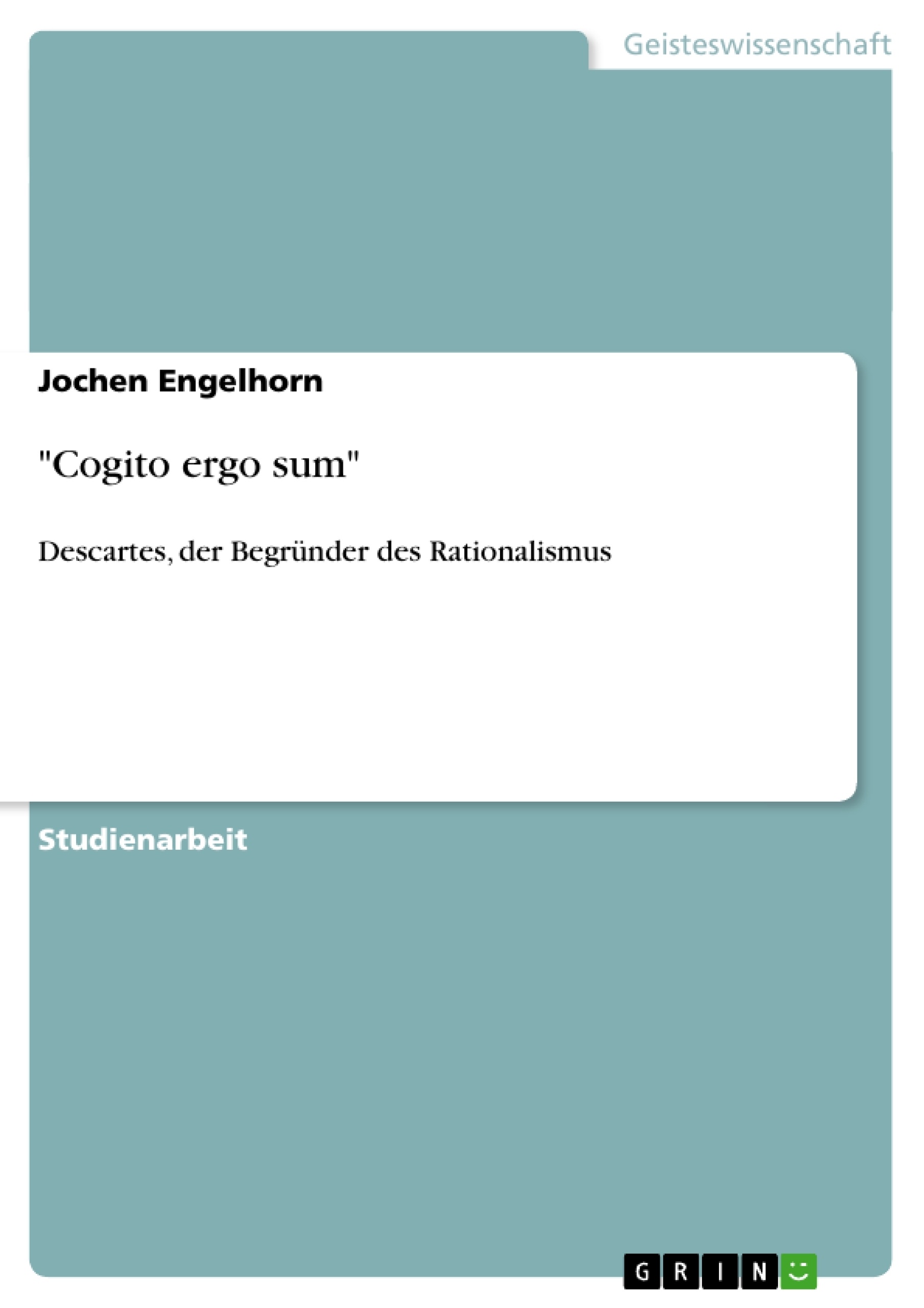„Cogito ergo sum“ – ich denke, also bin ich. Diese berühmt gewordene Erkenntnis des französischen Philosophen, Mathematikers und Naturwissenschaftlers René Descartes (1596-1650) ist heutzutage das wahrscheinlich bekannteste Zitat eines Philosophen überhaupt. Selbst René Goscinny, der Texter der Asterix-Bände, legt einem römischen Legionär die Worte Descartes’ in den Mund. Doch was steckt hinter dieser Phrase, die oft nur wiederholt wird ohne seinen Ursprung und seine wahre Bedeutung zu kennen? Die Größe und die beachtliche Wirkung des Zitats geht nicht selten unter, ohne überhaupt zu wissen, von wem es eigentlich stammt. Tausendfach wiederholt verkommt es zu einer Floskel, die meist völlig zusammenhangslos im Raum steht. Warum hat gerade dieser Ausspruch des Begründers der analytischen Geometrie einen derart großen Bekanntheitsgrad erlangt? Wie lässt sich diese besondere Bedeutung und Wirkung für die Nachwelt erklären? Was steckt hinter der weltberühmten Formel Descartes’?
Im Folgenden möchte ich daher näher auf des Gesamtwerk des „Begründers des Rationalismus“ eingehen, Hintergründe erläutern und den Gedankengang des Philosophen nachvollziehen, der maßgeblich das Menschenbild der Neuzeit geprägt hat. Dazu soll es in dieser Arbeit nicht nur bei einer Darstellung des Argumentationsgangs des „Cogito-Arguments“ bleiben, sondern auch auf die Bedeutung und die Wirkung des neuartigen Denkens eingegangen werden.
Unzählige Literatur lässt sich über dieses recht weit gefasste Thema finden. Aufsätze, etliche Einführungen und Übersetzungen der Schriften lassen die Tragweite des philosophischen Klassikers erkennen. Ich habe mich daher auf wenige Monographien beschränkt, um von der Informationsvielfalt nicht erschlagen zu werden. Das Standardwerk über Descartes ist sicherlich die grundlegende Studie „René Descartes“ von Dominik Perler , der sehr ausführlich und detailliert auf das Gesamtwerk des Philosophen eingeht. Sehr zu empfehlen ist außerdem die Monographie von Eva-Maria Engelen , die zwar weniger komplex, aber dafür sehr anschaulich und verständlich die Grundzüge des Rationalisten darstellt. Für einzelne Kapitel war darüber hinaus das Werk „Die Situation der Menschenwürde in der westlichen Kultur“ von Johannes Spinner und das umfassende Überblickswerk „Geschichte der Philosophie“ von Karl Vorländer sehr hilfreich.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Abkehr vom mittelalterlichen Denken
- a) Ablehnung der scholastischen Tradition
- b) Der „methodische Zweifel“
- III. Vom Zweifel zur Gewissheit: das „Cogito-Argument“
- a) Die Destruktion der Wirklichkeit
- b) Die Konstruktion der Wirklichkeit
- IV. Die Bedeutung und Wirkung des cartesischen Menschenbildes
- V. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit widmet sich dem Werk des französischen Philosophen René Descartes und untersucht insbesondere sein berühmtes "Cogito ergo sum"-Argument. Sie verfolgt das Ziel, Descartes' philosophischen Ansatz und seine Abkehr vom mittelalterlichen Denken nachzuvollziehen und die Bedeutung seiner Erkenntnisse für die Entwicklung des modernen Menschenbildes zu beleuchten.
- Descartes' Kritik an der scholastischen Tradition und die Betonung der Vernunft als Grundlage der Erkenntnis
- Das "Cogito-Argument" als Ausgangspunkt für eine sichere und unbezweifelbare Erkenntnis
- Der Einfluss von Descartes' Denken auf die Entwicklung des Rationalismus und des modernen Menschenbildes
- Die Bedeutung des "methodischen Zweifels" als Werkzeug zur Erlangung von Wissen
- Die Auswirkungen von Descartes' Philosophie auf die Wissenschaften und die gesellschaftliche Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt das berühmte Zitat "Cogito ergo sum" von René Descartes vor und erläutert dessen Bedeutung und Relevanz. Sie führt in das Thema der Arbeit ein und skizziert die Ziele und den methodischen Ansatz.
II. Abkehr vom mittelalterlichen Denken
a) Ablehnung der scholastischen Tradition
Dieser Abschnitt behandelt Descartes' Kritik an der mittelalterlichen Scholastik, die auf Autoritäten und Traditionen beruhte. Er argumentiert, dass allein der eigene Verstand die Grundlage für sichere Erkenntnis bildet.
b) Der "methodische Zweifel"
Hier wird Descartes' Methode des "methodischen Zweifels" vorgestellt, die darauf beruht, alle Zweifelhaften zu verwerfen, um schließlich zu einem unbezweifelbaren Ausgangspunkt zu gelangen.
III. Vom Zweifel zur Gewissheit: das "Cogito-Argument"
a) Die Destruktion der Wirklichkeit
Dieser Abschnitt beschreibt, wie Descartes durch den Zweifel alle bestehenden Annahmen über die Wirklichkeit in Frage stellt.
b) Die Konstruktion der Wirklichkeit
Hier wird erläutert, wie Descartes aus dem "Cogito-Argument" heraus eine neue, auf Vernunft basierende Sichtweise der Wirklichkeit konstruiert.
IV. Die Bedeutung und Wirkung des cartesischen Menschenbildes
Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung und die Auswirkungen von Descartes' Denken für das moderne Menschenbild und die Entwicklung der Wissenschaften.
Schlüsselwörter
Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind: René Descartes, "Cogito ergo sum", Rationalismus, Scholastik, methodischer Zweifel, Erkenntnis, Wahrheit, Menschenbild, Moderne.
- Arbeit zitieren
- Jochen Engelhorn (Autor:in), 2006, "Cogito ergo sum", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80849