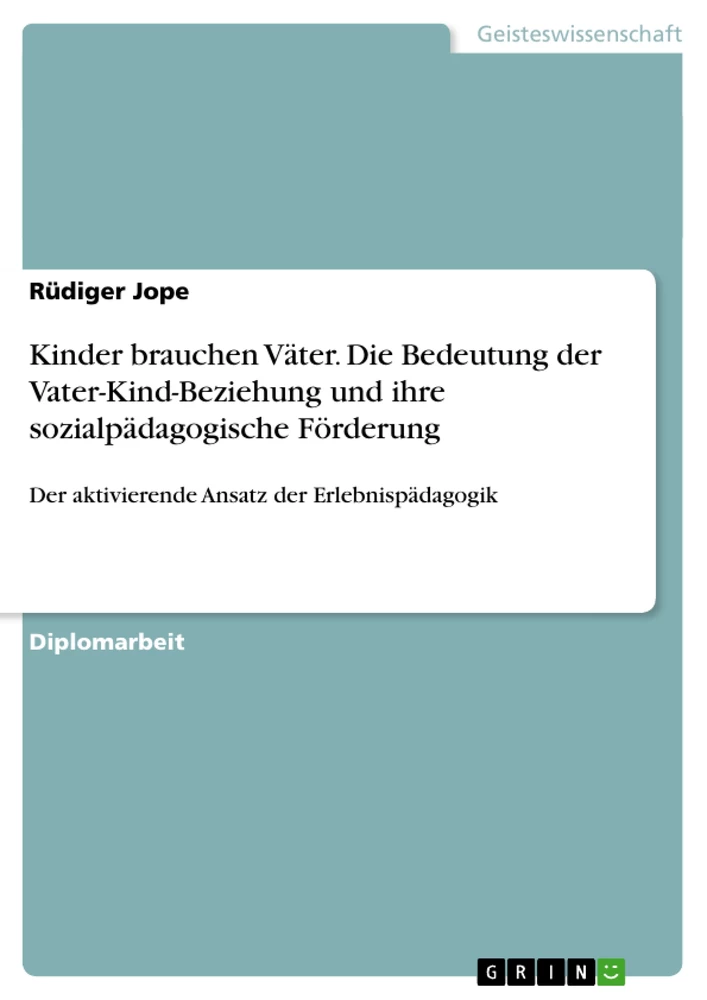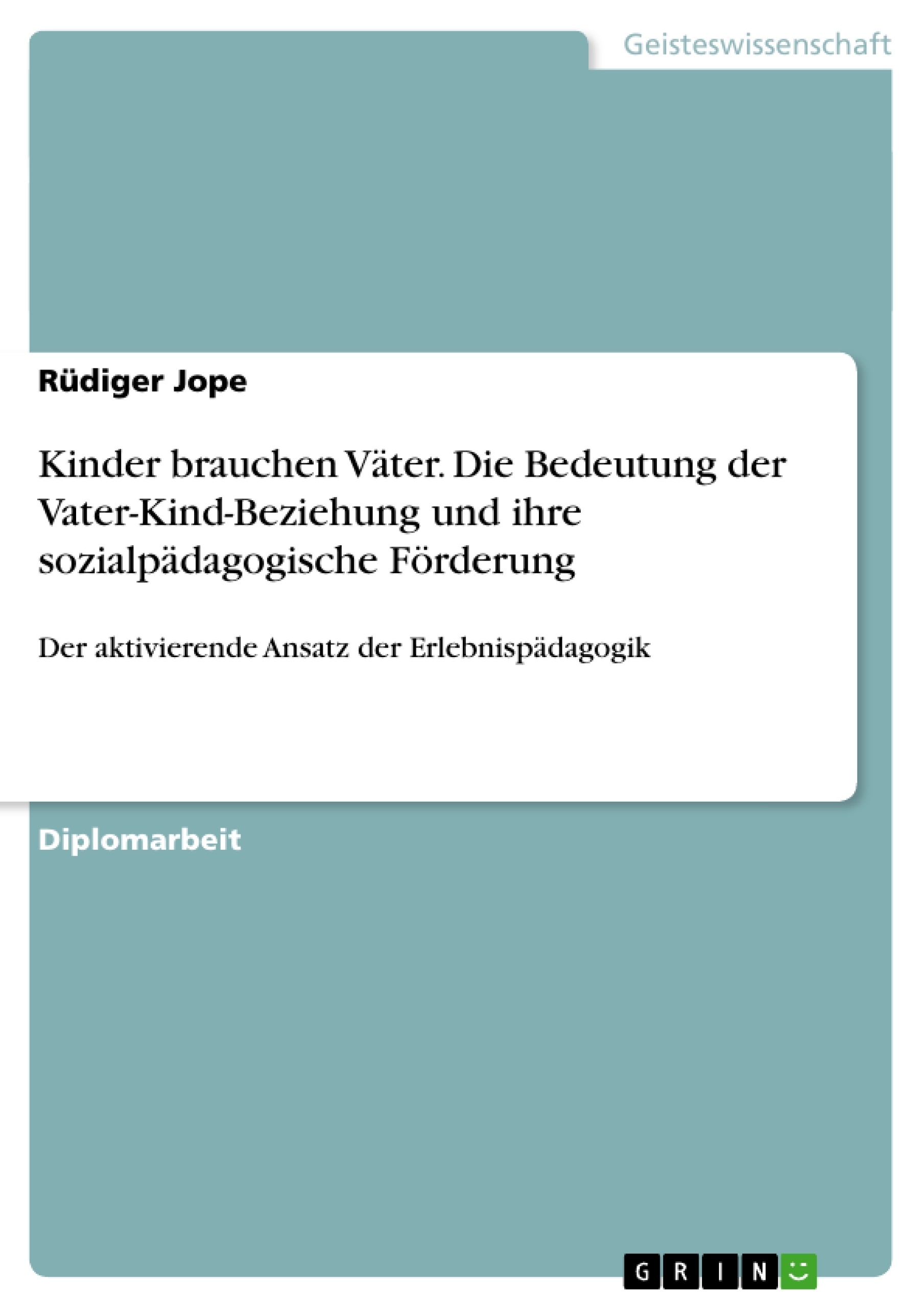Der Spielzeughersteller Mattel wollte eine Puppenfamilie vermarkten. Zu Testzwecken gab man die Mutter-, die Vater-, und zwei Kinderpuppen an Kinder weiter. Bei der Spielbeobachtung stellte man fest, dass die Kinder den „Vater“ beiseite legten. Auf die Frage: „Und was ist mit der Vaterpuppe?“ entgegneten die Kinder: „Der ist in der Arbeit.“ Die Vaterpuppe wurde links liegen gelassen. Der Vater spielte keine Rolle.
„Kindermund tut Wahrheit kund“, so der Volksmund. Über Jahrzehnte spielten die Männer keine entscheidende Rolle in der Familie. Sie fügten sich der traditionellen Norm. Morgens schluckte sie die Fabrik, um sie abends wieder müde auszuspucken. Wenn sie für ihre Kinder auftauchten, dann als Ernährer und Disziplinierer. Emotionale oder gar Bindungsfähigkeiten wurden den Vätern abgesprochen. Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung, d. h. der vermehrten Berufstätigkeit der Frau, dem Durchbruch der Emanzipation, der nicht mehr gegebenen lebenslänglichen männlichen Arbeitsplatzsicherheit etc., rutschte der Mann immer mehr ins Abseits. Forsche Zeitgenossen schrieben ihn daher als durch Frauen ersetzbar ab.
Dass dem nicht so ist, möchte ich gerne mit meiner Diplomarbeit, die auf neueren Untersuchungen der Vaterforschung fußt, nachweisen. Kinder brauchen Väter (und Mütter) für ein gesundes Wachstum. Männliche und weibliche Identität baut auf das Vorhandensein von Vaterfiguren auf. „Nur wenn die Tochter durch die Identifikation mit dem Vater und durch seine Bestätigung ein weibliches Selbstbild und ein positives Männerbild verinnerlichen kann und wenn der Sohn zu seiner eigenen männlichen Identität findet, werden beide beim Eintritt in die Gesellschaft und in die Welt der Sexualität über ein stabiles Selbstwertgefühl als Frau oder als Mann verfügen.“
[...]
Im ersten und zweiten Teil beleuchte ich daher die Vergangenheit und den Ist-Zustand der Vater-Kind-Beziehung. Danach wende ich mich im dritten Teil den neuesten Untersuchungsergebnissen der Vaterkindforschung und ihrer Bedeutung für die Vater-Kind-Beziehung zu. Ausgehend von diesen Ergebnissen ziehe ich einige Schlussfolgerungen, wie die konkrete Förderung der Vater-Kind-Beziehung in der Zukunft aussehen kann.
Im Anschluss daran stelle ich die sozialpädagogische Methode der Erlebnispädagogik vor, die ich für einen ausgezeichneten Ansatzpunkt halte um die Vater-Kind-Beziehung zu aktivieren und verknüpfe sie unter Punkt sieben mit der Praxis eines Vater-Kind-Wochenendes. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Vater-Kind-Beziehung in der Vergangenheit
- 2.1 (K)eine heile Welt
- 2.2 Die Vaterschaft im 18. Jahrhundert
- 2.3 Die Vaterschaft im 19. Jahrhundert
- 2.4 Die Vaterschaft im 20. Jahrhundert
- 3. Die Vater-Kind-Beziehung in der Gegenwart
- 3.1 Die „Vaterlose Gesellschaft“
- 3.2 Die „Neuen Väter“
- 3.3 Der Wandel der Familie
- 3.3.1 Abwesende Väter
- 3.3.1.1 Durch Erwerbstätigkeit
- 3.3.1.1.1 Ausübung von Teilzeitarbeit durch Väter
- 3.3.1.1.2 Inanspruchnahme von Erziehungszeit durch Väter
- 3.3.1.2 Durch Scheidung und Trennung
- 3.3.1.3 Durch Flucht in „Häusliche Pflichten“ und Hobbys
- 3.3.1.4 Durch Fehlen von Vaterfiguren im institutionellen Kontext
- 3.3.2 Anwesende Väter
- 3.3.2.1 Ursachen väterlicher Teilhabe
- 3.3.2.2 Umfang väterlicher Teilhabe
- 3.4 Resümee
- 4. Die Bedeutung der Vater-Kind-Beziehung
- 4.1 Die Vaterforschung
- 4.1.1 Der Vaterbegriff – Eine Definition im Wandel
- 4.1.2 Die drei Vaterschaftskonzepte
- 4.1.3 Das Konzept der „Vaterarbeit“
- 4.1.4 Das Modell „elterlichen Engagements“
- 4.1.5 Die Entstehung der Vateridentität und des Vatergefühls
- 4.1.6 Die Vaterschaft - Chance zur Entwicklung
- 4.1.7 Die Vaterschaft - Chance zur Veränderung
- 4.1.8 Die jungen“ und die „alten Väter“
- 4.2 Die Bedeutung des Vaters aus Sicht der Entwicklungspsychologie und der Sozialisationsforschung
- 4.2.1 Die bahnbrechende Entdeckung in der Vater-Kind-Bindung
- 4.2.2 Das Beziehungsdreieck: Mutter-Vater-Kind
- 4.2.2.1 Die Triangulierungsphase
- 4.2.2.2 Die erste ödipale Phase
- 4.2.2.3 Die zweite ödipale Phase
- 4.2.3 Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zur Funktion des Vaters
- 4.2.3.1 Der Vater als Förderer der Sozialisation
- 4.2.3.1.1 Der Vater als Startrampe
- 4.2.3.1.2 Der Vater als Gegner und Schiedsrichter
- 4.2.3.1.3 Der Vater als Lehrer
- 4.2.4 Unterschiedlichkeit und Gleichwertigkeit von Vater und Mutter
- 4.2.5 Die Qualität der Bindung
- 4.3 Auswirkungen der Vateranwesenheit auf die Kinder
- 4.3.1 Auswirkungen der Vateranwesenheit auf Mädchen
- 4.3.2 Auswirkungen der Vateranwesenheit auf Jungen
- 4.4 Folgen der Vaterabwesenheit für die Kinder
- 4.5 Bereicherungen des Mannseins durch aktive und präsente Vaterschaft
- 4.6 Resümee
- 5. Die Förderung der Vater-Kind-Beziehung
- 5.1 Politische, wirtschaftliche und rechtliche Weichenstellungen
- 5.1.1 Durch den Abschied vom „patriarchalen Sozialstaat“
- 5.1.2 Durch den Ausbau von Teilzeitarbeitplätzen
- 5.1.3 Durch die Schaffung von unabhängigen Begleitungs- und Betreuungsinstanzen bei Scheidung und Trennung
- 5.2 Persönliche Weichenstellungen
- 5.2.1 Durch mehr „Sein“ als „Schein“
- 5.2.2 Durch Verzicht
- 5.3 Pädagogische Weichenstellungen
- 5.3.1 Durch den Ausbau von Beratungs- und Begleitungsangeboten
- 5.3.2 Durch Aufwertung von Vaterfiguren in der pädagogischen Arbeit
- 5.3.3 Durch Ausweitung der pädagogischen Angebote
- 6. Die Aktivierung der Vater-Kind-Beziehung durch die Methode der Erlebnispädagogik
- 6.1 Die Methode der Erlebnispädagogik
- 6.1.1 Geschichte der Erlebnispädagogik
- 6.1.1.1 Erlebnispädagogische Spuren in dem Erziehungsroman „Emile“
- 6.1.1.2 Erlebnispädagogische Ansätze aus der Reformpädagogik
- 6.1.1.3 Kurt Hahn - Vater der Erlebnispädagogik
- 6.1.1.4 Erlebnispädagogik – Von den Nationalsozialisten missbraucht, im Wirtschaftswunder vernachlässigt
- 6.1.2 Begriffe, Merkmale und Modelle der Erlebnispädagogik
- 6.1.3 Lernziele, Zielgruppen und Einsatzfelder der Erlebnispädagogik
- 6.1.4 Angebots- und Reflektionsmodelle in der Erlebnispädagogik
- 6.1.5 Kritikpunkte an der Erlebnispädagogik
- 6.1.6 Resümee
- 6.2 Die Methode der Erlebnispädagogik und ihre Anwendung auf die Vater-Kind-Beziehung
- 7. Der Transfer in die Praxis: Ein erlebnispädagogisches Wochenende mit Vätern und Kindern
- 7.1 Das Zielpublikum
- 7.2 Die Ausschreibung
- 7.3 Der Veranstaltungszeitraum
- 7.4 „Hardcore-“ contra „Weicheiangebot“
- 7.5 Die Trägerschaft
- 7.6 Die Finanzierungen
- 7.7 Der Wochenendablauf
- 7.8 Resümee
- Die historische Entwicklung der Vaterschaft und ihr Wandel im Laufe der Zeit
- Die Herausforderungen und Chancen der modernen Vaterrolle in der „Vaterlosen Gesellschaft“
- Die Bedeutung der Vater-Kind-Beziehung aus Sicht der Entwicklungspsychologie und Sozialisationsforschung
- Die Förderung der Vater-Kind-Beziehung durch politische, wirtschaftliche, rechtliche und pädagogische Maßnahmen
- Der Einsatz der Erlebnispädagogik als Methode zur Aktivierung und Stärkung der Vater-Kind-Beziehung
- Kapitel 2 beleuchtet die historische Entwicklung der Vater-Kind-Beziehung, beginnend mit der „heilen Welt“ des 18. Jahrhunderts, über die patriarchalen Strukturen des 19. Jahrhunderts bis hin zu den komplexen Familienformen des 20. Jahrhunderts. Die Arbeit zeigt auf, wie sich die Rolle des Vaters im Laufe der Zeit gewandelt hat und welche gesellschaftlichen und kulturellen Einflüsse diese Entwicklung geprägt haben.
- Kapitel 3 widmet sich der Vater-Kind-Beziehung in der Gegenwart. Es werden die Herausforderungen und Chancen der „Vaterlosen Gesellschaft“ sowie der Wandel der Familie und die verschiedenen Facetten der „Neuen Väter“ beleuchtet. Die Kapitel analysiert die Ursachen für die Abwesenheit von Vätern sowie die zunehmenden Bemühungen um eine stärkere väterliche Teilhabe.
- Kapitel 4 befasst sich mit der Bedeutung der Vater-Kind-Beziehung aus Sicht der Entwicklungspsychologie und Sozialisationsforschung. Die Arbeit stellt die bahnbrechende Entdeckung der Vater-Kind-Bindung vor und beleuchtet die wichtige Rolle des Vaters im Beziehungsdreieck Mutter-Vater-Kind. Die Kapitel beleuchtet die Funktion des Vaters als Förderer der Sozialisation und die Auswirkungen der Vateranwesenheit bzw. -abwesenheit auf die Kinder.
- Kapitel 5 widmet sich der Förderung der Vater-Kind-Beziehung. Es werden politische, wirtschaftliche, rechtliche und pädagogische Maßnahmen vorgestellt, die eine stärkere väterliche Teilhabe und eine gelingende Vater-Kind-Beziehung fördern können.
- Kapitel 6 stellt die Erlebnispädagogik als Methode zur Aktivierung der Vater-Kind-Beziehung vor. Es werden die Geschichte, die Begriffe, Merkmale und Modelle der Erlebnispädagogik erläutert sowie die Lernziele, Zielgruppen und Einsatzfelder dieser pädagogischen Methode dargelegt. Darüber hinaus werden Kritikpunkte an der Erlebnispädagogik diskutiert und die Anwendung der Methode auf die Vater-Kind-Beziehung beleuchtet.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Bedeutung der Vater-Kind-Beziehung und deren sozialpädagogischer Förderung. Ziel der Arbeit ist es, die Relevanz der Vaterrolle für die Entwicklung von Kindern aufzuzeigen und gleichzeitig die Herausforderungen und Möglichkeiten einer aktivierenden Förderung der Vater-Kind-Beziehung anhand des aktivierenden Ansatzes der Erlebnispädagogik zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Vater-Kind-Beziehung, Vaterschaft, Vaterrolle, Entwicklungspsychologie, Sozialisationsforschung, Erlebnispädagogik, aktivierender Ansatz, Förderung, Teilhabe, Familie, Gesellschaft, Wandel, „Vaterlose Gesellschaft“, „Neue Väter“
- Quote paper
- Diplomsozialpädagoge Rüdiger Jope (Author), 2006, Kinder brauchen Väter. Die Bedeutung der Vater-Kind-Beziehung und ihre sozialpädagogische Förderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80774