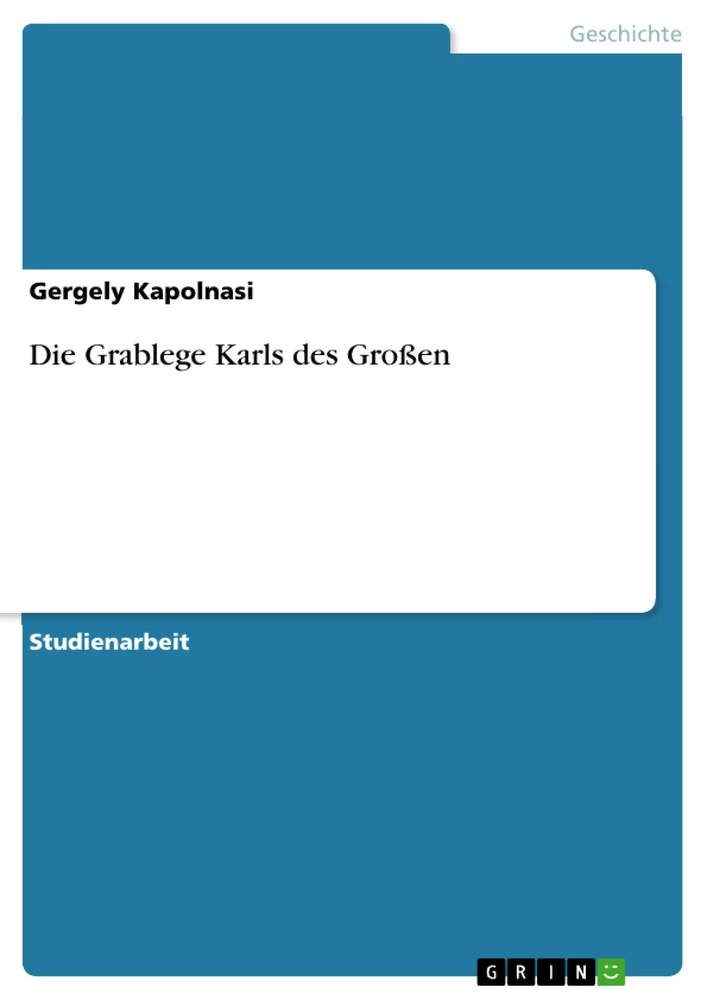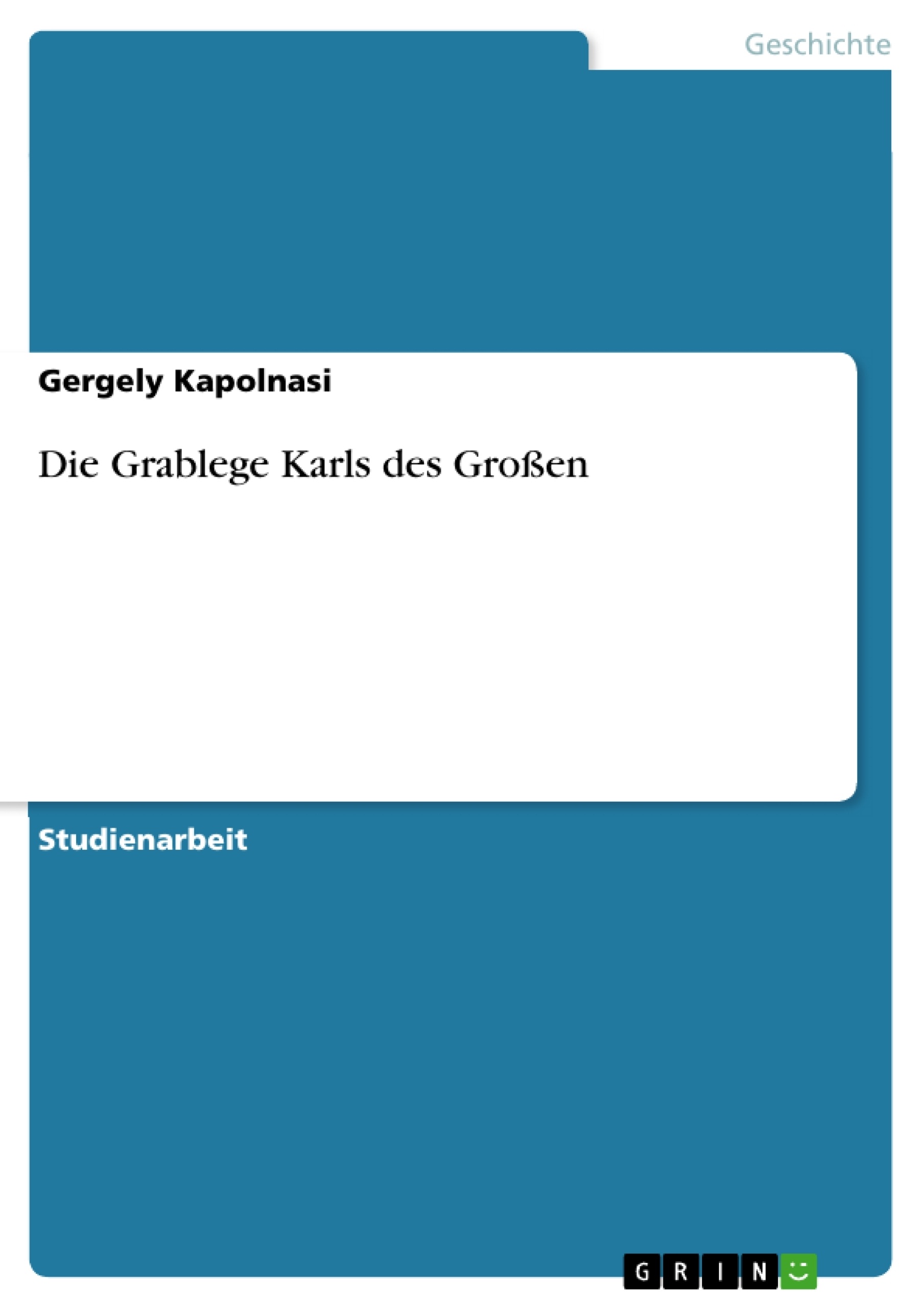Am 28. Januar des Jahres 814 starb Kaiser Karl der Große, einer der bedeutendsten Herrscher des Frankenreiches. Er wurde noch am gleichen Tag in der von ihm gestifteten Marienkirche zu Aachen beigesetzt. Doch obwohl sich um die Taten des Frankenherrschers bis heute zahlreiche Geschichten ranken, geriet die genaue Lage seines Grabes bald in Vergessenheit. Bevor Kaiser Otto III. das Grab seines berühmten Vorgängers im Jahre 1000 öffnen ließ, musste er es zunächst mühsam suchen lassen. Nach der Umbettung der Gebeine Karls in den Karlsschrein im Jahre 1215 verlor das ursprüngliche Grab vollends an Bedeutung und verschwand aus dem Bewusstsein der Menschen für Jahrhunderte.
Lange Zeit vermutete man das Grab in der Mitte des Oktogons der Aachener Marienkirche. Im 19. und 20. Jahrhundert schließlich begann man mit der systematischen Suche nach der ursprünglichen Grablege Karls des Großen. Sie gestaltete sich mühsam, denn die schriftlichen Quellen des 9. Jahrhunderts und späterer Zeiten nur wenig aufschlussreich sind und sich in vielen Details widersprechen. Auch die archäologischen Befunde sind nicht eindeutig und lassen vielerlei Spekulationen zu.
Ziel dieser Arbeit ist, die wichtigsten Theorien des späten 19. und des 20. Jahrhunderts über die Lage des Karlsgrabes zusammenzufassen und zu diskutieren. Dabei soll sowohl auf schriftliche Quellen als auch auf archäologische Befunde eingegangen werden, da eine sinnvolle Beschäftigung mit der Frage nur durch eine Kombination dieser beiden Disziplinen möglich ist.
Zunächst soll kurz auf die Frage eingegangen werden, welche Bedeutung Aachen für Karl den Großen zu seinen Lebzeiten hatte. Anschließend werden die gängigsten Theorien über die Lage des Grabes vorgestellt und auf ihre Schlüssigkeit überprüft. Danach folgt die weitere Geschichte des Karlsgrabes bis zur Umbettung der Gebeine des Kaisers im Jahre 1215 durch Friedrich II. in den Karlsschrein, in dem sie bis heute ruhen. In diesem Zusammenhang sollen auch die Graböffnung durch Otto III. im Jahre 1000 und die Heiligsprechung Karls 1165 durch Friedrich I. Barbarossa näher erläutert werden. Ein anschließender kurzer Abriss über den Karlsschrein soll das hier gezeichnete Bild abrunden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Karl der Große und Aachen
- 2. Tod und Grablege Karls des Großen
- 2.1. Der Tod Karls des Großen und sein Begräbnis im Spiegel zeitgenössischer Quellen
- 2.2. Der Sarkophag Karls des Großen
- 2.2.1. Die Frage nach der Sitzbestattung Karls des Großen
- 2.2.2. Der Persephonen- / Proserpinasarkophag von Aachen
- 2.3. Die Lage des ursprünglichen Grabes Karls des Großen in der Aachener Pfalzkirche
- 2.3.1. Die Theorien über die Lage des Karlsgrabes von 1620 bis heute
- 2.3.2. Die Schlüssigkeit der Theorien über die Lage des Grabes
- 3. Die Öffnung des Grabes durch Otto III.
- 4. Die Öffnung des Grabes durch Friedrich I.
- 5. Der Karlsschrein
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die verschiedenen Theorien über die ursprüngliche Grablege Kaiser Karls des Großen in der Aachener Pfalzkirche. Sie analysiert schriftliche Quellen und archäologische Befunde, um die Schlüssigkeit der verschiedenen Hypothesen zu bewerten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Verständnisses der Grabstätte vom 9. Jahrhundert bis zur Umbettung im Jahre 1215.
- Die Bedeutung Aachens für Karl den Großen.
- Die verschiedenen Theorien zur Lage des ursprünglichen Grabes.
- Die Analyse schriftlicher Quellen zur Bestattung Karls des Großen.
- Die Bewertung archäologischer Befunde im Kontext der Grablage.
- Die Geschichte des Karlsgrabes bis zur Umbettung im Karlsschrein.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Forschungsgegenstand: die ungeklärte Lage des ursprünglichen Grabes Kaiser Karls des Großen in Aachen. Sie benennt die methodische Vorgehensweise, die auf einer Kombination von schriftlichen und archäologischen Quellen basiert, und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Schwierigkeit der Forschung liegt in der Knappheit und Widersprüchlichkeit der vorhandenen Quellen.
1. Karl der Große und Aachen: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung Aachens für Karl den Großen zu Lebzeiten. Es wird die Entwicklung Aachens von einer Pfalz zu einer bedeutenden Kaiserresidenz dargestellt, basierend auf Quellen wie Einhard's Vita Karoli Magni. Die Errichtung der Marienkirche und die heißen Quellen werden als Gründe für Karls Präferenz für Aachen hervorgehoben, und der Status Aachens als „zweites Rom“ wird diskutiert. Der Wunsch Karls, ursprünglich in St.-Denis bestattet zu werden, wird als Kontrast zum finalen Begräbnis in Aachen dargestellt, welches dessen Bedeutung für den Kaiser unterstreicht.
2. Tod und Grablege Karls des Großen: Dieses Kapitel befasst sich mit den zeitgenössischen Berichten über den Tod und die Bestattung Karls des Großen. Die Berichte von Thegan und Astronomus werden als knapp und wenig detailliert beschrieben, während Einhards Bericht zwar ausführlicher ist, aber ebenfalls keine präzise Beschreibung der Grablage bietet. Die Kapitel analysieren die widersprüchlichen Aussagen und die daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der Lokalisierung des ursprünglichen Grabes. Der Fokus liegt auf der Analyse der verfügbaren Quellen und deren Limitationen.
Häufig gestellte Fragen zum Thema: Die Grablege Karls des Großen
Wo befand sich das ursprüngliche Grab Karls des Großen in der Aachener Pfalz?
Die genaue Lage des ursprünglichen Grabes Karls des Großen in der Aachener Pfalz ist ungeklärt und Gegenstand dieser Arbeit. Die Forschung basiert auf der Analyse zeitgenössischer Quellen und archäologischer Befunde, um die verschiedenen Theorien zu bewerten und die Schlüssigkeit der Hypothesen zu überprüfen.
Welche Quellen wurden für die Untersuchung herangezogen?
Die Untersuchung stützt sich auf eine Kombination aus schriftlichen Quellen (z.B. Berichte von Einhard, Thegan und Astronomus) und archäologischen Befunden. Die Arbeit analysiert die verfügbaren Quellen, ihre Widersprüche und Limitationen, um ein möglichst umfassendes Bild der Grablage zu erstellen.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung Aachens für Karl den Großen, die verschiedenen Theorien zur Lage seines ursprünglichen Grabes, die Analyse schriftlicher Quellen zur Bestattung, die Bewertung archäologischer Befunde im Kontext der Grablage und die Geschichte des Karlsgrabes bis zur Umbettung im Karlsschrein. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Verständnisses der Grabstätte vom 9. Jahrhundert bis zur Umbettung im Jahre 1215.
Wie wird die methodische Vorgehensweise in der Arbeit beschrieben?
Die methodische Vorgehensweise basiert auf einer Kombination von Quellenkritik und -analyse. Schriftliche Quellen werden auf ihre Aussagekraft und Widersprüche hin untersucht. Archäologische Befunde werden im Kontext der verschiedenen Theorien zur Grablage interpretiert. Die Arbeit berücksichtigt die Schwierigkeit der Forschung aufgrund der Knappheit und Widersprüchlichkeit der vorhandenen Quellen.
Welche Rolle spielt der Sarkophag Karls des Großen in der Forschung?
Die Arbeit befasst sich mit dem Sarkophag Karls des Großen, insbesondere mit der Frage nach seiner ursprünglichen Verwendung (Sitzbestattung) und seiner Identifizierung als Persephonen-/Proserpinasarkophag. Dieser Aspekt ist relevant für die Rekonstruktion der Grablege.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Karl dem Großen und Aachen, seinem Tod und seiner Grablege (inklusive detaillierter Unterkapitel zu den verschiedenen Theorien und archäologischen Aspekten), den Öffnungen des Grabes durch Otto III. und Friedrich I., dem Karlsschrein und einem Fazit. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis befindet sich im Text.
Welche Bedeutung hat die Aachener Pfalz für die Untersuchung?
Die Aachener Pfalz spielt eine zentrale Rolle, da sie der Ort des ursprünglichen Grabes Karls des Großen war. Die Arbeit untersucht die Bedeutung Aachens für Karl den Großen zu Lebzeiten und beleuchtet dessen Entwicklung zur Kaiserresidenz. Die Errichtung der Marienkirche und die Bedeutung der heißen Quellen werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Arbeit gezogen?
Das Fazit der Arbeit fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und bewertet die Schlüssigkeit der verschiedenen Theorien zur Lage des ursprünglichen Grabes. Aufgrund der Knappheit und Widersprüchlichkeit der Quellen bleiben einige Fragen möglicherweise offen.
- Quote paper
- Gergely Kapolnasi (Author), 2007, Die Grablege Karls des Großen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80771