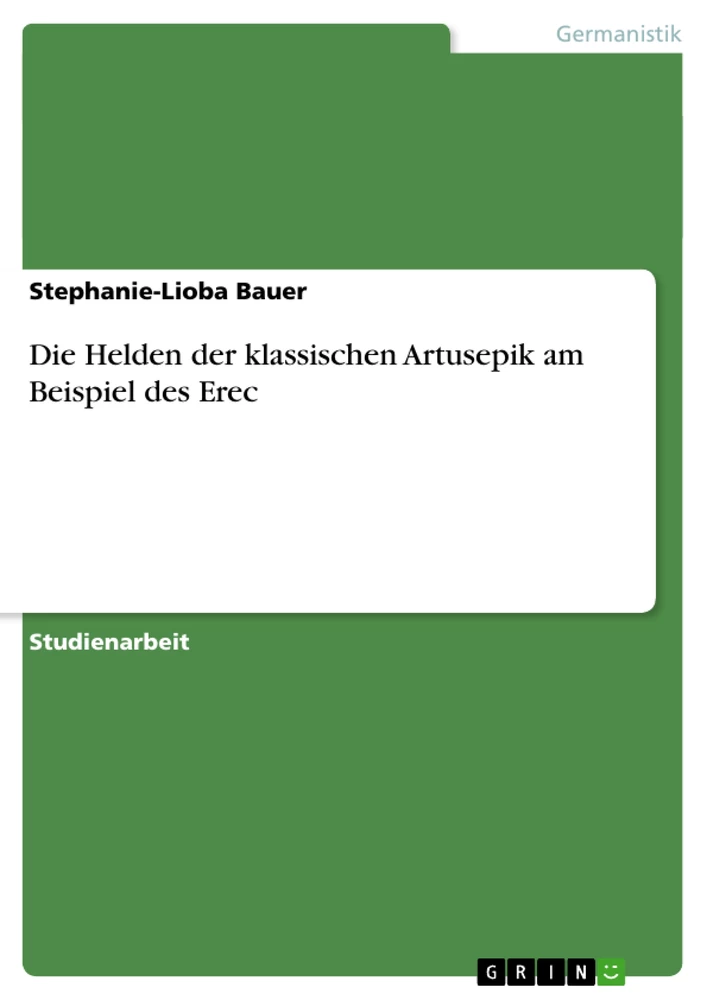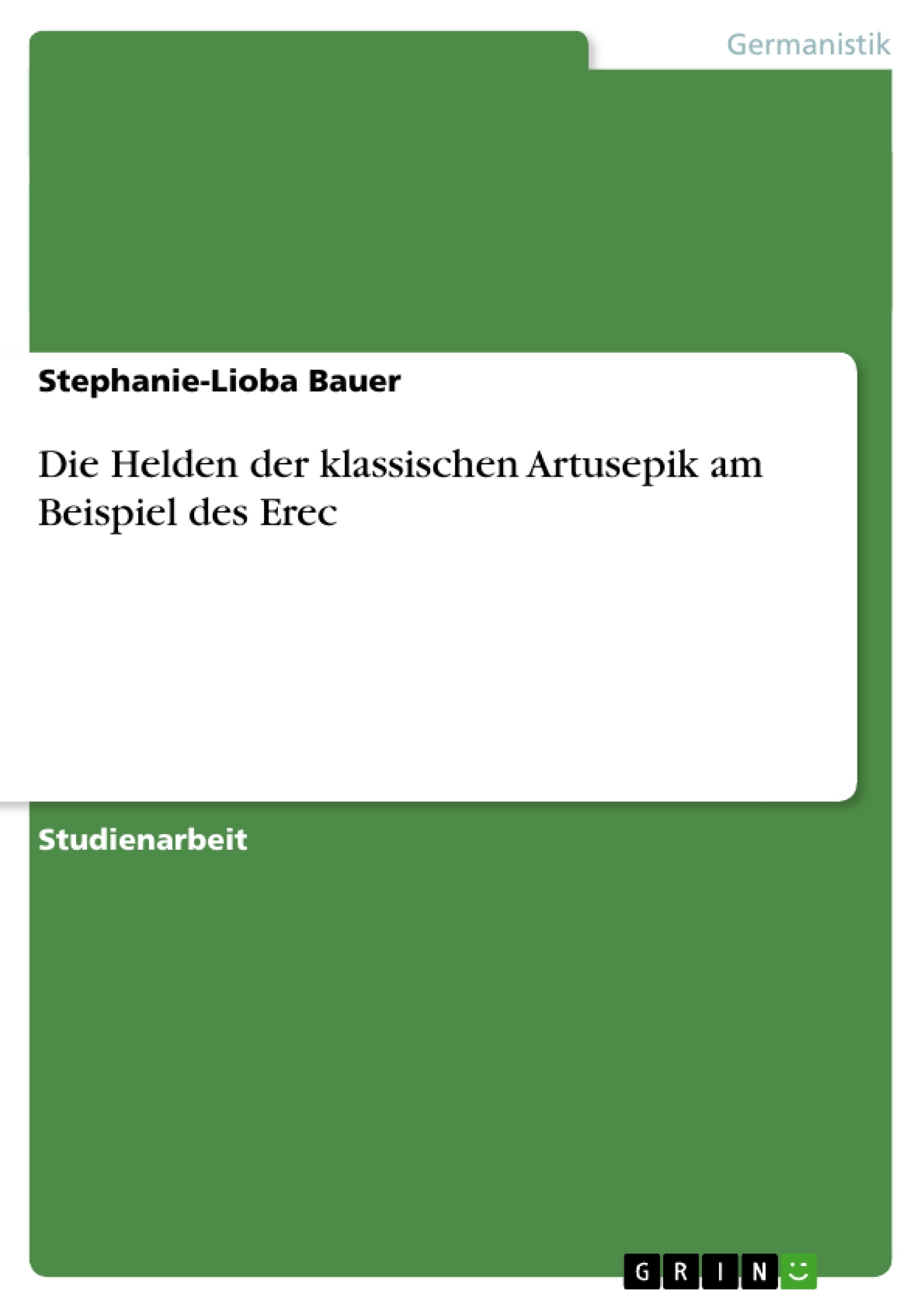Der Artusroman wurde zur bedeutendsten Romangattung des europäischen Mittelalters, die jahrhundertelang alle anderen dominierte.
Schöpfer des Artusromans ist der Franzose Chrétien de Troyes. Alle Merkmale sind bei ihm bereits vorgeprägt, die auch für den deutschen Artusroman typisch wurden:
Den Kopf der Tafelrunde bildet der große, tapfere, ehrbare und strahlende König Artus.
Er ist der Kristallisationspunkt der höfischen Freude für die um ihn versammelten Helden. An der runden Tafel ist keine hierarchische Sitzordnung möglich und dies dokumentiert die Gleichberechtigung aller Mitglieder. Größtmögliche Freiheit gewährt der König als primus inter pares (als "Erster unter Gleichen") seinen Rittern, da von deren Vollkommenheit der Glanz des Artushofes abhängt. Dem einzelnen Ritter wird durch die Aufnahme in die Tafelrunde seine Idealität bestätigt. Allerdings muss er sich immer wieder aufs neue bewähren und seinen Rang durch ritterliche Taten, durch Âventiuren, verteidigen.
In der Âventiure verwirklicht der Ritter sich durch eine Tat, ein Kampf unter Einsatz seines Lebens. Für das erfolgreiche Bestehen wird er dann oft mit einer ebenso schönen wie reichen Frau belohnt.
Die Romane enden meist mit dem Einzug des Paares in den Artushof, in die "heiligen Hallen der Artusepen".
Mit Hartmann von Aue (ca. 1165 - ca. 1215) setzt die Artusdichtung in Deutschland gleich auf höchstem Niveau ein.
Mit seinem ersten Roman dieser Gattung "Erec" (um 1185) wurde die Artusepik in Deutschland eingeführt und entwickelte sich zum Muster der Gattung. Dies ist heute unbestritten, jedoch darüber wie und auf welchem Wege der Stoff nach Deutschland kam ist die Forschung sich nicht ganz einig. Als Vermittler sind wohl einflussreiche Mäzene deutscher Fürstenhäuser mit engen Kontakten nach Frankreich und der dort bereits blühenden höfischen Kultur anzusehen. Aus diesem Grund gibt es drei Thesen zur Stoffrezeption:
1. über die Staufer
2. über die Zähringer und
3. über den mittelniederrheinischen Raum mit seinen engen Beziehungen nach Frankreich.
Dabei muss man aber bedenken, dass in Deutschland kein einziger französischer Text überliefert ist, so dass immer noch unklar ist, wie die Autoren der hochhöfischen Zeit an ihre Vorlagen gelangten.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorwort: Die Artusepik in Deutschland
- II. Der mühsame Saelden wec: Die Helden der klassischen Artusepik am Beispiel des Erec
- 1. Der Weg in die Schuld (erster Kursus)
- 2. Die Frage nach der Schuld
- 3. Der Weg aus der Schuld (zweiter Kursus)
- III. Schlussgedanke
- IV. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Helden der klassischen Artusepik, indem sie Hartmann von Aues "Erec" als Fallbeispiel heranzieht. Ziel ist es, die Struktur und die zentralen Themen des Epos zu analysieren und deren Bedeutung im Kontext der höfischen Literatur des Mittelalters zu beleuchten.
- Die Darstellung des Helden im mittelalterlichen Artusroman
- Die Bedeutung der "Aventiuren" für die Heldenentwicklung
- Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft im "Erec"
- Die Struktur des "doppelten Kursus" und ihre literarische Funktion
- Der Einfluss französischer Artusromane auf die deutsche Artusdichtung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Vorwort: Die Artusepik in Deutschland: Dieses Vorwort gibt eine Einführung in die Artusepik des europäischen Mittelalters und betont die herausragende Stellung des Artusromans als dominierende Gattung. Es werden die typischen Merkmale des Artusromans nach Chrétien de Troyes beschrieben, darunter die zentrale Figur König Artus und die Bedeutung der Tafelrunde als Symbol der Gleichberechtigung und des Rittertums. Das Vorwort beleuchtet den Beginn der Artusdichtung in Deutschland mit Hartmann von Aue und dessen einflussreichem "Erec", das als Muster für die Gattung diente. Es werden verschiedene Thesen zur Übertragung des Stoffes nach Deutschland diskutiert, wobei die Rolle einflussreicher Mäzene und der engen Verbindungen zwischen deutschen Fürstenhäusern und Frankreich hervorgehoben wird. Die Unsicherheit über die genaue Übermittlung der französischen Texte nach Deutschland wird ebenfalls angesprochen.
II. Der mühsame Saelden wec: Die Helden der klassischen Artusepik am Beispiel des Erec: Dieses Kapitel analysiert die Struktur und die zentralen Themen von Hartmanns "Erec". Es werden verschiedene Interpretationen der Struktur, insbesondere die Konzepte des "doppelten Kursus" und der "Doppelwegstruktur", diskutiert und in Bezug auf die Darstellung der Heldenentwicklung und des Verhältnisses zwischen Individuum und Gesellschaft gesetzt. Der "doppelte Kursus" wird im Zusammenhang mit der Entwicklung des Helden Erec erläutert, von seiner Hochzeit und dem folgenden Verzicht auf Rittertumpf bis hin zu seiner Reintegration in die höfische Gesellschaft nach bestandenen Abenteuern. Die "Aventiuren" werden als "Isolierung im Dienste der Gesellschaft" interpretiert, als individuelles Prüfverfahren, das dennoch eng mit der gesellschaftlichen Ordnung verbunden bleibt. Die Debatte um die Frage, ob Erec von Anfang an schuldig handelt oder erst im Verlauf der Handlung, wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Artusepik, Hartmann von Aue, Erec, Aventiure, Rittertum, höfische Gesellschaft, doppelter Kursus, Individuum und Gesellschaft, Schuldigkeit, Reintegration.
Häufig gestellte Fragen zu: "Der mühsame Saelden wec: Die Helden der klassischen Artusepik am Beispiel des Erec"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Helden der klassischen Artusepik, insbesondere anhand von Hartmann von Aues "Erec". Sie untersucht die Struktur und zentralen Themen des Epos und deren Bedeutung im Kontext der höfischen Literatur des Mittelalters.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung des Helden im mittelalterlichen Artusroman, der Bedeutung der "Aventiuren" für die Heldenentwicklung, dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft im "Erec", der Struktur des "doppelten Kursus" und deren literarischer Funktion sowie dem Einfluss französischer Artusromane auf die deutsche Artusdichtung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort, ein Hauptkapitel zur Analyse von Hartmanns "Erec" und einen Schlussgedanken. Das Vorwort bietet eine Einführung in die Artusepik in Deutschland, während das Hauptkapitel die Struktur und die zentralen Themen des "Erec" detailliert untersucht. Die Kapitelzusammenfassung fasst die wesentlichen Inhalte der einzelnen Abschnitte zusammen.
Was ist der "doppelte Kursus" und welche Bedeutung hat er?
Der "doppelte Kursus" beschreibt die Struktur des "Erec", die aus zwei Phasen besteht: Erecs Hochzeit und der darauf folgende Verzicht auf Rittertaten, gefolgt von seiner Rückkehr in die höfische Gesellschaft nach bestandenen Abenteuern. Er wird als zentrales Element der Heldenentwicklung und des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft interpretiert.
Welche Rolle spielen die "Aventiuren"?
Die "Aventiuren" werden als individuelle Prüfverfahren interpretiert, die eng mit der gesellschaftlichen Ordnung verbunden sind und als "Isolierung im Dienste der Gesellschaft" verstanden werden. Sie dienen der Entwicklung des Helden Erec.
Wie wird die Schuldfrage im "Erec" behandelt?
Die Arbeit thematisiert die Debatte um die Frage, ob Erec von Anfang an schuldig handelt oder erst im Verlauf der Handlung. Sie untersucht die verschiedenen Interpretationen dieses Aspekts.
Welche Bedeutung hat das Vorwort?
Das Vorwort bietet eine Einführung in die Artusepik des europäischen Mittelalters und die herausragende Stellung des Artusromans. Es beschreibt typische Merkmale des Artusromans und beleuchtet den Beginn der Artusdichtung in Deutschland, die Rolle Hartmanns von Aue und die Übertragung des Stoffes nach Deutschland.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Artusepik, Hartmann von Aue, Erec, Aventiure, Rittertum, höfische Gesellschaft, doppelter Kursus, Individuum und Gesellschaft, Schuldigkeit, Reintegration.
Für welche Zielgruppe ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit der mittelalterlichen Literatur, insbesondere der Artusepik, beschäftigt.
- Quote paper
- Stephanie-Lioba Bauer (Author), 2002, Die Helden der klassischen Artusepik am Beispiel des Erec, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8074