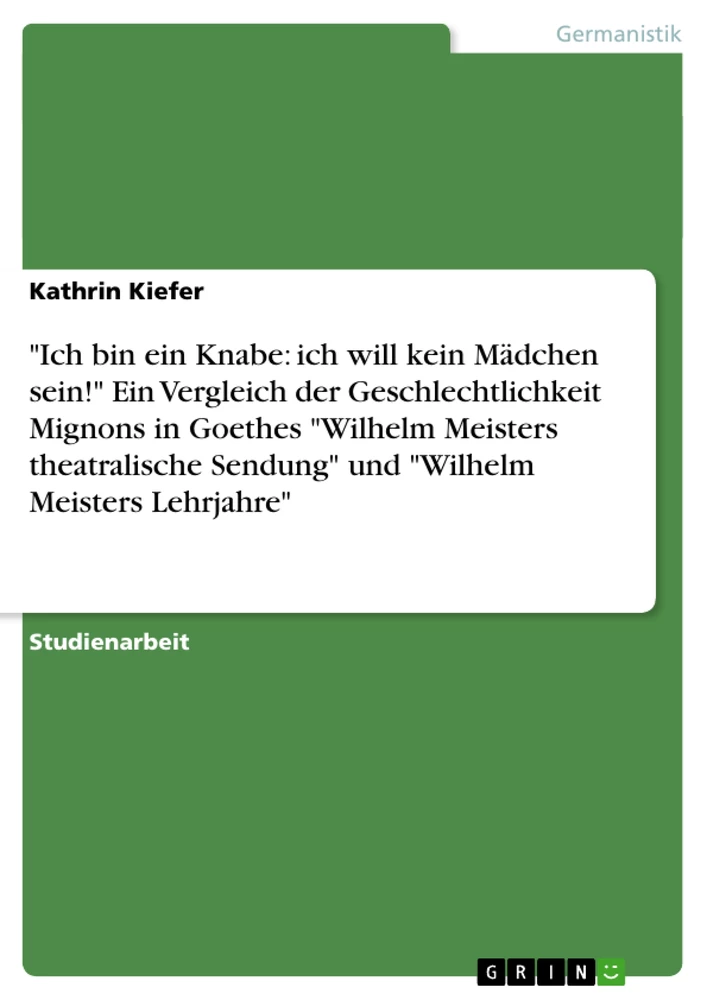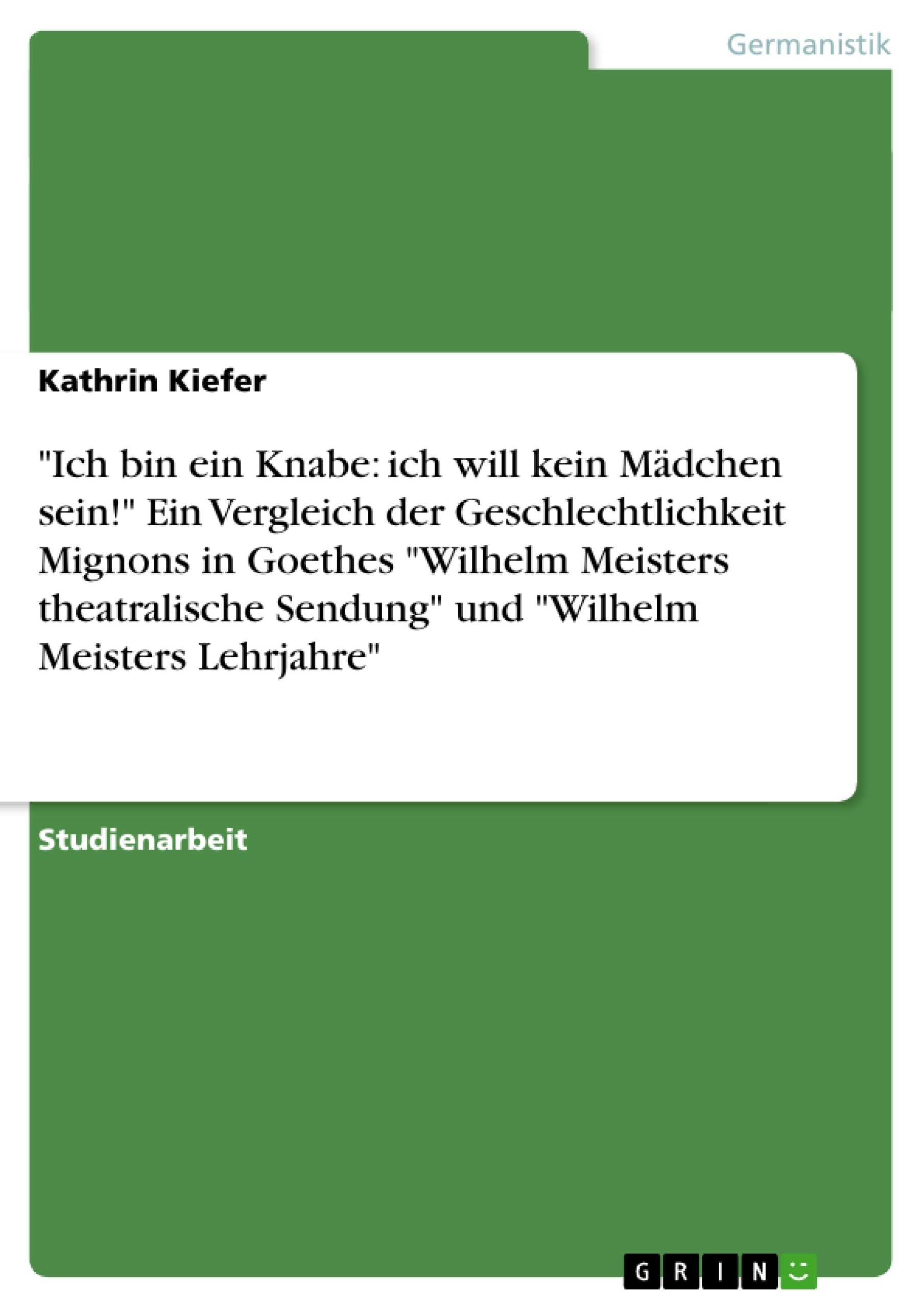Die Thematik des Geschlechts, seiner Bedeutung in der Gesellschaft sowie für den Menschen selbst ist auch in der Literatur oft zu finden: Über theoretische Texte, die das Geschlecht und seine Alternativen diskutieren bis hin zu Dramen und Romanen, die sich mit diesem Thema beschäftigen oder ihre Figuren als Träger dieser Problematik benutzen.
Johann Wolfgang Goethe hat diesen Stoff innerhalb seiner Wilhelm Meister- Romane aufgegriffen. Seine Figur der Mignon ist ein Geschöpf, das sich nicht auf Anhieb als Junge oder Mädchen einordnen lässt. Er spielt bewusst mit der Geschlechtlichkeit Mignons, was verschiedene Reaktionen bei den Figuren im Text, aber auch beim Leser hervorruft. Das Fragment Wilhelm Meisters Theatralische Sendung ist die Urfassung seines fertig gestellten Romans Wilhelm Meisters Lehrjahre. Doch nicht nur Titel und Länge der Urfassung haben sich geändert, vor allem auch erfahren bestimmte Personen eine Wandlung in ihrer Anlage und in deren Ausführung. Allen voran Mignon, eine in der Forschung viel diskutierte und heiß umstrittene Figur.
In der vorliegenden Arbeit soll nun diese Wandlung von Ur- zu Endfassung unter dem speziellen Aspekt der Geschlechtlichkeit aufgeführt, verglichen und analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einführung und Kauf Mignons
- 2.1. Wilhelm Meisters Theatralische Sendung
- 2.2. Wilhelm Meisters Lehrjahre
- 3. Mignons erster Anfall und sein Kontext
- 3.1. Wilhelm Meisters Theatralische Sendung
- 3.2. Wilhelm Meisters Lehrjahre
- 4. Mignon und Wilhelm
- 4.1. Wilhelm Meisters Theatralische Sendung
- 4.2. Wilhelm Meisters Lehrjahre
- 5. Die Geschlechtlichkeit Mignons
- 5.1. Wilhelm Meisters Theatralische Sendung
- 5.2. Wilhelm Meisters Lehrjahre
- 6. Die Bedeutung der Geschlechtlichkeit für die Figur Mignon
- 6.1. Wilhelm Meisters Theatralische Sendung
- 6.2. Wilhelm Meisters Lehrjahre
- 7. Die Geschichte und Biologisierung Mignons
- 7.1. Wilhelm Meisters Theatralische Sendung
- 7.2. Wilhelm Meisters Lehrjahre
- 8. Zusammenfassender Vergleich der Figur Mignon in Wilhelm Meisters Theatralische Sendung und Wilhelm Meisters Lehrjahre
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Figur Mignon in Goethes "Wilhelm Meisters Theatralische Sendung" und "Wilhelm Meisters Lehrjahre", insbesondere im Hinblick auf die Ambiguität ihres Geschlechts. Ziel ist es, die Veränderungen in der Darstellung Mignons von der Urfassung zur endgültigen Version zu analysieren und deren Bedeutung für die Gesamtinterpretation der Figur zu beleuchten.
- Die Ambiguität von Mignons Geschlecht und deren Darstellung in beiden Versionen.
- Der Einfluss der Erzählperspektive auf die Wahrnehmung Mignons.
- Die Rolle von Mignon im Kontext der Handlung beider Romane.
- Die Entwicklung der Beziehung zwischen Mignon und Wilhelm.
- Die Bedeutung von Mignons Geschichte für das Verständnis ihrer Persönlichkeit.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Geschlechts und seiner Bedeutung in Literatur und Gesellschaft ein. Sie stellt Goethes Mignon als Beispiel für eine Figur vor, deren Geschlecht ambivalent dargestellt wird, und kündigt die vergleichende Analyse der Figur in den beiden Wilhelm-Meister-Versionen an. Die zentrale Frage nach der Bedeutung der Geschlechterfluidität für die Interpretation der Figur wird als Leitmotiv der Arbeit etabliert.
2. Einführung und Kauf Mignons: Dieses Kapitel vergleicht die Einführung Mignons in "Wilhelm Meisters Theatralische Sendung" und "Wilhelm Meisters Lehrjahre". In der Urfassung wird Mignon zunächst indirekt durch Madame Melina vorgestellt, wobei ihr Kauf bereits vollzogen ist und ihr Wert primär durch ihre Nutzbarkeit für das Theater bestimmt wird. Im Gegensatz dazu wird Mignon in den "Lehrjahren" direkt von Wilhelm entdeckt und gekauft, wodurch die Beziehung zwischen den beiden Figuren von Anfang an anders definiert wird: Die materialistische Komponente des Kaufs tritt in den Hintergrund, die Beziehung wird intimer und mysteriöser.
3. Mignons erster Anfall und sein Kontext: Die Analyse fokussiert auf Mignons ersten Anfall und seinen Kontext in beiden Romanen. Die Kapitel vergleichen die Darstellung dieses Ereignisses und dessen Interpretation durch die umgebenden Figuren. Es wird untersucht, wie die Ambiguität von Mignons Geschlecht die Reaktionen der Figuren beeinflusst und wie dieser Aspekt zur Gesamtinterpretation des Anfalls beiträgt. Die unterschiedliche Behandlung dieses Schlüsselereignisses in den beiden Versionen wird detailliert untersucht, um die Veränderungen in der Charakterisierung Mignons herauszuarbeiten.
4. Mignon und Wilhelm: Dieses Kapitel befasst sich mit der Beziehung zwischen Mignon und Wilhelm in beiden Versionen. Es wird analysiert, wie sich diese Beziehung entwickelt, welche Rolle Mignons Geschlecht dabei spielt und wie die unterschiedlichen Erzählperspektiven und Handlungskontexte die Dynamik der Beziehung prägen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Aspekt der Abhängigkeit und des Vertrauens gewidmet. Der Vergleich beleuchtet, wie sich das Verhältnis zwischen Wilhelm und Mignon in der Urfassung und der Endfassung unterscheidet und welche Bedeutung dies für das Verständnis der Figur Mignon hat.
5. Die Geschlechtlichkeit Mignons: Dieser Abschnitt analysiert die explizite und implizite Darstellung der Geschlechtlichkeit Mignons. Der Fokus liegt auf der bewussten Ambiguität, die Goethe in seiner Charakterisierung einbaut und wie dies die Interpretation der Figur beeinflusst. Es werden sprachliche Mittel und narrative Strategien untersucht, mit denen Goethe die Uneindeutigkeit von Mignons Geschlecht konstruiert und die Reaktionen der Figuren und des Lesers darauf analysiert. Der Vergleich der beiden Versionen zeigt, wie sich Goethes Umgang mit diesem Aspekt im Laufe der Überarbeitung verändert hat.
6. Die Bedeutung der Geschlechtlichkeit für die Figur Mignon: Hier wird die Bedeutung der ambivalenten Geschlechterrolle Mignons für ihre gesamte Charakterisierung untersucht. Es wird analysiert, inwiefern diese Ambiguität zu ihrem geheimnisvollen und rätselhaften Wesen beiträgt und wie sie ihre Rolle in den Romanen prägt. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Geschlechtlichkeit nicht nur als biologisches Merkmal, sondern auch als soziales und kulturelles Konstrukt. Die Entwicklung von Mignons Charakter im Laufe der Handlung wird mit der Ambivalenz ihres Geschlechts in Verbindung gebracht.
7. Die Geschichte und Biologisierung Mignons: Dieser Abschnitt untersucht die Darstellung von Mignons Geschichte und die unterschiedliche Biologisierung ihrer Figur in beiden Versionen. Es wird analysiert, wie die fragmentarische und ungeklärte Vergangenheit Mignons zur Interpretation ihrer ambivalenten Geschlechterrolle beiträgt. Die Kapitel beleuchtet die Frage, inwieweit eine Klärung der biologischen Aspekte ihres Geschlechts für das Verständnis ihrer Figur notwendig oder hilfreich ist. Der Vergleich der beiden Versionen macht deutlich, wie sich Goethes Ansatz in der Darstellung von Mignons Vergangenheit verändert hat.
Schlüsselwörter
Mignon, Wilhelm Meister, Goethe, Theatralische Sendung, Lehrjahre, Geschlechtlichkeit, Ambiguität, Geschlechterrolle, Erzählperspektive, Charakterentwicklung, Romanvergleich, Literaturanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Goethes Wilhelm Meister und der Figur Mignon
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung der Figur Mignon in Goethes "Wilhelm Meisters Theatralische Sendung" und "Wilhelm Meisters Lehrjahre", mit besonderem Fokus auf die Ambiguität ihres Geschlechts. Es wird ein Vergleich beider Versionen vorgenommen, um die Veränderungen in der Darstellung Mignons und deren Bedeutung für die Gesamtinterpretation zu beleuchten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ambiguität von Mignons Geschlecht und deren Darstellung in beiden Romanversionen, den Einfluss der Erzählperspektive auf die Wahrnehmung Mignons, Mignons Rolle im Handlungskontext, die Entwicklung der Beziehung zwischen Mignon und Wilhelm, und die Bedeutung von Mignons Geschichte für das Verständnis ihrer Persönlichkeit. Es werden auch sprachliche Mittel und narrative Strategien untersucht, die Goethe zur Konstruktion der Uneindeutigkeit von Mignons Geschlecht verwendet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert. Kapitel 1 ist eine Einleitung. Kapitel 2 vergleicht die Einführung Mignons in beiden Romanen. Kapitel 3 analysiert Mignons ersten Anfall und dessen Kontext. Kapitel 4 befasst sich mit der Beziehung zwischen Mignon und Wilhelm. Kapitel 5 analysiert die Darstellung der Geschlechtlichkeit Mignons. Kapitel 6 untersucht die Bedeutung der Geschlechtlichkeit für Mignons Charakterisierung. Kapitel 7 untersucht Mignons Geschichte und die Biologisierung ihrer Figur. Kapitel 8 bietet einen zusammenfassenden Vergleich der Figur Mignon in beiden Romanen.
Wie wird die Ambiguität von Mignons Geschlecht untersucht?
Die Ambiguität von Mignons Geschlecht wird durch die Analyse der expliziten und impliziten Darstellung in beiden Romanversionen untersucht. Es werden sprachliche Mittel und narrative Strategien analysiert, die Goethe zur Konstruktion dieser Ambiguität verwendet. Die Reaktionen der Figuren und des Lesers auf diese Ambiguität werden ebenfalls betrachtet.
Welche Rolle spielt die Erzählperspektive?
Die Erzählperspektive spielt eine wichtige Rolle bei der Wahrnehmung Mignons. Der Vergleich der beiden Romanversionen zeigt, wie unterschiedliche Erzählperspektiven die Darstellung und Interpretation von Mignons Geschlecht und ihrer Rolle beeinflussen.
Welche Bedeutung hat Mignons Geschichte für das Verständnis ihrer Figur?
Mignons fragmentarische und ungeklärte Vergangenheit trägt maßgeblich zur Interpretation ihrer ambivalenten Geschlechterrolle bei. Die Arbeit untersucht, inwieweit eine Klärung der biologischen Aspekte ihres Geschlechts für das Verständnis ihrer Figur notwendig oder hilfreich ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Mignon, Wilhelm Meister, Goethe, Theatralische Sendung, Lehrjahre, Geschlechtlichkeit, Ambiguität, Geschlechterrolle, Erzählperspektive, Charakterentwicklung, Romanvergleich, Literaturanalyse.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Leser bestimmt, die sich für die Literatur Goethes, die Figur Mignon, die Thematik der Geschlechterrollen und die vergleichende Literaturanalyse interessieren. Sie eignet sich insbesondere für akademische Zwecke, wie z.B. für Studienarbeiten im Bereich der Germanistik.
- Quote paper
- Kathrin Kiefer (Author), 2005, "Ich bin ein Knabe: ich will kein Mädchen sein!" Ein Vergleich der Geschlechtlichkeit Mignons in Goethes "Wilhelm Meisters theatralische Sendung" und "Wilhelm Meisters Lehrjahre", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80727