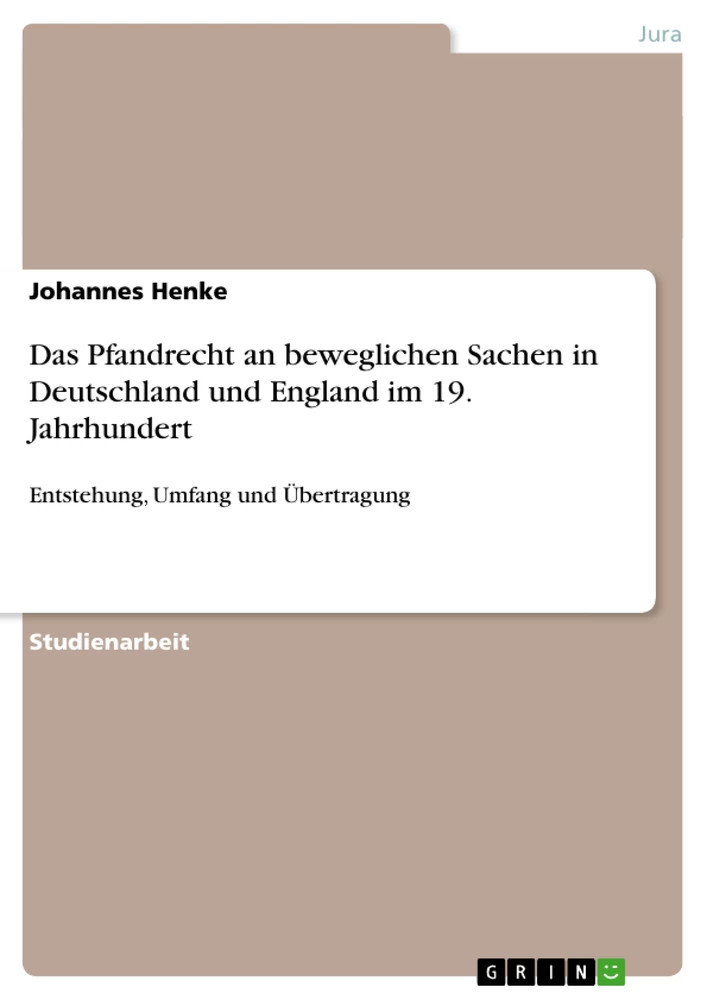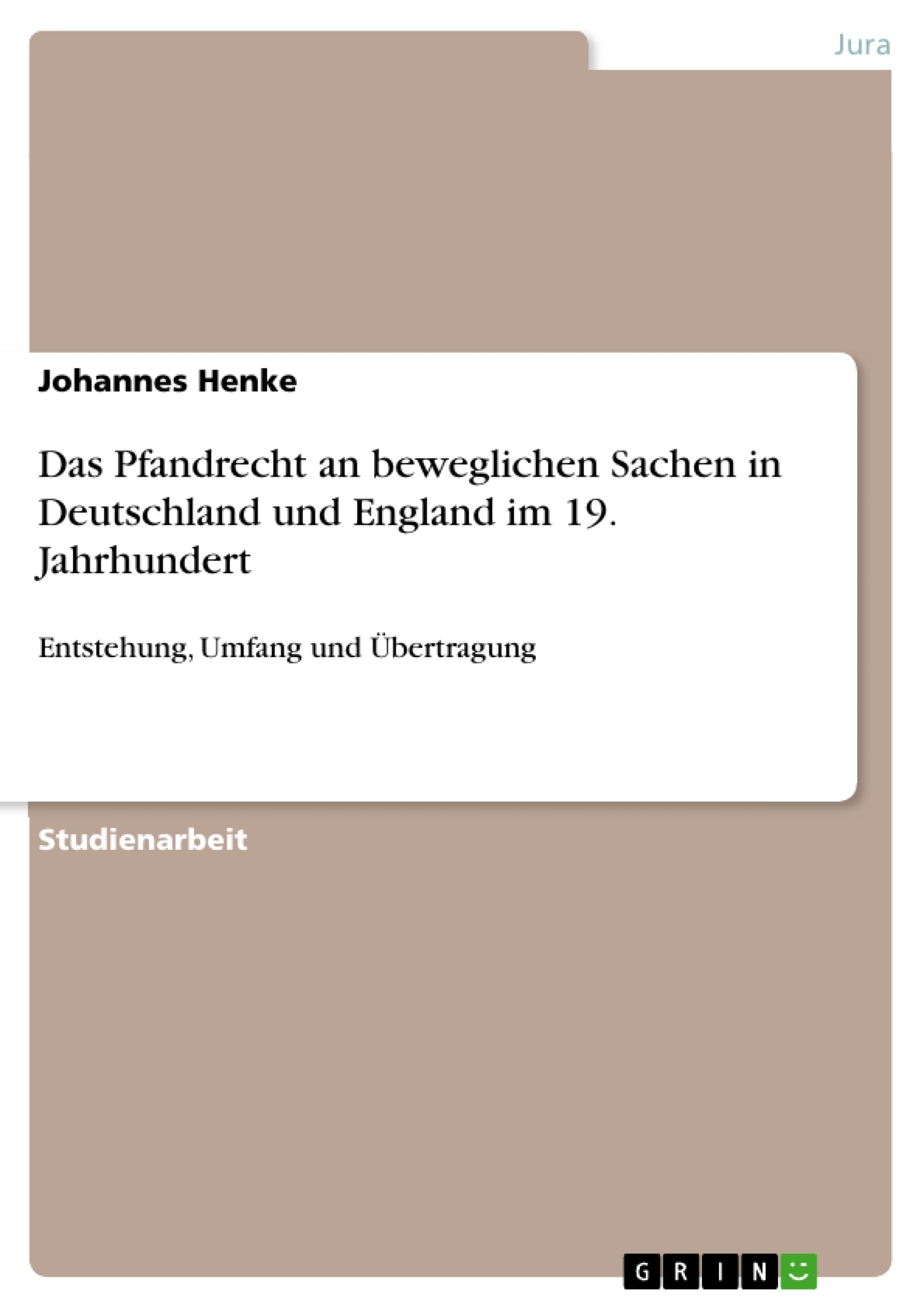Die vorliegende Untersuchung verfolgt eine doppelte Zielrichtung: Zum einen soll die historische Entwicklung des Pfandrechts an beweglichen Sachen in Bezug auf dessen Entstehung, Übertragung und Umfang – ausgehend vom BGB und schwerpunktmäßig im 19. Jahrhundert – nachvollzogen werden. Zum anderen soll eine Gegenüberstellung mit der gegenwärtigen Rechtslage und historischen Entwicklung des Pfandrechts in England stattfinden.
Die Behandlung der deutschen Privatrechtsgeschichte des 19. Jahrhunderts rechtfertigt sich aus dem Umstand, dass die Rechtsinstitute des BGB erst allmählich gewachsen sind.1 Besondere Beachtung verdient des Weiteren die hohe Kontinuität des sachenrechtlichen Pfandrechtsinstituts – im Gegensatz etwa zu den sich rascher wandelnden Institutionen des Schuldrechts. Zudem ist die Bedeutung des Pfandrechts mit Blick auf die praxistauglichere Sicherungsübereignung in seiner Wirtschaftlichkeit zwar eingeschränkt, keinesfalls aber aufgehoben. Dies zeigt etwa der Einsatz bei sog. Lombardgeschäften2 oder gewerblichen Pfandleihen.3 Schließlich war die Pfandrechtskonstruktion im 19. Jahrhundert sehr umstritten. Insbesondere die Entwicklung zu einem Faustpfandrecht und die ungeklärte Wirkungsweise der Akzessorietät verleihen dem Thema einen besonderen Reiz. Das Aufzeigen der geschichtlichen Entwicklung und ein innerdeutscher Rechtsvergleich vertiefen das Verständnis der gegenwärtigen Rechtslage und können für die Auslegung derzeitiger Rechtsnormen sowie für eine Zukunftsprognose von Bedeutung sein.
Der Vergleich mit der Rechtsentwicklung in England ist bereits deshalb angezeigt, weil das englische Pfandrecht im Gegensatz zum deutschen Pfandrecht heute als eine der wichtigsten Mobiliarsicherheiten gilt. Daraus ergibt sich die Frage nach einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Rechtsordnung. Wichtig erscheint des Weiteren die darauf aufbauende Fragestellung, ob bei Gleichartigkeit der zu bewältigenden Ordnungsprobleme trotz unterschiedlicher juristischer Ansatzpunkte gemeinsame materielle Prinzipien oder Lösungsansätze entwickelt werden können. Anders gewendet: Der Rechtsvergleich zielt v.a. auf Verifizierung des Gedankens der praesumptio similitudinis.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Rechtslage nach BGB
- I. Entstehung des Pfandrechts
- 1. Rechtsgeschäftliches Pfandrecht gem. §§ 1204 ff. BGB
- 2. Gesetzliches Pfandrecht gem. § 1257 BGB iVm §§ 1204 ff. BGB
- 3. Pfändungspfandrecht gem. § 804 ZPO
- II. Umfang des Pfandrechts
- III. Übertragung des Pfandrechts
- IV. Schlussfolgerungen
- I. Entstehung des Pfandrechts
- C. Historische Entwicklung des Pfandrechts an beweglichen Sachen unter Berücksichtigung des frühen römischen Rechts, des ius commune und des Deutschen Privatrechts des 19. Jahrhunderts
- I. Frühes römisches Recht
- II. Ius commune
- III. Deutsches Privatrecht im 19. Jahrhundert
- 1. Allgemeines
- 2. Gemeines Recht
- 3. Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis
- 4. Allgemeines Preußisches Landrecht von 1794
- 5. Sächsisches BGB von 1865
- 6. Schlussfolgerungen
- D. Rechtsentwicklung in Großbritannien
- I. Allgemeines
- II. Entstehung des pledge
- III. Umfang des pledge
- IV. Übertragung des pledge
- V. Entwicklung des pledge, v.a. im 19. Jahrhundert
- VI. Schlussfolgerungen
- E. Zusammenfassende Thesen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entstehung, den Umfang und die Übertragung des Pfandrechts an beweglichen Sachen in Deutschland und England im 19. Jahrhundert. Sie verfolgt das Ziel, die historische Entwicklung des Pfandrechts in beiden Rechtsordnungen zu vergleichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen. Dabei werden die jeweiligen gesetzlichen Grundlagen und ihre Auslegung in der Rechtsprechung berücksichtigt.
- Vergleichende Analyse des Pfandrechts in Deutschland und England im 19. Jahrhundert
- Historische Entwicklung des Pfandrechts von römischen Recht bis zum 19. Jahrhundert
- Entstehung des Pfandrechts: Rechtsgeschäfte, gesetzliche Regelungen, Pfändung
- Umfang des Pfandrechts: Rechte und Pflichten des Pfandgläubigers und Pfandgläubigers
- Übertragung des Pfandrechts: Formalitäten und Rechtsfolgen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik des Pfandrechts an beweglichen Sachen ein und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit. Sie umreißt die historische Perspektive und den vergleichenden Charakter der Untersuchung, indem sie die Rechtsordnungen Deutschlands und Englands im 19. Jahrhundert gegenüberstellt. Die Einleitung dient als Orientierungshilfe und begründet die Notwendigkeit einer solchen Untersuchung im Kontext der europäischen Privatrechtsgeschichte.
B. Rechtslage nach BGB: Dieses Kapitel behandelt die Rechtslage des Pfandrechts an beweglichen Sachen nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Es beschreibt detailliert die Entstehung des Pfandrechts durch Rechtsgeschäft, Gesetz und Pfändung, analysiert den Umfang des Pfandrechts, einschließlich der Rechte und Pflichten des Gläubigers und des Schuldners, sowie die Übertragung des Pfandrechts. Der Fokus liegt auf der Systematik des BGB und seiner relevanten Paragraphen.
C. Historische Entwicklung des Pfandrechts an beweglichen Sachen unter Berücksichtigung des frühen römischen Rechts, des ius commune und des Deutschen Privatrechts des 19. Jahrhunderts: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die historische Entwicklung des Pfandrechts, beginnend mit dem frühen römischen Recht, über das ius commune bis hin zum deutschen Privatrecht des 19. Jahrhunderts. Es analysiert verschiedene Rechtsquellen wie das Allgemeine Preußische Landrecht, den Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis und das Sächsische BGB von 1865, um die Entwicklung von Konzepten wie dem Publizitätsprinzip und dem Akzessorietätsprinzip zu beleuchten. Der Vergleich der verschiedenen Rechtsordnungen verdeutlicht die graduelle Entwicklung des modernen Pfandrechts.
D. Rechtsentwicklung in Großbritannien: Dieses Kapitel widmet sich der Entwicklung des Pfandrechts (pledge) in Großbritannien im 19. Jahrhundert. Es untersucht die Entstehung, den Umfang und die Übertragung des pledge und vergleicht diese Aspekte mit der deutschen Rechtsentwicklung. Der Fokus liegt auf der Analyse der englischen Rechtsprechung und der spezifischen Charakteristika des englischen Pfandrechts im Vergleich zum deutschen System. Die Kapitel analysiert auch die Entwicklung des pledge im Laufe des 19. Jahrhunderts und seine Besonderheiten im englischen Rechtssystem.
Schlüsselwörter
Pfandrecht, bewegliche Sachen, Deutschland, England, 19. Jahrhundert, BGB, ius commune, römisches Recht, pledge, Publizitätsprinzip, Akzessorietätsprinzip, Rechtsvergleich, historische Entwicklung, Rechtsgeschichte, Europäisches Privatrecht.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Rechtsvergleichende Untersuchung des Pfandrechts an beweglichen Sachen in Deutschland und England im 19. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht vergleichend die Entstehung, den Umfang und die Übertragung des Pfandrechts an beweglichen Sachen in Deutschland und England im 19. Jahrhundert. Sie analysiert die historische Entwicklung des Pfandrechts in beiden Rechtsordnungen und hebt Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervor.
Welche Rechtsordnungen werden verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf die Rechtsordnungen Deutschlands und Englands im 19. Jahrhundert. Die Arbeit analysiert die jeweiligen gesetzlichen Grundlagen und deren Auslegung in der Rechtsprechung.
Welche historischen Entwicklungsstufen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Entwicklung des Pfandrechts vom frühen römischen Recht über das ius commune bis hin zum deutschen Privatrecht des 19. Jahrhunderts und dem englischen Rechtssystem dieser Zeit. Spezifische Rechtsquellen wie das Allgemeine Preußische Landrecht, der Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis und das Sächsische BGB von 1865 (Deutschland) werden ebenso untersucht wie die Entwicklung des "pledge" in England.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Rechtslage nach BGB, Historische Entwicklung des Pfandrechts (mit Fokus auf römisches Recht, ius commune und deutsches Privatrecht des 19. Jahrhunderts), Rechtsentwicklung in Großbritannien und eine zusammenfassende Darstellung der Thesen. Jedes Kapitel analysiert Aspekte der Entstehung, des Umfangs und der Übertragung des Pfandrechts.
Welche Aspekte des Pfandrechts werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt detailliert die Entstehung des Pfandrechts (durch Rechtsgeschäft, Gesetz und Pfändung), den Umfang des Pfandrechts (Rechte und Pflichten des Gläubigers und Schuldners) und die Übertragung des Pfandrechts (Formalitäten und Rechtsfolgen) in beiden Rechtsordnungen.
Welche Schlüsselkonzepte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Schlüsselkonzepte wie das Publizitätsprinzip und das Akzessorietätsprinzip im Kontext der historischen Entwicklung des Pfandrechts. Der Vergleich der verschiedenen Rechtsordnungen soll die graduelle Entwicklung des modernen Pfandrechts verdeutlichen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Rechtsquellen, einschließlich des BGB, des Allgemeinen Preußischen Landrechts, des Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis, des Sächsischen BGB von 1865, sowie auf englische Rechtsquellen und die jeweilige Rechtsprechung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die historische Entwicklung des Pfandrechts in Deutschland und England im 19. Jahrhundert zu vergleichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen. Sie dient dem Verständnis der europäischen Privatrechtsgeschichte und der Entwicklung des modernen Pfandrechts.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Pfandrecht, bewegliche Sachen, Deutschland, England, 19. Jahrhundert, BGB, ius commune, römisches Recht, pledge, Publizitätsprinzip, Akzessorietätsprinzip, Rechtsvergleich, historische Entwicklung, Rechtsgeschichte, Europäisches Privatrecht.
- Quote paper
- Johannes Henke (Author), 2007, Das Pfandrecht an beweglichen Sachen in Deutschland und England im 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80566