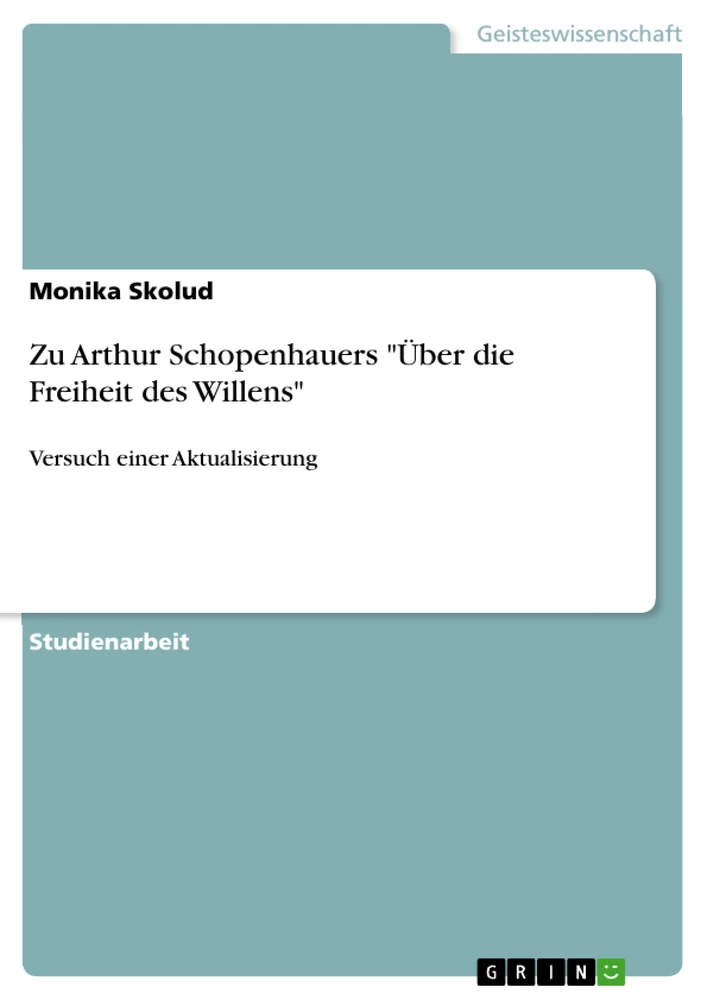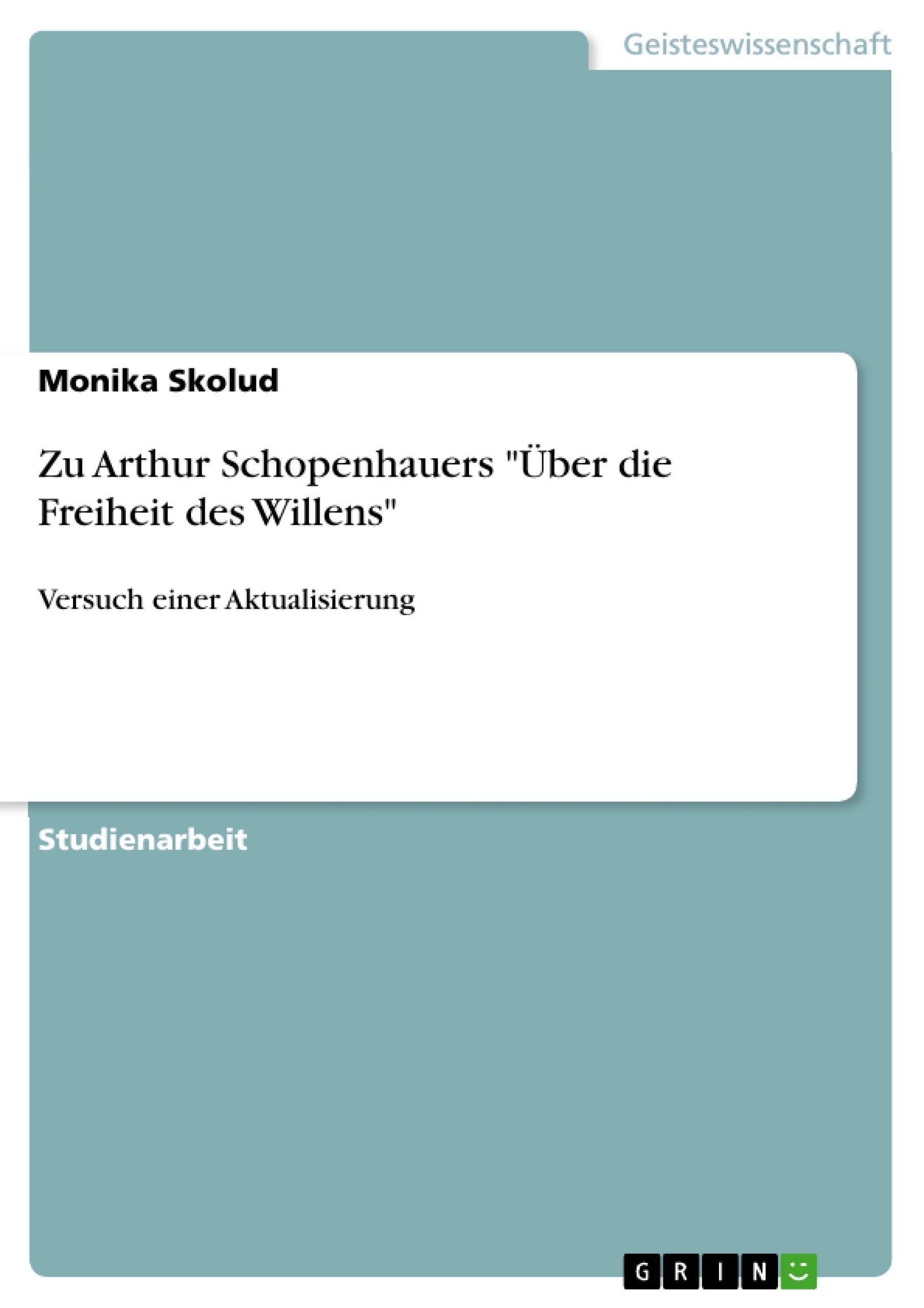Arthur Schopenhauer führt in seiner >Preisschrift: Über die Freiheit des Willens< aus, dass die Handlungen der Menschen nicht frei sind. Menschen mögen sich für frei halten und annehmen, dass sie ihr Leben in jedem Augenblick ändern können, letztlich müssen sie erschreckend erkennen, dass der Mensch
„...nicht frei ist, sondern der Notwendigkeit unterworfen, daß er [...] sein Tun nicht ändert, und vom Anfang seines Lebens bis zum Ende denselben von ihm selbst mißbilligten Charakter durchführen und gleichsam die übernommene Rolle bis zu Ende spielen muß.“
Für Schopenhauer gehören die Menschen als physische Wesen zur Welt der Erscheinungen. Sie sind an die Formen der Erscheinung und damit an Zeit, Raum und Kausalität gebunden. Schopenhauer resümiert, dass die Freiheit im Sein liegen muss, da sie im Handeln nicht aufzufinden ist.
„Es kommt alles darauf an, was einer ist: was er thut, wird sich daraus von selbst ergeben...“
Die Schopenhauer`sche Argumentation der Freiheitsproblematik basiert vor allem auf drei Darlegungen: Erstens der Kausalität, zweitens der unaufhebbaren Grenze zwischen Erscheinung und dem Willen und drittens dem angeborenen und unveränder-lichen Charakter.
Diese Arbeit leistet eine kritische Auseinandersetzung mit der Problematik der Willensfreiheit im Hinblick auf aktuelle Diskurse. Die angestrebte Aktualisierung führt im ersten Gedanken, auf der Grundlage der Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft, von der Kausalität zur Wahrscheinlichkeit. Es folgen Überlegungen zum Zusammenhang der Willensfreiheit mit ethischen Fragen, insbesondere die Frage nach der Verantwortlichkeit der Menschen für ihre Taten wird in diesem Kontext erörtert. Im Anschluss an die Kriterien für verantwortliches Handeln wird die Vermutung einer Traditionslinie des Unbewussten erörtert. Hier wird die Hypothese diskutiert, ob das Unbewusste bei Sigmund Freud dem Willen bei Arthur Schopenhauer entspricht. Der vierte und letzte aktuelle Diskurs, der in dieser Untersuchung verhandelt wird, geht der Frage nach der Möglichkeit der Veränderung des menschlichen Charakters durch Einsicht nach.
Die Analyse und die aus ihr gewonnenen Ergebnisse führen zu der Auffassung, dass den Menschen Willensfreiheit und Handlungsfreiheit zuzusprechen ist. Diese Freiheit ist die beängstigende Erkenntnis, dass unser Handeln nicht vorbestimmte ist, dass wir es sind, die mit allen unseren Handlungen, mit jeder Geste und allem was wir sagen unser Leben selbst bestimmen.
Inhaltsverzeichnis
- Arthur Schopenhauer: Über die Freiheit des Willens
- Begriffsbestimmungen
- Was heißt Freiheit?
- Was heißt Selbstbewusstsein?
- Der Wille vor dem Selbstbewusstsein
- Motiv und Reaktion
- Wille und Wollen
- Der Wille vor dem Bewusstsein anderer Dinge
- Kausalität und Notwendigkeit
- Der Charakter der Menschen
- Schluss und höhere Ansicht
- Verantwortlichkeit und Zurechnungsfähigkeit
- Begriffsbestimmungen
- Versuch einer Aktualisierung: Über die Freiheit des Willens
- Kausalität und Willensfreiheit
- Von der Kausalität zur Wahrscheinlichkeit
- Willensfreiheit und Verantwortlichkeit
- Der Charakter der Menschen
- Der Wille und das Unbewusste
- Veränderung des Charakters durch Einsicht
- Kausalität und Willensfreiheit
- Schluss
- Zusammenfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht Arthur Schopenhauers Argumentation zur Willensfreiheit, wie sie in seiner >Preisschrift: Über die Freiheit des Willens< dargestellt wird. Sie analysiert Schopenhauers Position und setzt sie in Bezug zu aktuellen Diskursen, um die Problematik der Willensfreiheit im Kontext moderner wissenschaftlicher und philosophischer Erkenntnisse zu betrachten. Ziel ist es, die Argumentation Schopenhauers in die heutige Zeit zu übertragen und deren Relevanz zu bewerten.
- Die Bedeutung der Kausalität für die Willensfreiheit
- Der Zusammenhang zwischen dem Willen, dem Charakter und der Verantwortlichkeit
- Die Rolle des Unbewussten in der Frage der Willensfreiheit
- Die Möglichkeit der Veränderung des menschlichen Charakters durch Einsicht
- Die Aktualität der Schopenhauer`schen Argumentation im Hinblick auf aktuelle Diskurse
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit analysiert Schopenhauers >Preisschrift: Über die Freiheit des Willens<. Dabei wird die Schopenhauer`sche Argumentation zur Freiheitsproblematik und die zentralen Begrifflichkeiten entwickelt. Es werden die drei zentralen Argumente Schopenhauers beleuchtet: die Kausalität, die unaufhebbare Grenze zwischen Erscheinung und dem Willen und der angeborene und unveränderliche Charakter.
Das zweite Kapitel widmet sich einer kritischen Auseinandersetzung mit der Problematik der Willensfreiheit im Hinblick auf aktuelle Diskurse. Es werden die Überlegungen Schopenhauers zur Kausalität im Lichte der modernen Naturwissenschaft, der Zusammenhang von Willensfreiheit und ethischen Fragen und die Rolle des Unbewussten in der Frage der Willensfreiheit beleuchtet. Das Kapitel diskutiert außerdem, ob der menschliche Charakter durch Einsicht verändert werden kann.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter für diese Arbeit sind: Willensfreiheit, Kausalität, Determinismus, Charakter, Verantwortlichkeit, Unbewusstes, Schopenhauer, Aktualisierung, Freiheitsproblematik, ethische Fragen.
- Quote paper
- Monika Skolud (Author), 2006, Zu Arthur Schopenhauers "Über die Freiheit des Willens", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80400