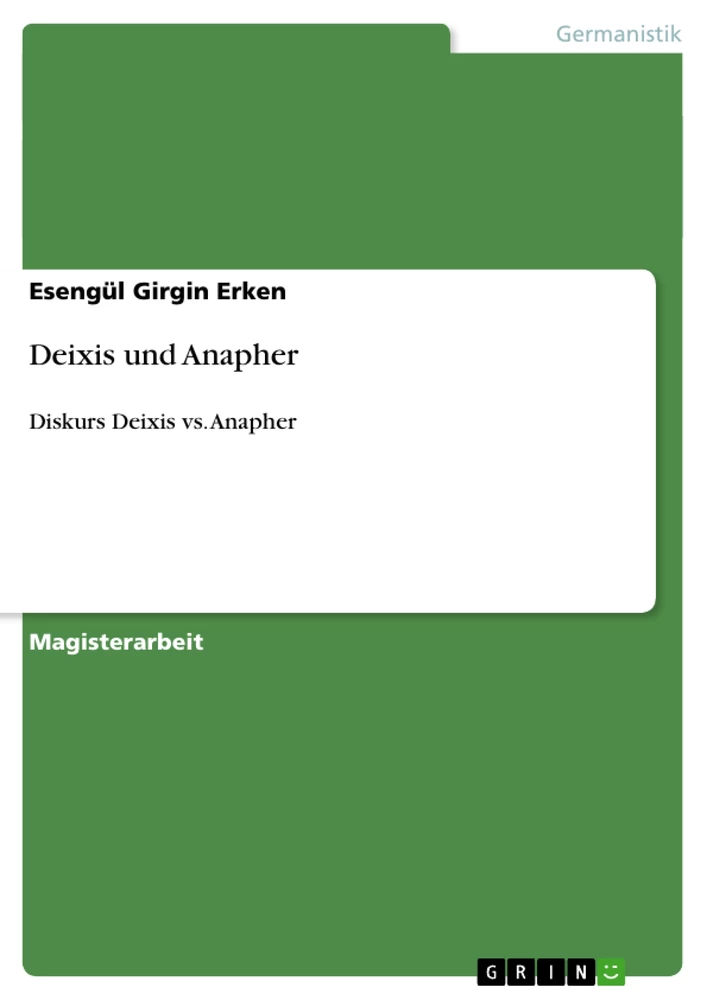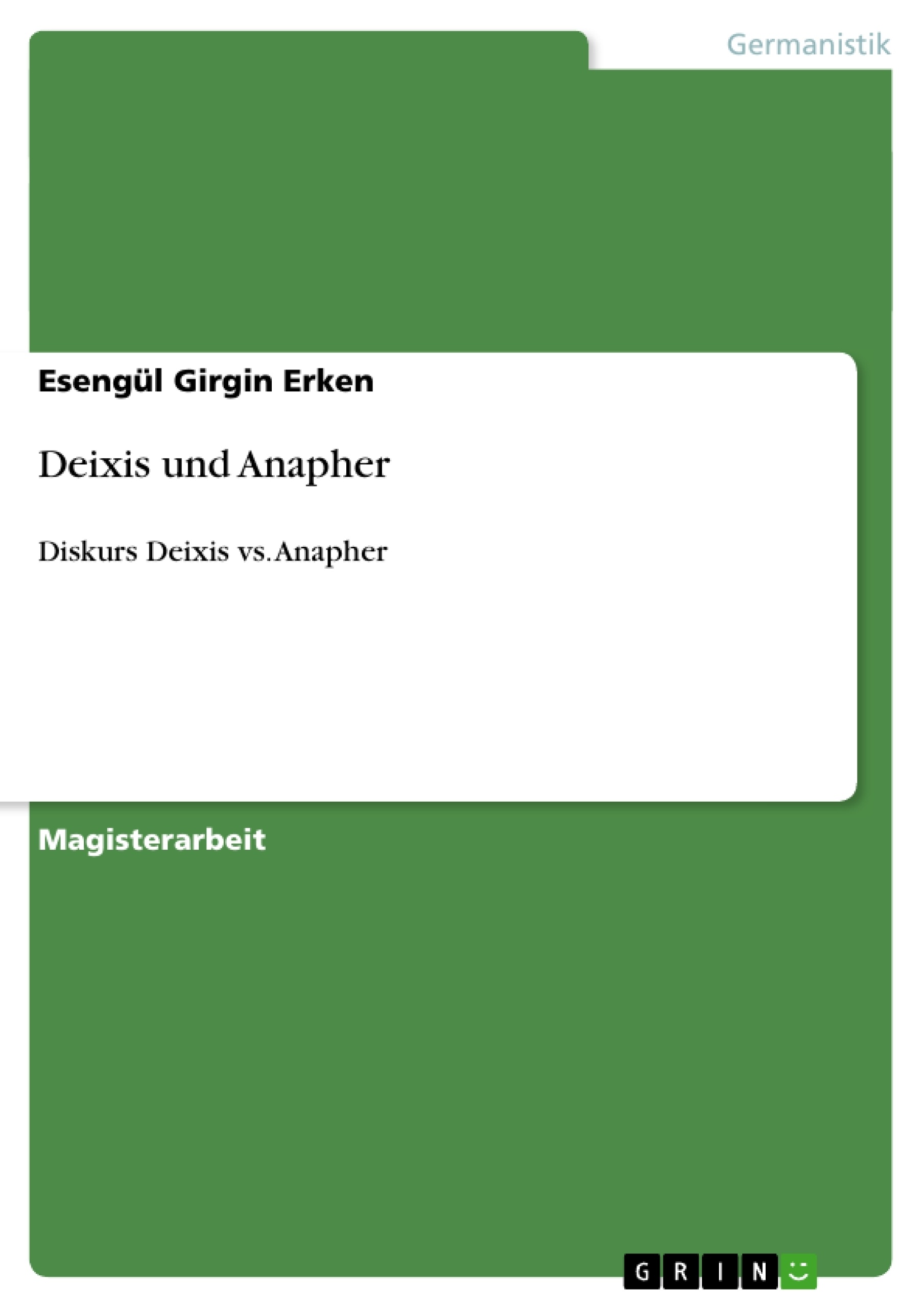Die Ausdrucksbedeutung von anaphorischen und deiktischen Ausdrücken, setzen durch einen Bezug auf den unmittelbaren Äußerungskontext eine spezifische Referenz dieser Ausdrücke voraus, die Sprachwissenschaftler und Philosophen bereits seit der Antike beschäftigt.
Gegenstand der Arbeit ist die dem Autor bzw. Sprecher sowohl beim mündlichen als auch beim schriftlichen Erzählen permanent zur Verfügung stehende eminente Sprachmittel Deixis und Anapher anhand der Fachliteratur und der anaphorischen und deiktischen Ausdrücke, die die Sprachphänomene repräsentieren, zu untersuchen und eine klare Grenze zwischen den beiden Termini zu ziehen.
Die Problematik, die diesen sprachlichen Phänomenen innewohnt, ist die Tatsache, dass die Begriffe der linguistischen Forschung entweder unklar abgegrenzt oder als Ganzes interpretiert wurden. Obwohl bis zur Gegenwart die Abgrenzung sowie das Dazuzählen der Anapher zur Deixis anhand Bühlers Darlegungen mehrmalig erforscht und diskutiert worden sind, wurden sie bis heute noch nicht völlig statuiert.
Sowohl Referenz, die im Rahmen der Deixis- und Anapherforschung ein untrennbarer Begriff ist, als auch das ausschlaggebende Bühlersche Konzept, bilden die Grundlagen der Deixis und Anapher.
Ferner werden die Begriffe Referenz und Koreferenz beschrieben. Um die nebulöse Darstellung zwischen Koreferenz und Anaphorika zu entschärfen, wird auf die sprachwissenschaftlichen Theorien eingegangen und koreferentielle Ausdrücke den anaphorischen Ausdrücken gegenübergestellt.
Da der Ausgangspunkt dieser Arbeit den Begriff der Anapher von der Deixis exakt sondert, wird die sprachliche Erfassung Anapher anhand einiger Beispiele von Deixis bzw. der Diskursdeixis abgegrenzt. Dabei wird in Anlehnung an Schwarz (2000) neben der gewöhnlichen Anaphorika, das textuelle Phänomen der indirekten Anapher, die als eine klar abgrenzende sprachliche Erscheinung zwischen der Diskursdeixis und Anapher bezeichnet werden kann, gegenüberstellend beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der deiktischen und anaphorischen Analyse
- Referenzbegriff
- Bedeutung und Sinn
- Die Identifizierbarkeit des Referenten
- Referenzbereiche
- Aspekte der Referenz
- Deixis und Koreferenz
- Anaphorik und Koreferenz
- Deiktische und anaphorische Referenz
- Deiktische Referenz
- Anaphorische Referenz
- Das allgemeine sprachtheoretische Konzept Bühlers und das Organon - Modell
- Nennwörter und Zeigwörter
- Nennwörter
- Zeigwörter
- Modi des Zeigens
- Deixis
- Definition der Deixis
- Die Grundstruktur des deiktischen Systems
- Deiktische Ausdrücke
- Kategorien der Deixis
- Lokaldeixis
- Lokaldeiktische Ausdrücke
- Kategorisierung der Lokaldeixis
- Proximale Lokaldeixis
- Distale Lokaldeixis
- Beispiele für proximale und distale Lokaldeixis
- Subkategorisierung der Lokaldeixis
- Analogische Lokaldeixis
- Temporaldeixis
- Definition der Temporaldeixis
- Subkategorisierung der Temporaldeixis
- Vergangenheits- und zukunftsbezogene Temporaldeixis
- Personaldeixis
- Sozialdeixis
- Anredeformen und ihre Verwendung im Deutschen
- Diskursdeixis
- Theoretischer Rahmen und die Definition der Diskursdeixis
- Beispiele für Diskursdeixis
- Anapher
- Definition der Anapher
- Diskursdeixis vs. Anapher
- Kategorien der Anapher
- Syntaktische Anapher
- Semantische Anapher
- Pragmatische Anapher
- Der bestimmte Artikel in anaphorischer Funktion
- Anapher im Diskurs
- Indirekte Anapher
- Ausdrucksmittel der Anapher/Katapher
- Katapher
- Kataphorika
- Kategorien der Katapher
- Zusammenfassung und Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die sprachlichen Phänomene Deixis und Anapher, ihre Abgrenzung und ihre Bedeutung für die Interpretation von Äußerungen. Ziel ist es, ein klares Verständnis der beiden Konzepte zu entwickeln und die bestehenden Unschärfen in der linguistischen Forschung zu beheben. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Kategorien und Ausdrucksmittel beider Phänomene im Detail.
- Abgrenzung von Deixis und Anapher
- Kategorisierung deiktischer Ausdrücke (lokal, temporal, personal, sozial, diskursiv)
- Kategorisierung anaphorischer Ausdrücke (syntaktisch, semantisch, pragmatisch)
- Das Bühlersche Organon-Modell im Kontext von Deixis und Anapher
- Analyse von Referenz und Koreferenz
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Magisterarbeit ein, die sich mit den sprachlichen Phänomenen Deixis und Anapher auseinandersetzt. Sie hebt die Bedeutung dieser Konzepte für das Verständnis von Äußerungsbedeutungen hervor und benennt die Forschungslücke, die die Arbeit zu schließen versucht: die ungenaue Abgrenzung zwischen Deixis und Anapher in der bestehenden Literatur. Die Arbeit soll durch eine systematische Untersuchung der relevanten Fachliteratur und eine Analyse der sprachlichen Ausdrucksmittel eine klare Unterscheidung zwischen den beiden Termini liefern.
Grundlagen der deiktischen und anaphorischen Analyse: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse von Deixis und Anapher. Es definiert den Referenzbegriff, untersucht die Identifizierbarkeit des Referenten und beleuchtet verschiedene Aspekte der Referenz, darunter Deixis und Koreferenz, Anaphorik und Koreferenz sowie die spezifischen Eigenschaften deiktischer und anaphorischer Referenz. Besonderes Augenmerk liegt auf dem allgemeinen sprachtheoretischen Konzept Bühlers und dem Organon-Modell, um die funktionale Rolle von Nenn- und Zeigwörtern zu verstehen.
Deixis: Dieses Kapitel widmet sich umfassend dem Phänomen der Deixis. Nach einer präzisen Definition werden die Grundstruktur des deiktischen Systems, deiktische Ausdrücke und ihre verschiedenen Kategorien (Lokaldeixis, Temporaldeixis, Personaldeixis, Sozialdeixis und Diskursdeixis) detailliert analysiert und anhand von Beispielen illustriert. Die Subkategorisierungen innerhalb der einzelnen Deixis-Typen werden ebenso behandelt wie die unterschiedlichen Ausdrucksmittel.
Anapher: Das Kapitel über Anapher definiert den Begriff und grenzt ihn explizit von der Deixis ab. Es werden verschiedene Kategorien der Anapher – syntaktische, semantische und pragmatische – untersucht und anhand von Beispielen erläutert. Der besondere Fokus liegt auf der anaphorischen Funktion des bestimmten Artikels im Diskurs sowie auf indirekter Anapher und den Ausdrucksmitteln von Anapher und Katapher.
Schlüsselwörter
Deixis, Anapher, Referenz, Koreferenz, Lokaldeixis, Temporaldeixis, Personaldeixis, Sozialdeixis, Diskursdeixis, syntaktische Anapher, semantische Anapher, pragmatische Anapher, Katapher, Bühlers Organon-Modell, Sprachtheorie, Pragmatik, Semantik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Deixis und Anapher
Was ist der Gegenstand der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit befasst sich mit den sprachlichen Phänomenen Deixis und Anapher. Sie untersucht ihre Definitionen, Abgrenzungen und Bedeutung für die Interpretation von Äußerungen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Klärung von Unschärfen in der bestehenden linguistischen Forschung zur Unterscheidung beider Konzepte.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein klares Verständnis von Deixis und Anapher zu entwickeln. Sie analysiert die verschiedenen Kategorien und Ausdrucksmittel beider Phänomene im Detail und versucht, eine präzise Abgrenzung zwischen diesen beiden Termini zu liefern. Die Arbeit nutzt dazu eine systematische Untersuchung relevanter Fachliteratur und eine Analyse sprachlicher Ausdrucksmittel.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Abgrenzung von Deixis und Anapher, die Kategorisierung deiktischer Ausdrücke (lokal, temporal, personal, sozial, diskursiv), die Kategorisierung anaphorischer Ausdrücke (syntaktisch, semantisch, pragmatisch), das Bühlersche Organon-Modell im Kontext von Deixis und Anapher sowie die Analyse von Referenz und Koreferenz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundlagen der deiktischen und anaphorischen Analyse, ein Kapitel zu Deixis mit detaillierter Betrachtung der verschiedenen Deixis-Typen, ein Kapitel zu Anapher mit Fokus auf deren Kategorien und Abgrenzung zur Deixis, und abschließend eine Zusammenfassung und ein Schlusswort.
Was sind die zentralen Aspekte der Grundlagen-Kapitel?
Das Kapitel zu den Grundlagen definiert den Referenzbegriff, untersucht die Identifizierbarkeit des Referenten und beleuchtet Aspekte der Referenz wie Deixis und Koreferenz, Anaphorik und Koreferenz sowie deiktische und anaphorische Referenz. Es integriert das Bühlersche Organon-Modell, um die Funktion von Nenn- und Zeigwörtern zu verstehen.
Wie wird Deixis in der Arbeit behandelt?
Das Deixis-Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der verschiedenen Deixis-Kategorien: Lokaldeixis (inkl. proximaler, distaler und analogischer Deixis), Temporaldeixis, Personaldeixis, Sozialdeixis und Diskursdeixis. Es werden Definitionen, die Grundstruktur des deiktischen Systems und relevante Ausdrucksmittel untersucht.
Wie wird Anapher in der Arbeit behandelt?
Das Anapher-Kapitel definiert den Begriff, grenzt ihn von Deixis ab und untersucht verschiedene Kategorien: syntaktische, semantische und pragmatische Anapher. Es analysiert die anaphorische Funktion des bestimmten Artikels, indirekte Anapher, die Ausdrucksmittel der Anapher und der Katapher (inkl. Kataphorika und Kategorien der Katapher).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deixis, Anapher, Referenz, Koreferenz, Lokaldeixis, Temporaldeixis, Personaldeixis, Sozialdeixis, Diskursdeixis, syntaktische Anapher, semantische Anapher, pragmatische Anapher, Katapher, Bühlers Organon-Modell, Sprachtheorie, Pragmatik, Semantik.
- Quote paper
- M.A. Esengül Girgin Erken (Author), 2007, Deixis und Anapher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80047