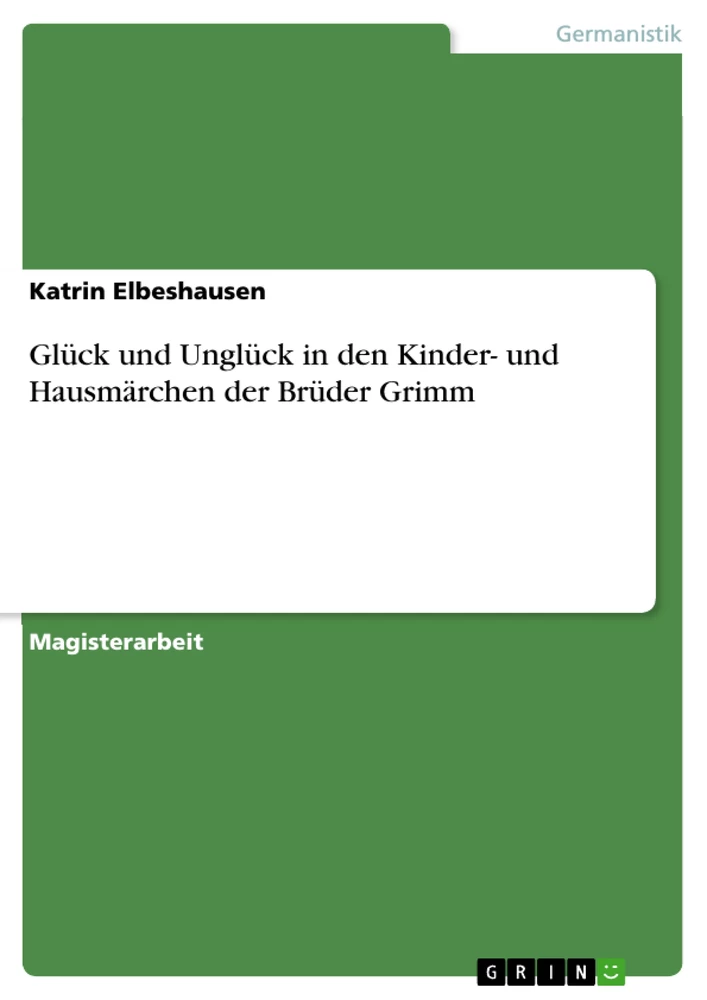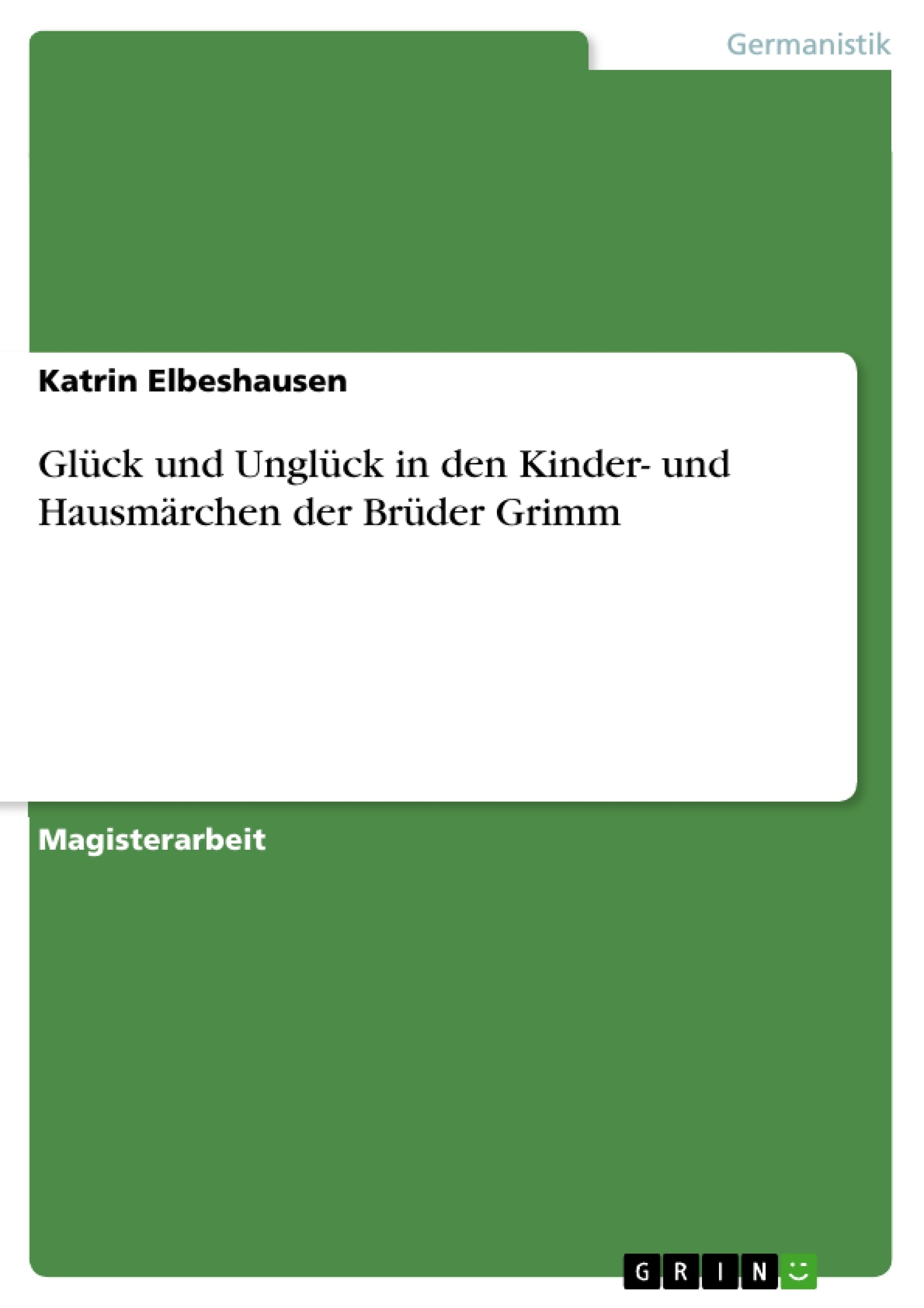Die Grund- oder Ausgangsfrage, auf der diese Arbeit aufbaut, lautet: In welcher Relation und auf welche Weise wird Glück oder Unglück in den Kinder- und Hausmärchen ausgedrückt und vom Rezipienten wahrgenommen?
Auf der Basis dieser Kernfrage lassen sich sechs Thesen für die Untersuchung formulieren, die es zu belegen oder widerlegen gilt:
These 1: Die Kinder- und Hausmärchen besitzen überwiegend gute Ausgänge und weisen bezüglich dieser eindeutig bevorzugte Themen auf.
These 2: Es existiert eine Symbiose und Wechselwirkung von Glück und Unglück: sie bedingen sich gegenseitig.
These 3: Es gibt konkrete Motive und Symbole, die den Handlungsablauf, auch im Hinblick auf ein gutes oder schlechtes Ende, einer Geschichte beeinflussen oder bestimmen.
These 4: Die Grimmschen Volksmärchen leben von der Kontrastierung, vergleichbar mit der Antithetik in der Lyrik des Barock. In der Dialektik von Gut und Böse, Tugend und Laster oder auch Diesseits und Jenseits besteht die Spannung der Erzählungen. Durch diese Gegensätzlichkeiten werden eine Moral und Werte vermittelt, die zugleich eine Glücksphilosophie bilden.
These 5: Die Glücks- und Wertevermittlung stimmt mit den bürgerlichen Idealen der Entstehungszeit der Sammlung überein.
These 6: Die Glücks- und Wertevermittlung stimmt mit dem heutigen Verständnis von dem, was im Leben (un-)wichtig ist und (un-)glücklich macht, überein. Dies erklärt zugleich, warum der Bekanntheitsgrad der Märchen nach fast 200 Jahren immer noch erhalten geblieben ist.
Eine typologische Einteilung von Märchen kann unter Berücksichtigung unterschiedlichster Kriterien (z. B. formal, stofflich, thematisch, funktional oder nach Herkunft) zustande kommen, so dass bis heute keine allgemeingültige Einteilung existiert. Für diese Untersuchung wird primär zwischen drei bekannten Gattungshaupttypen differenziert: dem klassischen Zaubermärchen, oft auch als ‚eigentliches’ Märchen bezeichnet, dem Schwank und dem Schwankmärchen. Innerhalb der Analyse wird immer auch hinsichtlich dieser drei Typen ein möglicher Unterschied in ihrer Darstellung von Glück und Unglück berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Ausgabe letzter Hand als Gegenstand der Analyse
- Vermittlung der Lebensziele in den Kinder- und Hausmärchen
- Zum Ausgang der 200 Volksmärchen
- Diskussion des Ergebnisses
- Zu den Märchen mit unglücklichen Ausgängen
- Auswahl konkreter Märchen zur Analyse
- Aschenputtel (KHM 21)
- Die Charaktere und ihre Bedeutung für den Verlauf der Geschichte
- Die Symbole und wie sie zum Glück beitragen
- Worin liegt das Glück Aschenputtels?
- Das „Aschenputtel“ als ein Märchen der Aufklärung
- Hans im Glück (KHM 83)
- Zum Weg des naiven Helden
- Glück in der Besitzlosigkeit
- Der Teufel mit den drei goldenen Haaren (KHM 29)
- Zur Herkunft des Märchens
- Schwankmärchen oder Zaubermärchen?
- Zum formalen Aufbau der Erzählung
- Zur Symbolik und Motivik des Märchens
- Motive und ihr Einfluss auf Glück oder Unglück
- Die Rolle des Schicksals
- Formen und Mittel des Schicksals
- Handlung und Einfluss des Märchenhelden
- Die Figur des Helfers
- Das Wunder oder der Zauber
- Religion und Gott
- Gott als überirdische Macht
- Der personifizierte Gott
- Jenseitserfahrungen und Tod
- Formen und Gestalten des Todes in den Kinder- und Hausmärchen
- Der märchenhafte Tod
- Der reale und ewige Tod
- Der personifizierte Tod
- Der Tod als Unglücksbringer?
- Anwendung und Formen der Todesstrafe
- Zur Rechtfertigung von Grausamkeit
- Zu Macht und Einfluss des Todes
- Die Wertevermittlung und ihr Bezug zum gesellschaftlichen Leben im 19. Jahrhundert
- Romantisches Denken in den Kinder- und Hausmärchen
- Einflüsse der Epoche des Biedermeiers
- Zur Aktualität der Glücks- und Moralvorstellungen Grimmscher Volksmärchen
- Das Märchen und die Moderne
- Die Lehren der Grimmschen Volksmärchen heute
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Glück und Unglück in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Das zentrale Ziel ist die Analyse der Beziehung zwischen Glück und Unglück und deren Wahrnehmung durch den Rezipienten. Dabei werden die unterschiedlichen Märchentypen berücksichtigt und die moralische Bewertung der Lebensziele der Figuren untersucht.
- Die Häufigkeit und Darstellung positiver Ausgänge in den Märchen.
- Die Wechselwirkung und Symbiose von Glück und Unglück.
- Die Rolle von Motiven wie Schicksal, Wunder und Religion in der Gestaltung von Glück und Unglück.
- Die Wertevermittlung der Märchen im Kontext des 19. Jahrhunderts.
- Die Aktualität der Glücks- und Moralvorstellungen der Grimmschen Märchen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Darstellung und Wahrnehmung von Glück und Unglück in den Grimmschen Märchen. Sie führt in die Thematik ein, indem sie die typischen Schlussformeln der Märchen ("...und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch") als Ausgangspunkt nimmt und die Frage nach der Definition von Glück im Kontext der Märchen aufwirft. Es wird auf die Vielschichtigkeit der menschlichen Werte hingewiesen und die Bedeutung der moralischen Bewertung der Lebensziele der Figuren betont. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz, der sich auf die Analyse der Handlungsverläufe und insbesondere der Ausgänge der Märchen konzentriert und unterschiedliche Märchentypen berücksichtigt.
Zur Ausgabe letzter Hand als Gegenstand der Analyse: Dieses Kapitel dürfte eine methodische Auseinandersetzung mit der verwendeten Ausgabe der Grimmschen Märchen sein, erläutert den gewählten Textkorpus und begründet dessen Auswahl für die vorliegende Untersuchung. Der Fokus liegt wahrscheinlich auf der Begründung der Relevanz dieser spezifischen Ausgabe für die Analyse von Glück und Unglück in den Erzählungen.
Vermittlung der Lebensziele in den Kinder- und Hausmärchen: Dieses Kapitel analysiert wahrscheinlich die verschiedenen Wege, wie die Märchen Lebensziele vermitteln. Es wird wahrscheinlich die Ausgänge der Märchen kategorisieren (glücklich, unglücklich, ambivalent) und diskutieren, wie diese Ausgänge mit den Handlungen und Charaktereigenschaften der Figuren zusammenhängen. Die Analyse umfasst vermutlich eine statistische Betrachtung der Ausgänge sowie eine qualitative Interpretation der Ergebnisse.
Auswahl konkreter Märchen zur Analyse: In diesem Kapitel werden exemplarisch ausgewählte Märchen detailliert analysiert, um die Thesen der Arbeit zu untermauern. Die Auswahl der Märchen (Aschenputtel, Hans im Glück, Der Teufel mit den drei goldenen Haaren) deutet auf eine vergleichende Analyse unterschiedlicher Märchentypen hin. Jede Analyse wird wahrscheinlich die Charaktere, Symbole, und die spezifische Art der Darstellung von Glück und Unglück untersuchen.
Motive und ihr Einfluss auf Glück oder Unglück: Dieses Kapitel analysiert verschiedene wiederkehrende Motive in den Märchen und deren Einfluss auf das jeweilige Schicksal der Figuren. Es geht wahrscheinlich um Motive wie Schicksal, Wunder, Religion und Tod, und wie diese Elemente die Erzählungen strukturieren und die Darstellung von Glück und Unglück beeinflussen. Die Analyse wird vermutlich die unterschiedlichen Formen und Ausprägungen dieser Motive in den verschiedenen Märchen untersuchen.
Die Wertevermittlung und ihr Bezug zum gesellschaftlichen Leben im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel setzt die in den Märchen präsentierten Werte in den Kontext des 19. Jahrhunderts. Es wird wahrscheinlich Einflüsse romantischen Denkens und des Biedermeiers auf die moralischen Botschaften der Märchen beleuchten. Die Analyse wird vermutlich die gesellschaftlichen Normen und Werte der Zeit untersuchen und deren Spiegelung in den Märchen aufzeigen.
Zur Aktualität der Glücks- und Moralvorstellungen Grimmscher Volksmärchen: Dieses Kapitel untersucht die Relevanz der Grimmschen Märchen für die Gegenwart. Es wird wahrscheinlich eine Auseinandersetzung mit der Frage stattfinden, ob und inwiefern die in den Märchen vermittelten Glücks- und Moralvorstellungen auch heute noch aktuell und bedeutsam sind. Eine Betrachtung der Adaptionen und Rezeption der Märchen in der Moderne dürfte Bestandteil dieses Kapitels sein.
Schlüsselwörter
Kinder- und Hausmärchen, Brüder Grimm, Glück, Unglück, Moral, Wertevermittlung, Märchentypen (Zaubermärchen, Schwank, Schwankmärchen), Schicksal, Wunder, Religion, Tod, 19. Jahrhundert, Romantismus, Biedermeier, Aktualität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Glück und Unglück in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Glück und Unglück in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Der Fokus liegt auf der Beziehung zwischen Glück und Unglück und deren Wahrnehmung durch den Leser, unter Berücksichtigung verschiedener Märchentypen und der moralischen Bewertung der Lebensziele der Figuren.
Welche Aspekte werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Häufigkeit und Darstellung positiver Ausgänge, die Wechselwirkung von Glück und Unglück, die Rolle von Motiven wie Schicksal, Wunder und Religion, die Wertevermittlung im Kontext des 19. Jahrhunderts und die Aktualität der Glücks- und Moralvorstellungen der Grimmschen Märchen.
Welche Märchen werden genauer untersucht?
Die Arbeit analysiert exemplarisch "Aschenputtel" (KHM 21), "Hans im Glück" (KHM 83) und "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" (KHM 29), um die gefundenen Thesen zu untermauern und verschiedene Märchentypen zu vergleichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, der methodischen Auseinandersetzung mit der verwendeten Ausgabe, der Vermittlung von Lebenszielen in den Märchen, der detaillierten Analyse ausgewählter Märchen, dem Einfluss von Motiven auf Glück und Unglück, der Wertevermittlung im 19. Jahrhundert und der Aktualität der Märchen für die Gegenwart.
Welche Motive spielen eine zentrale Rolle?
Wichtige Motive sind Schicksal, Wunder, Religion und Tod. Die Analyse untersucht deren unterschiedliche Formen und Ausprägungen und ihren Einfluss auf die Gestaltung von Glück und Unglück in den Erzählungen.
Welchen gesellschaftlichen Kontext berücksichtigt die Arbeit?
Die Arbeit betrachtet die Wertevermittlung der Märchen im Kontext des 19. Jahrhunderts, unter Berücksichtigung von Einflüssen des Romantischen Denkens und des Biedermeiers.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Aktualität der in den Grimmschen Märchen vermittelten Glücks- und Moralvorstellungen und befasst sich mit deren Relevanz für die heutige Zeit. Sie betrachtet auch die Adaptionen und Rezeption der Märchen in der Moderne.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Kinder- und Hausmärchen, Brüder Grimm, Glück, Unglück, Moral, Wertevermittlung, Märchentypen (Zaubermärchen, Schwank, Schwankmärchen), Schicksal, Wunder, Religion, Tod, 19. Jahrhundert, Romantismus, Biedermeier, Aktualität.
Wie ist der methodische Ansatz der Arbeit?
Der methodische Ansatz konzentriert sich auf die Analyse der Handlungsverläufe und insbesondere der Ausgänge der Märchen. Er berücksichtigt unterschiedliche Märchentypen und umfasst sowohl statistische Betrachtungen als auch qualitative Interpretationen.
Wo finde ich den vollständigen Inhaltsverzeichnisses?
Der vollständige Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Dokument enthalten und bietet eine detaillierte Übersicht über alle Kapitel und Unterkapitel der Arbeit.
- Quote paper
- Katrin Elbeshausen (Author), 2007, Glück und Unglück in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79971