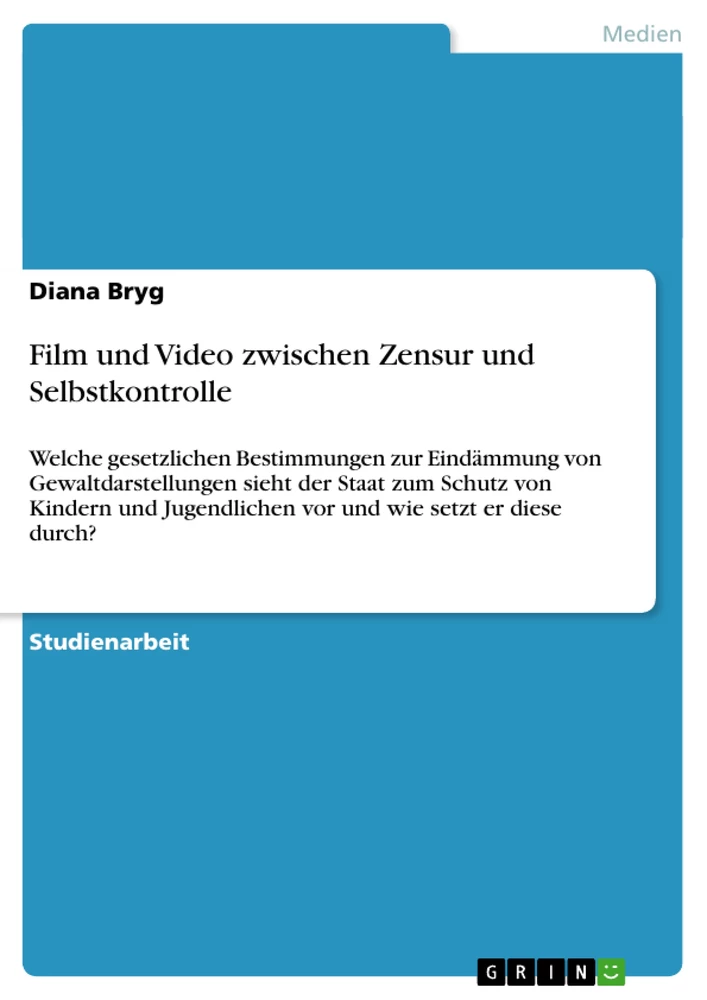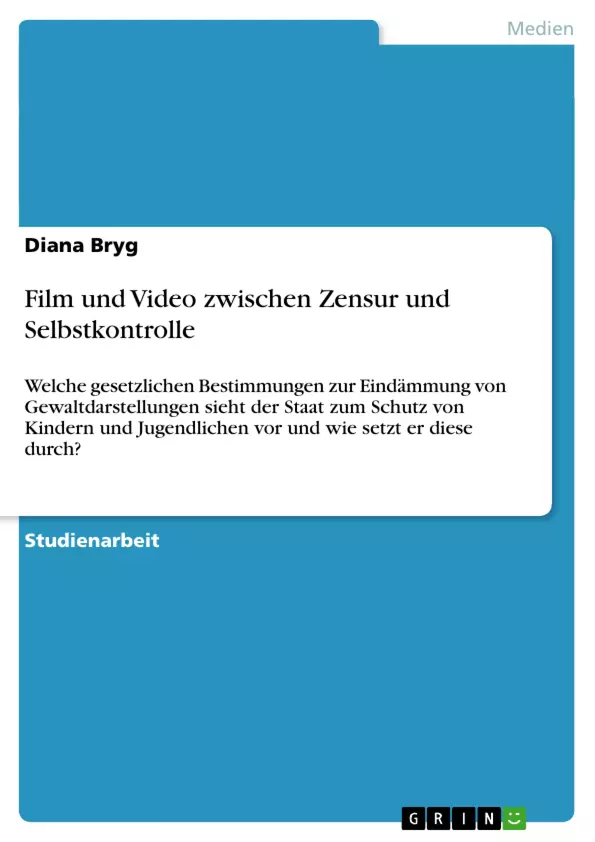12. Februar 1993. Am Nachmittag diesen Freitags wird der zweijährige James Bulger aus einer Einkaufspassage im englischen Liverpool entführt. Zwei Tage später wird er von der Polizei auf Bahngleisen gefunden. Tot. Seine Mörder: zwei zehnjährige Kinder. Dieser Fall erschütterte vor rund zehn Jahren Europas Öffentlichkeit. So jung wie die Täter waren, so brutal war auch ihr Vorgehen bei der Tat. Ein gewalttätiges Video diente den beiden jungen Tätern zum Vorbild und schnell war die Schuld an der grausamen Tat geklärt. Die gesellschaftliche Öffentlichkeit zeigte sich schockiert über die dramatische Zunahme der Gewaltbereitschaft, vor allem unter Kindern und Jugendlichen, und weltweit stellte man sich die Fragen: Was sind das für Kinder? Warum tun sie das?
Fakt ist, dass jedes Kind, welches Gewalt ausübt, zuvor selbst unglaubliche Gewaltmengen wahr- und aufgenommen hat. Und zwar nicht nur die pädagogisch begründbare Züchtigung oder Prügeleien auf dem Schulhof, sondern Gewalt in weitaus größeren, brutaleren Dimensionen, nämlich: Gewalt in den Medien. Obwohl es bisher nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist, scheint hierbei die Vermittlung von Gewalt in den Medien Fernsehen, Kino und Video eine besonders große Rolle zu spielen. Laut Statistik sehen Zwanzig Prozent der Grundschüler mehr als 40 Stunden pro Woche fern. Und das, obwohl durchschnittlich mehr als 800 Gewalttaten, darunter etwa 150 Morde, an nur einem Wochenende die Mattscheibe passieren. Auch haben bereits 23 Prozent Deutschlands Fünftklässler schon Gewaltvideos gesehen.1 Angesichts dieser Zahlen ist es ein leichtes, die Hauptschuldigen an solchen Nachahmungstaten zu finden. Schließlich währt die Diskussion um zuviel Gewalt in den Medien schon seit etwa 30 Jahren.
In meiner folgenden Arbeit möchte ich mich damit auseinandersetzen, welche gesetzliche Bestimmungen der Staat vorsieht, um die Darstellung von Gewalt vor allem in den visuellen Medien einzudämmen, um somit Kinder und Jugendliche zu schützen. Darüber hinaus möchte ich klären, wie wirksam die Durchsetzung solcher Gesetzesvorschriften ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Die Bestimmungen des Grundgesetzes (GG)
- Die Bestimmungen des Strafgesetzbuches (StGB)
- § 131 StGB- Gewaltdarstellungen
- § 184 StGB- Verbreitung pornografischer Schriften
- Das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften (JgefSchrG)
- Das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JÖSchG)
- Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)
- Zur Geschichte der FSK
- Die Aufgaben der FSK
- Die Grundsätze der FSK
- Die Rechtsform der FSK
- Die Prüfverfahren der FSK
- Die Altersfreigaben
- Die Prüfgremien
- Der Arbeitsausschuss
- Der Hauptausschuss
- Der Appellationsausschuss
- Wirksamkeit der Durchsetzung der Bestimmungen des Jugendschutzes durch die FSK
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen und die praktische Umsetzung des Jugendschutzes im Bereich der Film- und Videoproduktion in Deutschland. Die Arbeit untersucht, wie gesetzliche Vorschriften und die Selbstkontrolle der Filmwirtschaft dazu beitragen, Kinder und Jugendliche vor potenziell schädlichen Inhalten zu schützen.
- Rechtliche Grundlagen des Jugendschutzes in Deutschland
- Die Rolle des Grundgesetzes und des Strafgesetzbuches
- Die Selbstkontrolle der Filmwirtschaft durch die FSK
- Die Wirksamkeit von Gesetzen und Selbstkontrolle
- Die Herausforderung der Gewaltdarstellung in Filmen und Videos
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Fall des ermordeten James Bulger vor und beleuchtet die Rolle von Mediengewalt als mögliche Ursache für Gewaltbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen.
Das erste Kapitel untersucht die gesetzlichen Grundlagen des Jugendschutzes in Deutschland. Es analysiert die Bestimmungen des Grundgesetzes, des Strafgesetzbuches und weiterer Gesetze, die die Verbreitung jugendgefährdender Inhalte regulieren.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK). Es betrachtet die Geschichte, Aufgaben, Grundsätze und Prüfverfahren der FSK und diskutiert die Wirksamkeit ihrer Bemühungen zur Durchsetzung des Jugendschutzes.
Schlüsselwörter
Jugendschutz, Film, Video, Gewaltdarstellung, Selbstkontrolle, FSK, Grundgesetz, Strafgesetzbuch, Medienfreiheit, Kunstfreiheit.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Mediengewalt beim Kinderschutz?
Die Arbeit untersucht, wie der Konsum von Gewalt in Medien wie Fernsehen, Kino und Video die Gewaltbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen beeinflussen kann und welche Schutzmaßnahmen notwendig sind.
Was ist die Aufgabe der FSK in Deutschland?
Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) prüft Filme und Videos auf ihre Jugendtauglichkeit und vergibt Altersfreigaben basierend auf gesetzlichen Grundlagen und eigenen Grundsätzen.
Welche Gesetze regeln den Jugendschutz in den Medien?
Wichtige gesetzliche Grundlagen sind das Grundgesetz (GG), das Strafgesetzbuch (StGB, insbesondere § 131 und § 184), das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften (JgefSchrG) sowie das Jugendschutzgesetz.
Wie wirksam ist die Selbstkontrolle durch die FSK?
Die Arbeit analysiert die Wirksamkeit der Durchsetzung von Jugendschutzbestimmungen durch die FSK und hinterfragt, wie gut Kinder vor schädlichen Inhalten geschützt werden.
Was sind die Prüfgremien der FSK?
Die FSK verfügt über verschiedene Prüfgremien wie den Arbeitsausschuss, den Hauptausschuss und den Appellationsausschuss, die über die Altersfreigaben entscheiden.
Welchen Einfluss hat das Grundgesetz auf die Medienfreiheit?
Das Grundgesetz garantiert die Kunst- und Medienfreiheit, setzt dieser jedoch Grenzen, wenn es um den Schutz der Jugend und die Menschenwürde geht.
- Quote paper
- Diana Bryg (Author), 2002, Film und Video zwischen Zensur und Selbstkontrolle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79965