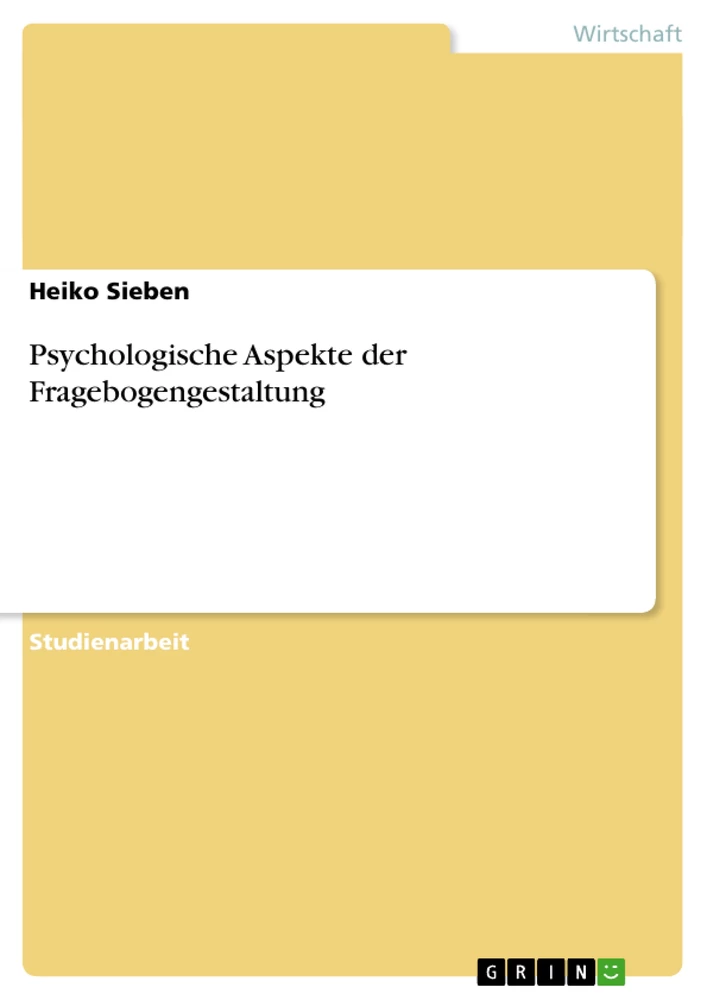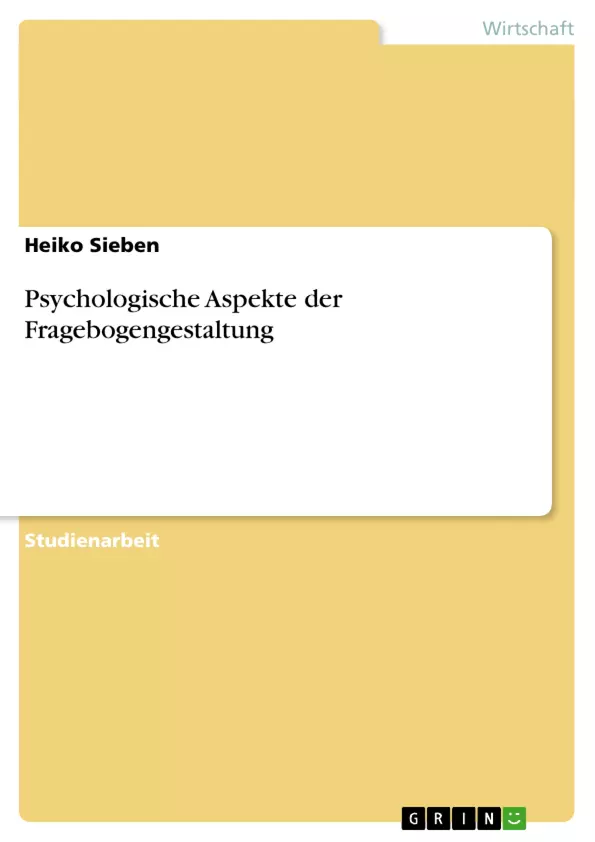Fragen dürften wohl das hauptsächlichste Mittel sein, mit dem wir uns im Alltag zu verständigen und etwas zu ermitteln suchen. Genauer gesagt, geht es dabei ja nicht allein um die Frage, sondern auch um die Antwort, die diese Frage ermöglicht oder die man direkt vorgibt (Friedrichs, 1990, S. 192). Da der Mensch in der Lage ist, Fragen zu beantworten, wird er vom Forscher oft als Informant in eigener Sache herangezogen: als Berichterstatter über das eigene Geschlecht, die Haarfarbe oder die ethnische Zugehörigkeit, über das eigene Einkommen, den Bildungsabschluss und den Familienstand und schließlich über die eigenen Einstellungen, das Wohlbefinden, die Wünsche und Motive (vgl. Duncan, 1984, zitiert in Strack, 1994, S. 7).
Fragen sind eines der in den Sozialwissenschaften am häufigsten verwendeten Vorgehen: (...) sei es ausschließlich in den Formen der Befragung oder als Teil anderer Methoden wie der Soziometrie, der Gruppendiskussion, der Beobachtung oder dem Experiment (Friedrichs, 1990, S. 193). Besonders in der Marktforschung spielen Befragungen eine immer bedeutendere Rolle. Unternehmen stellen sich in Zeiten wachsender Konkurrenz zunehmend Fragen wie: Hat mein Produkt eine Chance, sich nachhaltig auf dem Markt zu etablieren? Was muss ich an meinem Produkt verändern, um den Wünschen und Bedürfnissen der Konsumenten zu entsprechen?
Laut Böhler (1992, S. 89) werden Fragebögen bei schriftlicher, telekommunikativer und mündlicher Befragung benutzt. Bei mündlicher Befragung ist zudem zwischen Fragebögen für standardisierte Interviews und Leitfäden für teilstandardisierte Interviews zu unterscheiden. Die Probleme des Fragebogenaufbaus sind dabei verschieden (Böhler, 1992, S. 89). Wir beschränken uns in der vorliegenden Arbeit auf die standardisierten Befragungsmethoden, bei denen die Frageformulierung festgelegt ist (vgl. Atteslander & Kopp, 1995).
Die richtige Formulierung von Fragen und die Gestaltung des Fragebogens sind - neben der sinnvollen Auswahl von Gesprächspartnern in der Stichprobe - das A und O einer guten Befragungsaktion. Oft entscheidet der Fragebogen mehr als der Interviewer über die Qualität einer Untersuchung (Kastin, 1995, S. 92). Es wurde schon in den 40er Jahren wiederholt experimentell gezeigt, dass die Art der Fragestellung die Antwort beeinflussen kann (vgl. Cantril, 1944; Payne, 1951, zitiert in Strack, 1994, S. 32).
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Frageformulierung (Bezugsrahmen des Befragten)
- 1.1 Gründe
- 1.2 Einsicht
- 1.3 Fragen-Anordnung
- 1.4 Spontane Beantwortung
- 2. Arten von Fragen und Antwortvorgaben
- 2.1 Offene Fragen
- 2.2 Geschlossene Fragen
- 3. Fragebegründung und Zweck (Bezugsrahmen des Forschers)
- 3.1 Hypothetische Herleitung
- 3.2 Einteilung nach dem Zweck
- 3.2.1 Instrumentelle Fragen
- 3.2.2 Ergebnisfragen
- 4. Fragebogenaufbau
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit liegt in der Erörterung der psychologischen Aspekte der Fragebogengestaltung. Der Text analysiert, wie die Formulierung von Fragen, die Auswahl des Fragetyps und der Aufbau des Fragebogens die Qualität und Aussagekraft einer Befragung beeinflussen. Die Arbeit beleuchtet die psychologischen Faktoren, die das Antwortverhalten von Befragten beeinflussen können.
- Psychologische Aspekte der Frageformulierung
- Einfluss verschiedener Fragetypen auf das Antwortverhalten
- Die Bedeutung der Fragebogenstruktur für die Validität der Ergebnisse
- Die Rolle von Einsicht und Motivation des Befragten bei der Beantwortung
- Die Bedeutung der Fragebogenkonstruktion für die Markt- und Meinungsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung von Fragen und Antworten in der wissenschaftlichen Forschung dar und betont die wachsende Rolle von Fragebögen in der Marktforschung.
Kapitel 1 beleuchtet die Bedeutung der Frageformulierung und fokussiert auf den Bezugsrahmen des Befragten. Es werden verschiedene Aspekte wie die Gründe für bestimmte Antworten und die Notwendigkeit von Einsicht in die Thematik diskutiert.
Kapitel 2 befasst sich mit den verschiedenen Arten von Fragen und Antwortvorgaben. Es werden offene und geschlossene Fragen sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile vorgestellt.
Kapitel 3 untersucht die Fragebegründung und den Zweck aus Sicht des Forschers. Hier werden die hypothetische Herleitung von Fragen sowie die Einteilung nach dem Zweck diskutiert.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Aufbau und der Gestaltung des Fragebogens.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den psychologischen Aspekten der Fragebogengestaltung. Wichtige Themen sind die Frageformulierung, verschiedene Fragetypen, der Fragebogenaufbau und die Bedeutung der Fragebogenkonstruktion für die Validität und Aussagekraft von Befragungen.
- Quote paper
- Heiko Sieben (Author), 2002, Psychologische Aspekte der Fragebogengestaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7960