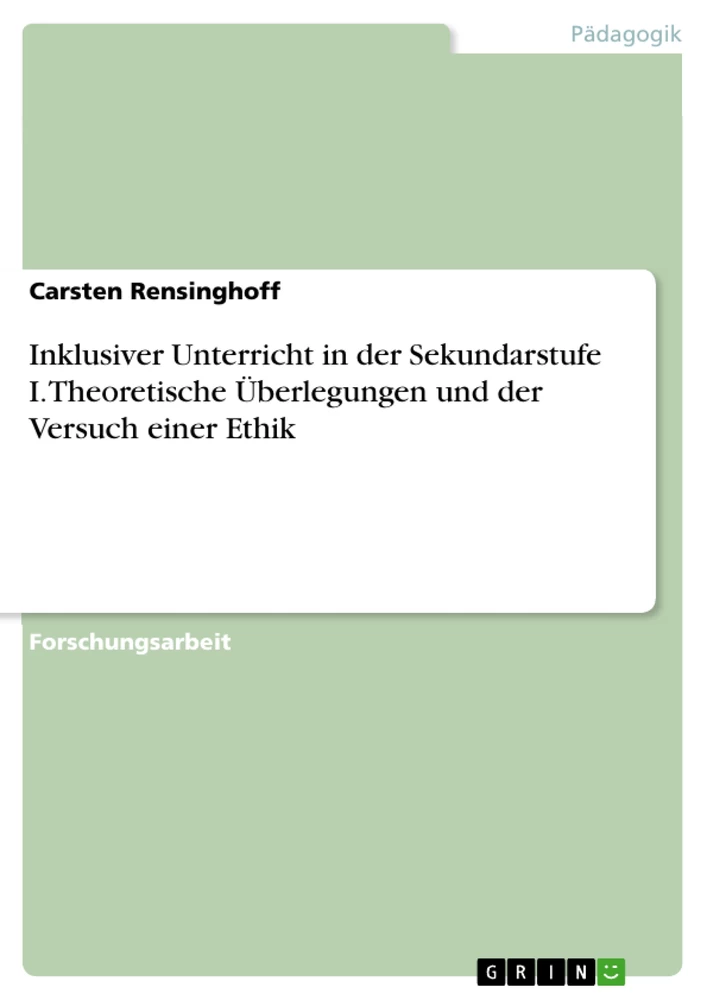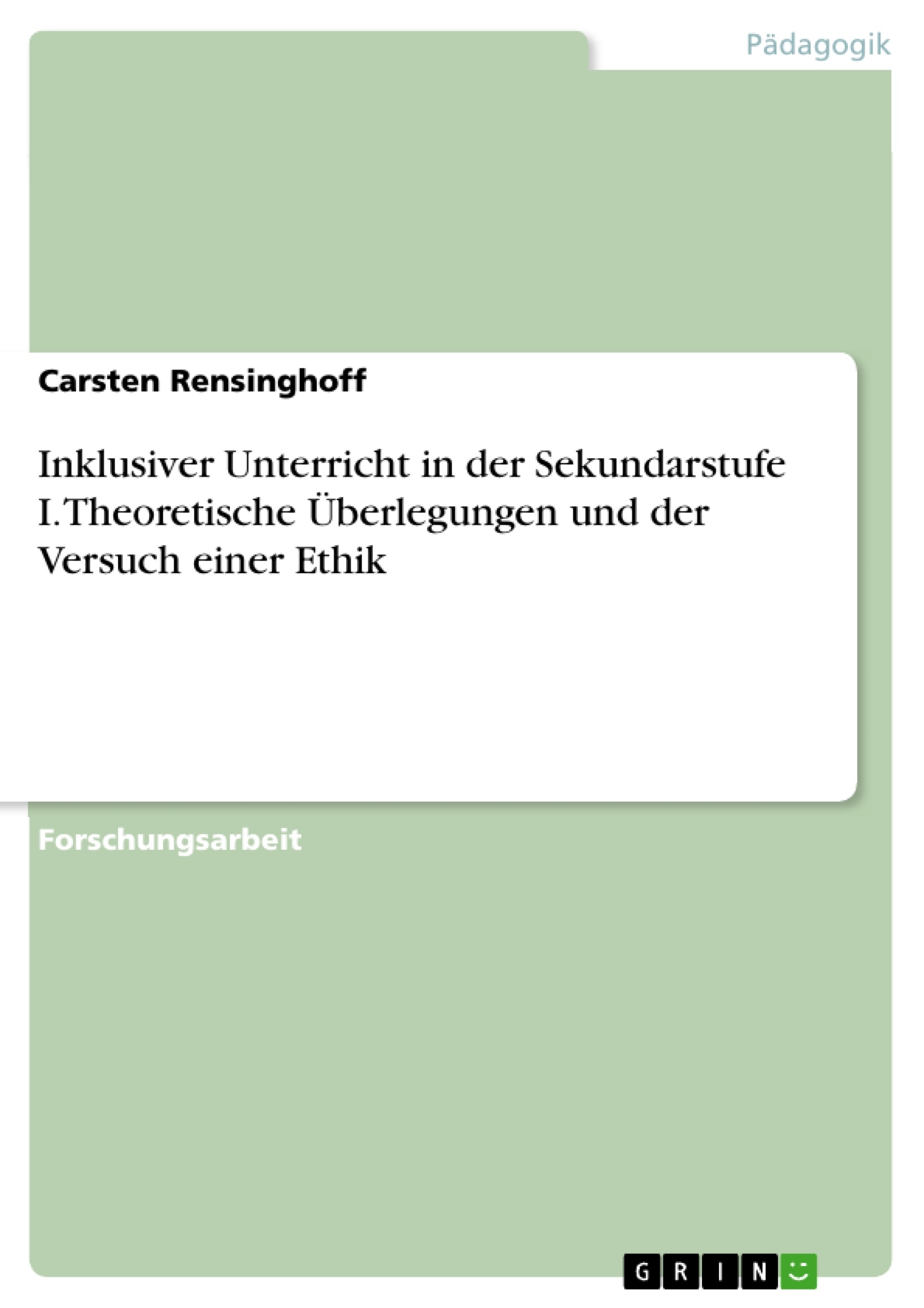Der selbst durch eine schwere Schädel-Hirnverletzung mit 12 Jahren schwer behinderte Autor dieser Arbeit und selbst bis zum siebten Schuljahr (Gymnasium) allgemein Beschulte und dann bis zum Abitur Sonderbeschulte legt hiermit den Versuch einer Ethik für einen inklusiven Unterricht vor. Ziel ist es immer und jederzeit behinderte und nicht behinderte Schülerinnen und Schüler gemeinsam leben und lernen zu lassen. Auf diese Weise wird einer schulischen Isolation in Verwahranstalten entgegengewirkt. Unerlässlich ist die Lektüre für alle sich mit der Inklusion befassenden Menschen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärungen
- Inklusion vs. Integration
- Begriffswirrwarr – Integration, Inclusion, Inklusion, Diversity Studies
- Die entwicklungslogische Didaktik
- Behinderung
- Behinderung aus salutogenetischer Perspektive betrachtet
- Behinderungsbedingte Traumaverarbeitung in Spiralphasen
- Selbsthilfe
- Empowerment
- Das Problem der Inklusion
- Entwicklungsneuropsychologische Aspekte
- Struktur des Gehirns
- Postnatale Gehirnentwicklung
- Die kindliche Denkentwicklung
- Entwicklungsneuropsychologische Aspekte
- Inklusionsethik
- Eine Begriffsbestimmung des Ethischen
- Begründung einer Ethik
- Versuch einer Inklusionsethik
- Methodisches Vorgehen im inklusiven Unterricht
- Was passiert mit den Schwerst- und Schwerstmehrfachbehinderungserfahrenen?
- Erster Exkurs: Der Tag, an dem auch mein rechter Arm sich selbstständig macht...
- Abschließender Exkurs und Klärung der Motivlage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das vorliegende Werk befasst sich mit der Inklusion behinderungserfahrener Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I. Dabei geht es darum, die theoretischen Grundlagen der Inklusion zu beleuchten, den Begriff der Behinderung aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und eine Ethik für den inklusiven Unterricht zu entwickeln.
- Begriffliche Abgrenzung und Analyse von Inklusion und Integration
- Entwicklungsneuropsychologische Aspekte der Inklusion
- Die Rolle der kindlichen Denkentwicklung im inklusiven Unterricht
- Entwicklung einer Inklusionsethik, die die Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler berücksichtigt
- Methodisches Vorgehen im inklusiven Unterricht und die Herausforderungen der Inklusion für Schwerst- und Schwerstmehrfachbehinderungserfahrene
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt den Leser in die Thematik der Inklusion behinderungserfahrener Schülerinnen und Schüler ein. Der Autor schildert seine eigenen Erfahrungen mit Behinderung und die Beweggründe für die Beschäftigung mit diesem Thema.
- Begriffsklärungen: In diesem Kapitel werden die Begriffe Inklusion und Integration abgegrenzt und verschiedene Perspektiven auf Behinderung beleuchtet. Dabei geht es um die Entwicklung der Begriffe sowie um die Herausforderungen der Inklusion in der Praxis.
- Das Problem der Inklusion: Dieses Kapitel behandelt die neuropsychologischen Aspekte der Inklusion und beleuchtet die Bedeutung der kindlichen Denkentwicklung im inklusiven Unterricht.
- Inklusionsethik: Hier wird eine Ethik für den inklusiven Unterricht entwickelt. Es geht um die ethischen Grundlagen der Inklusion und um die Frage, wie ein Unterricht gestaltet werden kann, der die Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieses Werkes sind Inklusion, Integration, Behinderung, Entwicklungsneuropsychologie, kindliche Denkentwicklung, Inklusionsethik, und Empowerment. Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Anspruch der Inklusion, allen Schülerinnen und Schülern gleiche Bildungschancen zu ermöglichen, und analysiert die Herausforderungen und Chancen des inklusiven Unterrichts.
- Quote paper
- Dr. phil. Carsten Rensinghoff (Author), 2007, Inklusiver Unterricht in der Sekundarstufe I. Theoretische Überlegungen und der Versuch einer Ethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79591