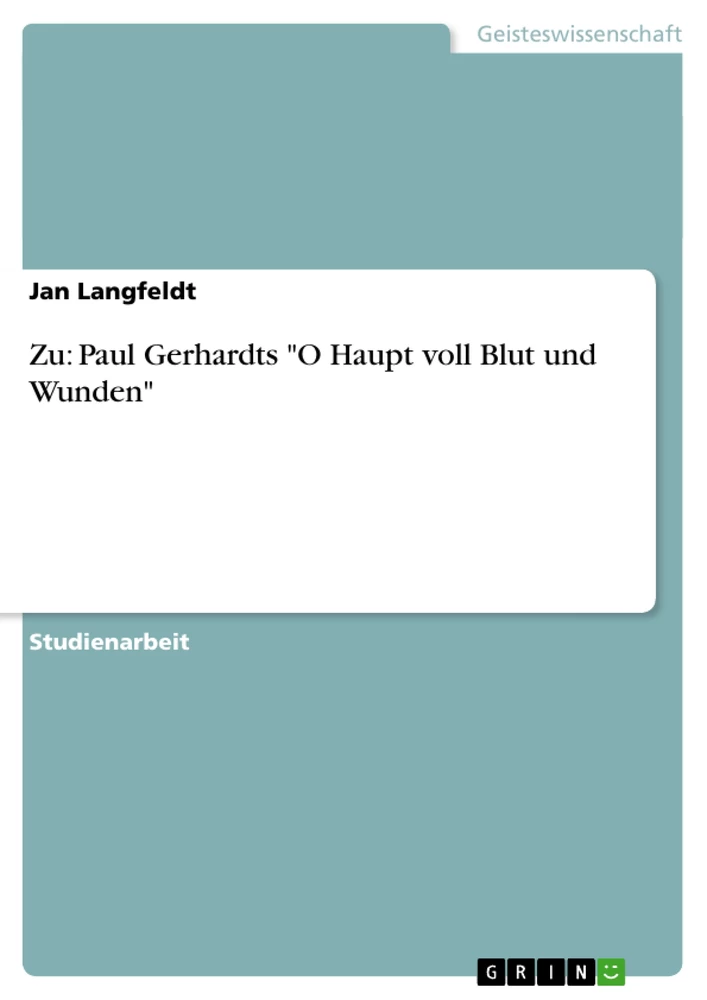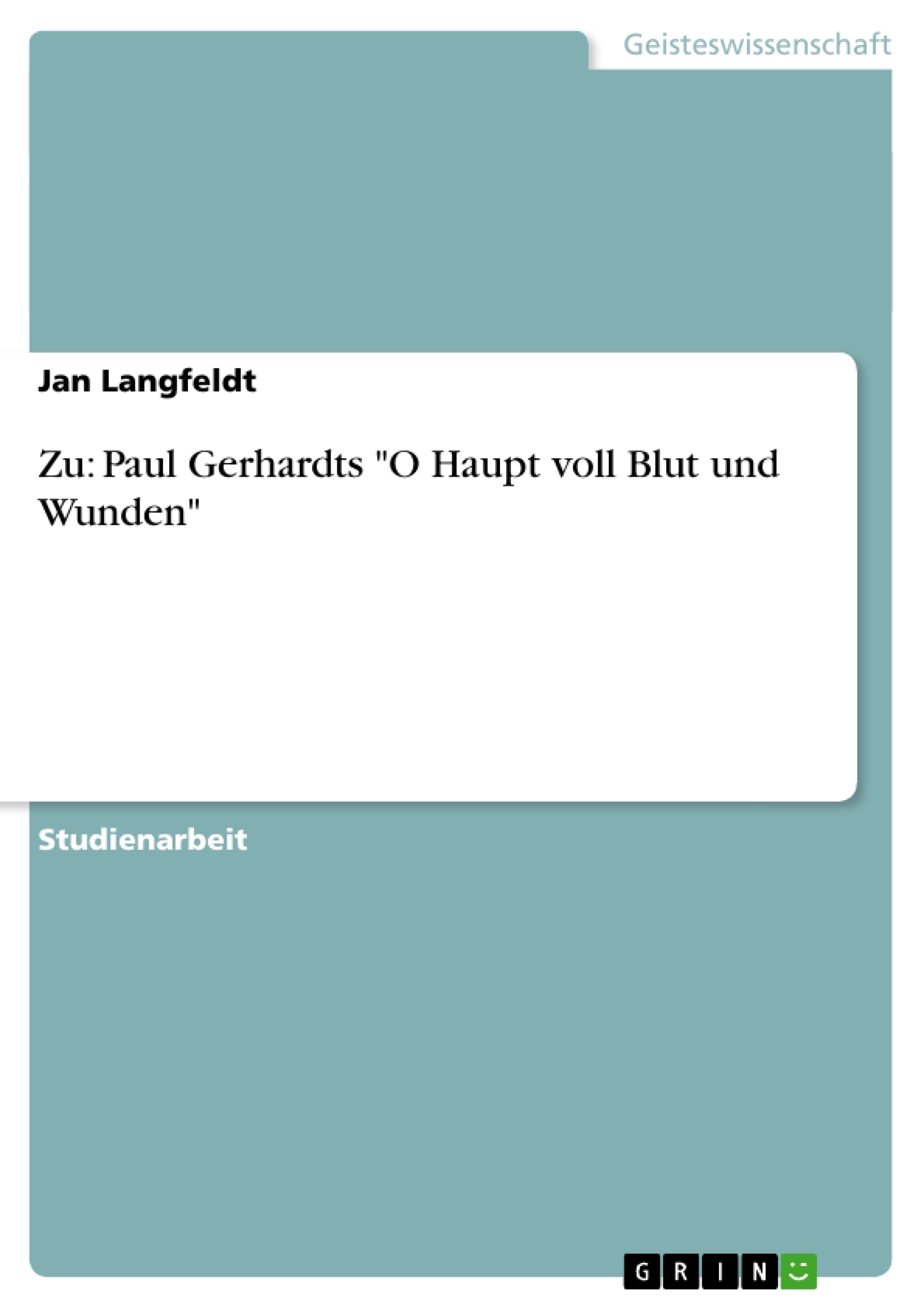Im Rahmen des Seminarthemas „Kirchenlieder als historische Quelle“ beschäftigten sich im Sommersemester 2006 Studenten am Kieler Institut für Kirchengeschichte und Kirchliche Archäologie unter Anleitung von Prof. Dr. Dr. h.c. Lehmann mit verschiedenen Kirchenliedern, deren historischer Gehalt durch Referieren und Diskutieren erörtert worden ist.
Vorrangiges Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den von Paul Gerhardt verfassten Hymnus "O Haupt voll Blut und Wunden" in seiner Funktion als Ausdruck einer bestimmten (kirchen-)historischen Epoche – der Frühen Neuzeit – zu untersuchen und markante Aspekte derselben an seinem Beispiel exemplarisch kenntlich zu machen; daneben wird kurz auf seine Wirkungsgeschichte eingegangen werden.
Überblicksartig leiten Artikel bezüglich bestimmter Aspekte der Zeitgeschichte durch die Arbeit.
Die Arbeit schließt mit einem kurzen Fazit auf Grundlage der zuvor gewonnenen Erkenntnisse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Kontext
- Allgemeinhistorischer Kontext
- Individualisierung in der Frühen Neuzeit
- Leiblichkeit, Affekt und Leidenschaft in der Frühen Neuzeit
- Sterben und Tod in der Frühen Neuzeit
- Religions- und theologie-historischer Kontext
- Mystik und lutherische Orthodoxie
- Soteriologie der lutherischen Orthodoxie
- Gesang und lutherische Frömmigkeit
- Zur Person Paul Gerhardts (1607 - 1676)
- Vita
- Werk und Wirkung
- Lebenssituation Gerhardts zum Entstehungszeitpunkt des Liedes „O Haupt voll Blut und Wunden“
- O Haupt voll Blut und Wunden
- Text
- Textbezogene Interpretation
- Wirkungsgeschichte
- Fazit: O Haupt voll Blut und Wunden als Zeugnis seiner Zeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Kirchenhymnus „O Haupt voll Blut und Wunden“ von Paul Gerhardt, um seine Bedeutung als Ausdruck der frühen Neuzeit zu beleuchten. Sie untersucht den historischen Kontext, die Person Gerhardts und die Wirkungsgeschichte des Liedes. Ziel ist es, markante Aspekte der frühen Neuzeit anhand des Beispiels des Hymnus zu verdeutlichen.
- Individualisierung in der frühen Neuzeit
- Leiblichkeit, Affekt und Leidenschaft in der frühen Neuzeit
- Sterben und Tod in der frühen Neuzeit
- Lutherische Orthodoxie und Frömmigkeit
- Wirkung und Bedeutung von Kirchenliedern
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Seminarthemas „Kirchenlieder als historische Quelle“ ein und erläutert den Fokus der Arbeit auf den Hymnus „O Haupt voll Blut und Wunden“ als Ausdruck der frühen Neuzeit.
- Historischer Kontext: Dieses Kapitel untersucht den allgemeinhistorischen Kontext des Hymnus, insbesondere die Prozesse der Individualisierung, die veränderte Wahrnehmung von Leiblichkeit und die Bedeutung von Tod und Sterben in der frühen Neuzeit.
- Zur Person Paul Gerhardts: Dieses Kapitel widmet sich der Biographie und dem Werk von Paul Gerhardt. Es beleuchtet insbesondere seine Lebenssituation zum Zeitpunkt der Entstehung des Hymnus „O Haupt voll Blut und Wunden“.
- O Haupt voll Blut und Wunden: Dieses Kapitel analysiert den Text des Hymnus, dessen Interpretation und seine Wirkungsgeschichte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Kirchenhymnus „O Haupt voll Blut und Wunden“ von Paul Gerhardt, der frühen Neuzeit, der Individualisierung, Leiblichkeit und Affekt, Tod und Sterben, der lutherischen Orthodoxie, der Frömmigkeit und der Bedeutung von Kirchenliedern.
- Citation du texte
- Jan Langfeldt (Auteur), 2006, Zu: Paul Gerhardts "O Haupt voll Blut und Wunden", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79505