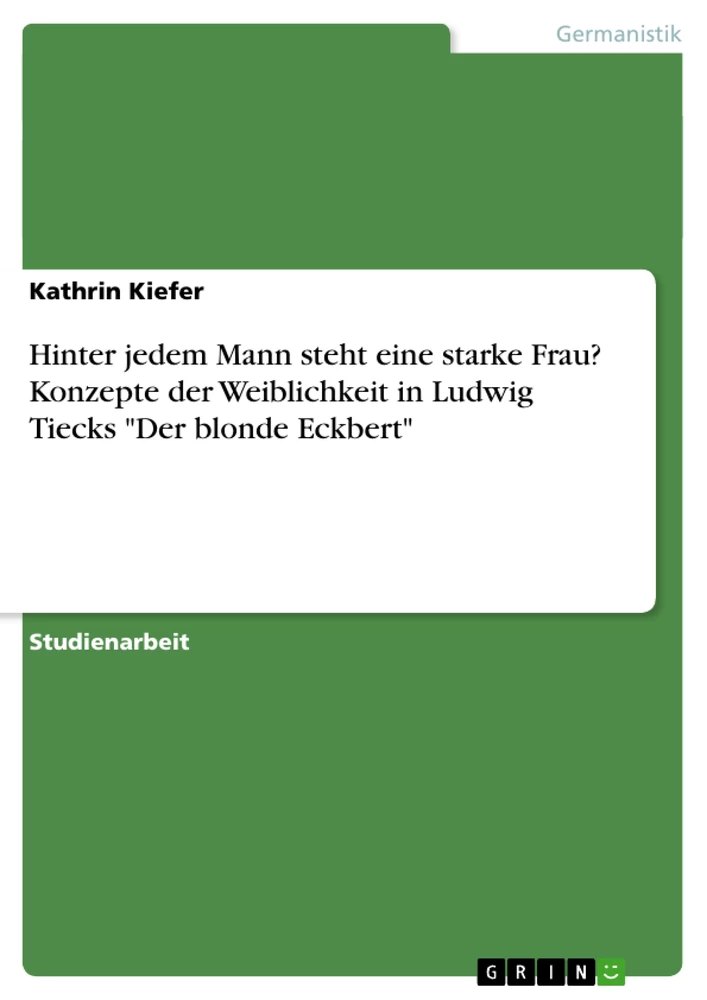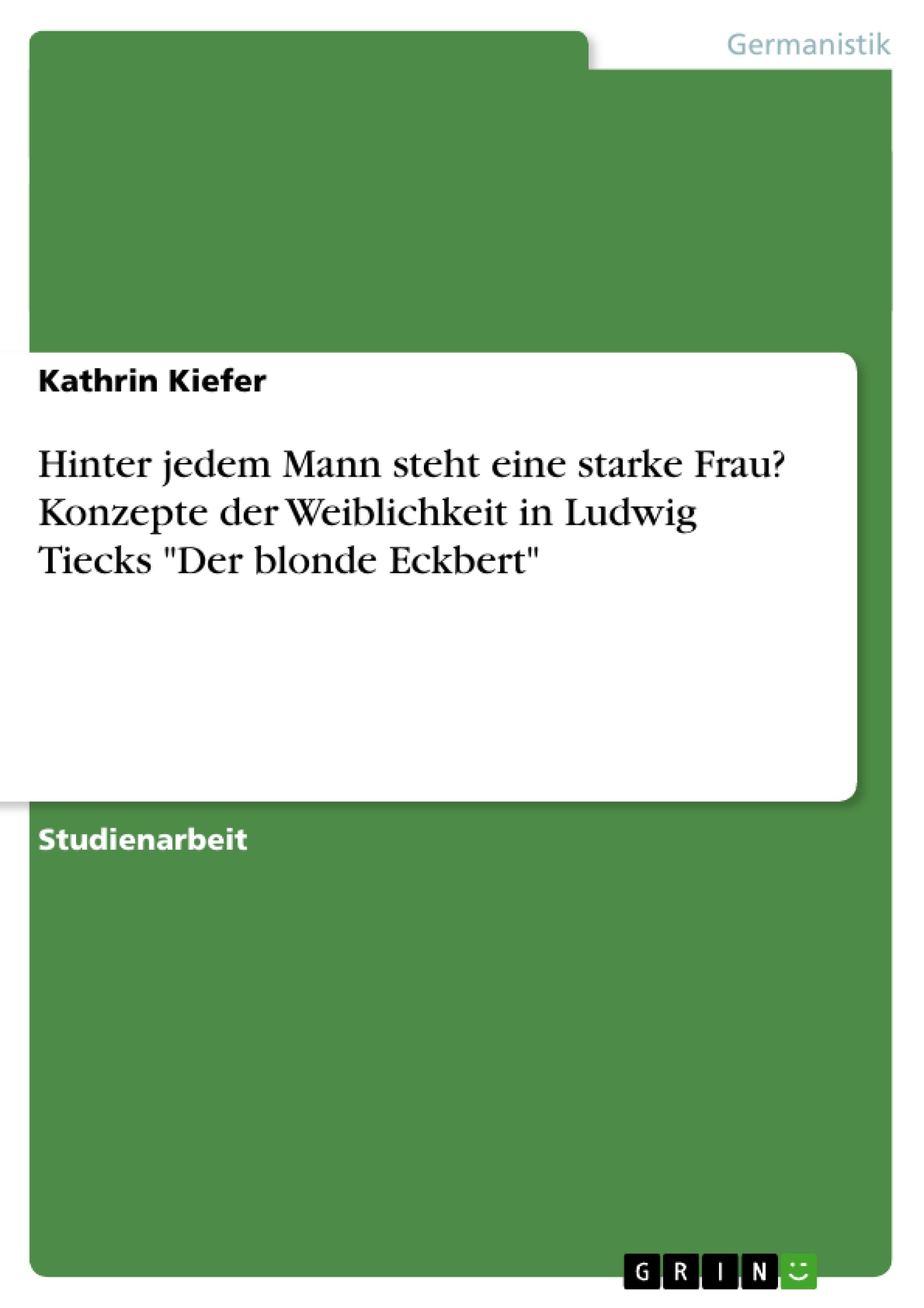Das Frauenbild in der Romantik – Beginn einer Emanzipation
Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist für uns heute selbstverständlich. Doch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hatten Frauen wenig Rechte und dadurch kaum Chancen, sich selbst zu verwirklichen. Mit der Romantik begann eine Emanzipationsbewegung der Frau. Vor dieser Zeit war diese „Objekt, Instrument und oft Opfer einer männlich geprägten Gesellschaft“ . In der Ehe war es die Aufgabe der Frau, für Nachkommen zu sorgen und die Hauswirtschaft zu führen. Damit waren ihre Tätigkeitsfelder und Lebensbereiche stark eingegrenzt, die ökonomische Sphäre blieb ihr zum größten Teil verwehrt.
In der Romantik beginnen die Männer, sich für die Frauen in ihrer geschlechtlichen Autonomie zu interessieren, was diesen die Chance gibt, sich zu emanzipieren. Die Ehe bekommt eine neue Bedeutung: „Wenn schließlich in der Romantik die Ehe primär und sogar ausschließlich in Liebe begründet und damit allein den einzelnen Mann und die einzelne Frau betreffend gedacht wird, lösen sich tendenziell Ehe und Familie als Institution auf.“ . Dieser neue Stellenwert der Liebe in der Ehe macht die Frau zum gleichberechtigten Partner.
Neben der neuen Zuwendung zu Märchen und Mythen, Natur und Seele, erwacht das Interesse an „weiblicher Symbolik“ : „Frauen schienen das gesuchte Ideal der Verbindung von Kunst und Leben zu verwirklichen; Frauen standen – nach der Auffassung der Romantiker – »der Natur«, »dem Leben« näher als die abstraktargumentierenden [sic] Männer".
Ludwig Tieck, ein Dichter beeinflusst von seiner Zeit und Romantiker in extenso, war von diesen Bewegungen nicht unbeeinflusst, zählten doch unter anderem die Gebrüder Schlegel zu seinen engen Freunden. (...)
In der vorliegenden Arbeit soll das Kunstmärchen „Der blonde Eckbert“ angesichts des neuen Stellenwertes der Frau in der Romantik und mit dem Hintergrundwissen von Tiecks persönlichen Erfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht interpretiert werden. Mit Hilfe einer hermeneutischen Interpretation und den Begriffen des „gender“- Diskurses soll das Frauenbild analysiert werden.
Das erkenntnisleitende Interesse gilt dem Frauenbild der Zeit und stützt die Arbeitshypothese, dass sich der romantische Diskurs über die Emanzipation des Weiblichen in den Frauengestalten von Tiecks „Der blonde Eckbert“ niederschlägt.
Inhaltsverzeichnis
- Das Frauenbild in der Romantik – Beginn einer Emanzipation
- Bertha - Die Ökonomisierung der Frauenrolle
- Bertha und Eckbert: Eine onomasiologische Beziehung
- Die Ehe: Ausflucht Beziehung
- Betitelungen Berthas: Abhängige Weiblichkeit
- Bertha: Individueller Frauencharakter oder flache Märchenfigur?
- Die Alte - Übermächtige Schicksalsfigur
- Die Alte als Erzieherin und Mutter
- Die Alte als Märchenfigur
- Die Alte als personifizierte Schuld
- Die Alte als Ersatz für Bertha?
- Das Frauenkonzept im „Blonden Eckbert“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Frauenbild in Ludwig Tiecks Kunstmärchen „Der blonde Eckbert“ vor dem Hintergrund der romantischen Emanzipationsbewegung. Dabei werden die Figuren Berthas und der Alten im Kontext des „gender“-Diskurses untersucht. Ziel ist es, zu erforschen, ob sich die romantischen Diskurse über die Emanzipation des Weiblichen in den weiblichen Figuren von Tiecks „Der blonde Eckbert“ widerspiegeln.
- Die Rolle der Frau in der Romantik und ihre Emanzipation
- Die Ökonomisierung der Frauenrolle in „Der blonde Eckbert“
- Die ambivalenten Figuren Berthas und der Alten
- Das Verhältnis von Liebe, Schuld und Verhängnis in der Erzählung
- Die Bedeutung des Märchens als Medium zur Erforschung des Frauenbildes
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das Frauenbild der Romantik und stellt den historischen Kontext der Emanzipation dar. Kapitel 2 analysiert die Figur Berthas im Hinblick auf ihre Ökonomisierung der Frauenrolle und ihre onomasiologische Beziehung zu Eckbert. Es untersucht die Ehe als „Ausflucht Beziehung“ sowie die Abhängigkeit Berthas in ihrer Bezeichnung. Kapitel 3 widmet sich der Figur der Alten und analysiert ihre ambivalenten Rollen als Erzieherin, Mutter, personifizierte Schuld und mögliche Ersatzfigur für Bertha.
Schlüsselwörter
Romantik, Emanzipation, Frauenbild, „gender“-Diskurs, Ludwig Tieck, „Der blonde Eckbert“, Bertha, Alte, Ehe, Ökonomisierung, Schuld, Märchen
- Citar trabajo
- Kathrin Kiefer (Autor), 2006, Hinter jedem Mann steht eine starke Frau? Konzepte der Weiblichkeit in Ludwig Tiecks "Der blonde Eckbert", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79482