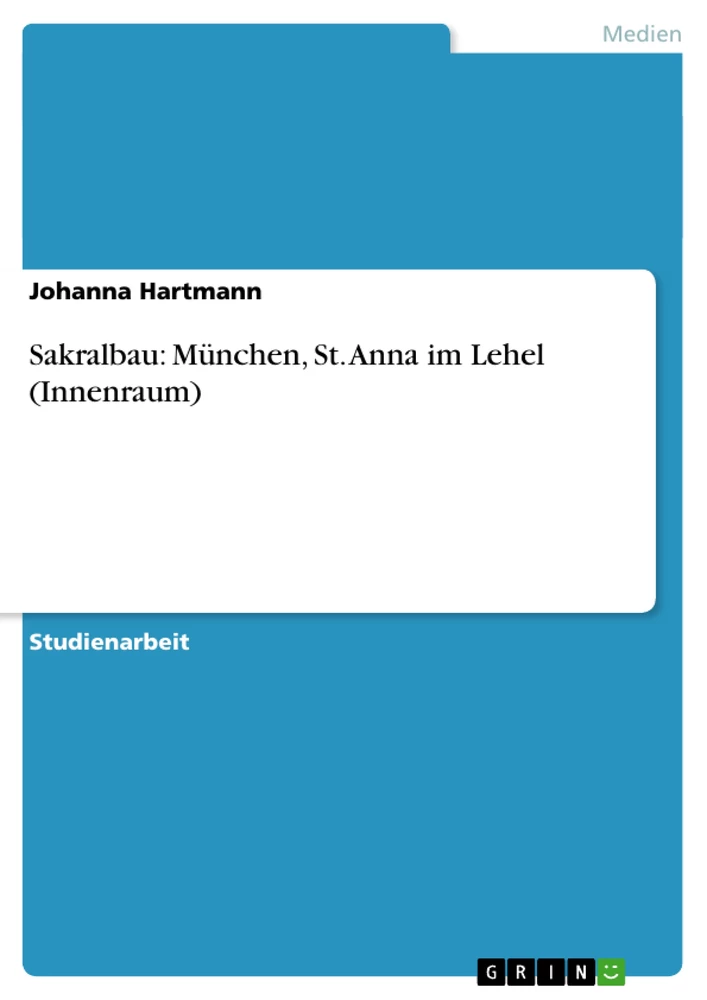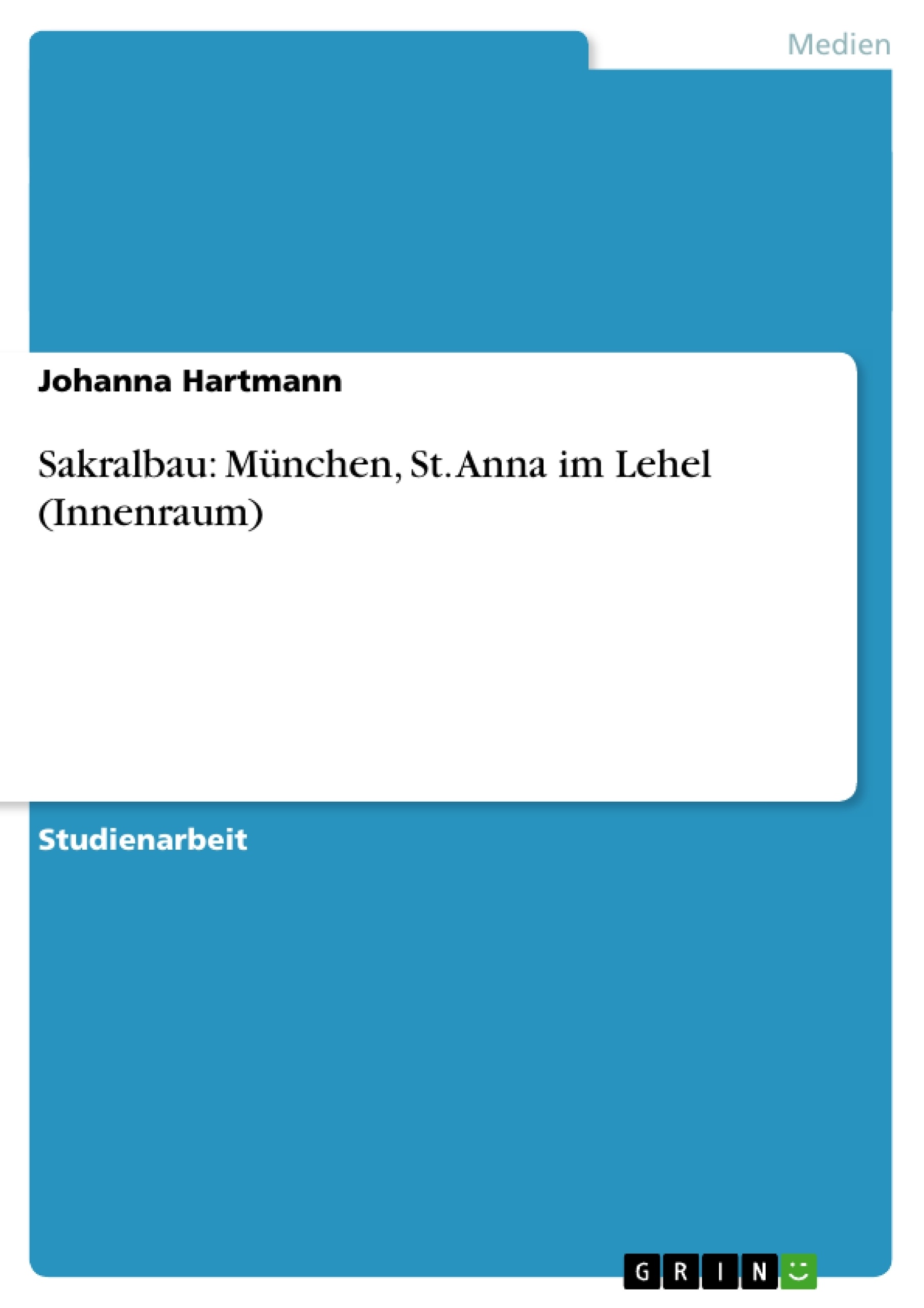Die Klosterkirche St. Anna im Lehel gilt als erste Rokokokirche in München, wahrscheinlich in ganz Altbayern. Am 19. März 1725 genehmigte Kurfürst Max Emanuel den Bau der Kirche. Genau zwei Jahre später erfolgte die Grundsteinlegung durch die Kurfürstin Maria Amalia. Die Funktion von St. Anna war die einer Dankvotivkirche, aufgrund der Geburt des Thronfolgers Kurprinz Max Joseph. Die Fertigstellung des Rohbaus erfolgte in nur drei Jahren. Ursprünglich wurde die Kirche von Johann Michael Fischer in den Jahren von 1727 bis 1733 erbaut. Er beschreitet bei der Raumauffassung dieser Kirche ganz neue Wege. Was die Grundrissdisposition betrifft, findet bei Fischer eine Abkehr von den italienischen „Regeln“ statt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Die Geschichte der Klosterkirche St. Anna im Lehel
- II. Die Wandlung der Raumauffassung bei St. Anna im Lehel
- III. Die Außenfassade von St. Anna im Lehel
- IV. Der Grundriss von St. Anna im Lehel
- V. Die Innenraumbeschreibung von St. Anna im Lehel
- VI. Die Verbindung von Raum und Verzierung
- 6.1. Die Altäre
- 6.1.1. Der Hochaltar
- 6.1.2. Die Seitenaltäre
- 6.1. Die Altäre
- VII. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Klosterkirche St. Anna im Lehel in München, mit besonderem Fokus auf ihren Innenraum. Die Arbeit untersucht die architektonische Entwicklung der Kirche, von ihrer Entstehung bis zur Rekonstruktion nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Zielsetzung besteht darin, die Besonderheiten des Entwurfs von Johann Michael Fischer zu beleuchten und die innovative Raumauffassung im Kontext des Rokoko zu verstehen.
- Die Baugeschichte der Kirche St. Anna im Lehel und ihre verschiedenen Umbauphasen.
- Die innovative Raumauffassung Fischers und ihre Abkehr von italienischen Traditionen.
- Die Gestaltung der Außenfassade und ihre Rekonstruktion nach dem Zweiten Weltkrieg.
- Die Verbindung von Raum und Verzierung im Innenraum, insbesondere die Gestaltung der Altäre.
- Die Bedeutung von St. Anna im Lehel als Beispiel für schöpferische Denkmalpflege.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Die Geschichte der Klosterkirche St. Anna im Lehel: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehungsgeschichte der Kirche, beginnend mit der Genehmigung des Baus durch Kurfürst Max Emanuel im Jahr 1725 bis zur Weihe 1737. Es beleuchtet die Rolle der Kirche als Dankvotivkirche und die Bedeutung von Johann Michael Fischer als Architekt. Die zahlreichen Umbauten und Restaurierungen, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, werden ebenfalls detailliert dargestellt, wobei die Herausforderungen und Erfolge der schöpferischen Denkmalpflege im Mittelpunkt stehen. Der Bezug zu anderen Kirchenbauten Fischers, wie St. Michael, wird hergestellt, um dessen architektonische Entwicklung zu veranschaulichen.
II. Die Wandlung der Raumauffassung bei St. Anna im Lehel: Hier wird die innovative Raumauffassung von Johann Michael Fischer analysiert. Im Gegensatz zu italienischen Vorbildern verzichtet Fischer auf traditionelle Elemente wie Wandsäulen und ein durchgehendes Gebälk. Stattdessen schafft er eine geschmeidige Verbindung von Längs- und Zentralbau, die sich in der „Zweischaligkeit“ von Innen- und Außenraum ausdrückt. Die Wandpfeiler sind nicht mehr als solche ausgebildet, sondern dienen nur dem statischen Minimum. Die optische Wirkung wird durch ein zartes Architravband und eine Flachkuppel erreicht. Die Diskussion der „bayerischen“ Zentralbauweise und der damit verbundenen gestalterischen Freiheit steht im Zentrum dieses Kapitels.
III. Die Außenfassade von St. Anna im Lehel: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Außenfassade der Kirche, insbesondere auf ihre Rekonstruktion nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs durch Erwin Schleich. Die Rekonstruktion orientierte sich an den Originalzeichnungen Fischers, wobei einige Abweichungen, wie die Gestaltung des Giebels, erwähnt werden. Die Analyse der Fassade als Kolossalordnung mit dominierendem Mittelfeld und flankierenden Seitenfeldern ist ein zentraler Bestandteil. Die Integration der Kirche in den Klosterbau und die Gestaltungselemente wie Pilaster und Nischen werden detailliert beschrieben.
IV. Der Grundriss von St. Anna im Lehel: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Grundriss der Kirche und analysiert seine Besonderheiten. Die Abkehr von italienischen „Regeln“ und die Gestaltung als Rechteck mit ovalem Innenraum wird thematisiert. Die neuartige Raumauffassung wird durch den Vergleich mit anderen Kirchenbauten verdeutlicht. Die Analyse konzentriert sich auf die Beziehung zwischen der geometrischen Form des Grundrisses und dem optischen Eindruck des Innenraums.
V. Die Innenraumbeschreibung von St. Anna im Lehel: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Beschreibung des Innenraums, unter Einbezug der Rekonstruktionen nach dem Zweiten Weltkrieg. Es geht detailliert auf die einzelnen Elemente ein und beschreibt deren Funktion und Gestaltung. Die Verbindung von Architektur und Ausstattung, insbesondere in Bezug auf die verwendeten Materialien und die Lichtverhältnisse, wird analysiert. Der Schwerpunkt liegt auf dem Gesamteindruck des Innenraums und seiner Wirkung auf den Betrachter.
Schlüsselwörter
St. Anna im Lehel, Rokoko, Johann Michael Fischer, Kirchenbau, Raumauffassung, Außenfassade, Innenausstattung, Denkmalpflege, Barockarchitektur, Bayern, München.
Häufig gestellte Fragen zur Klosterkirche St. Anna im Lehel
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert umfassend die Klosterkirche St. Anna im Lehel in München, insbesondere ihren Innenraum. Sie untersucht die architektonische Entwicklung, von der Entstehung bis zur Rekonstruktion nach dem Zweiten Weltkrieg, beleuchtet die Besonderheiten des Entwurfs von Johann Michael Fischer und die innovative Raumauffassung im Kontext des Rokoko. Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Baugeschichte der Kirche und ihre Umbauphasen; die innovative Raumauffassung Fischers und ihre Abkehr von italienischen Traditionen; die Gestaltung der Außenfassade und ihre Rekonstruktion; die Verbindung von Raum und Verzierung im Innenraum, besonders die Gestaltung der Altäre; und die Bedeutung von St. Anna im Lehel als Beispiel für schöpferische Denkmalpflege.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit umfasst sieben Kapitel: Kapitel I beschreibt die Entstehungsgeschichte der Kirche; Kapitel II analysiert die innovative Raumauffassung Fischers; Kapitel III konzentriert sich auf die Außenfassade und ihre Rekonstruktion; Kapitel IV befasst sich mit dem Grundriss der Kirche; Kapitel V bietet eine umfassende Beschreibung des Innenraums; Kapitel VI untersucht die Verbindung von Raum und Verzierung, insbesondere die Altäre; und Kapitel VII ist eine Schlussbemerkung.
Wie wird die innovative Raumauffassung Fischers beschrieben?
Die Arbeit beschreibt Fischers innovative Raumauffassung als Abkehr von italienischen Traditionen. Er verzichtete auf Elemente wie Wandsäulen und ein durchgehendes Gebälk, schaffte stattdessen eine geschmeidige Verbindung von Längs- und Zentralbau und eine „Zweischaligkeit“ von Innen- und Außenraum. Die optische Wirkung wird durch ein zartes Architravband und eine Flachkuppel erreicht.
Welche Rolle spielt die Denkmalpflege in der Arbeit?
Die Denkmalpflege spielt eine wichtige Rolle, insbesondere im Hinblick auf die Rekonstruktion der Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Arbeit beschreibt die Herausforderungen und Erfolge der schöpferischen Denkmalpflege und die Orientierung an Originalzeichnungen Fischers bei der Rekonstruktion, wobei auch Abweichungen erwähnt werden.
Welche Bedeutung hat St. Anna im Lehel im Kontext anderer Kirchenbauten Fischers?
Die Arbeit stellt Bezüge zu anderen Kirchenbauten Fischers her, wie z.B. St. Michael, um dessen architektonische Entwicklung zu veranschaulichen und die Besonderheiten von St. Anna im Lehel im Kontext seines Gesamtwerks zu positionieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: St. Anna im Lehel, Rokoko, Johann Michael Fischer, Kirchenbau, Raumauffassung, Außenfassade, Innenausstattung, Denkmalpflege, Barockarchitektur, Bayern, München.
- Citation du texte
- Magister Artium Johanna Hartmann (Auteur), 2003, Sakralbau: München, St. Anna im Lehel (Innenraum), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79275