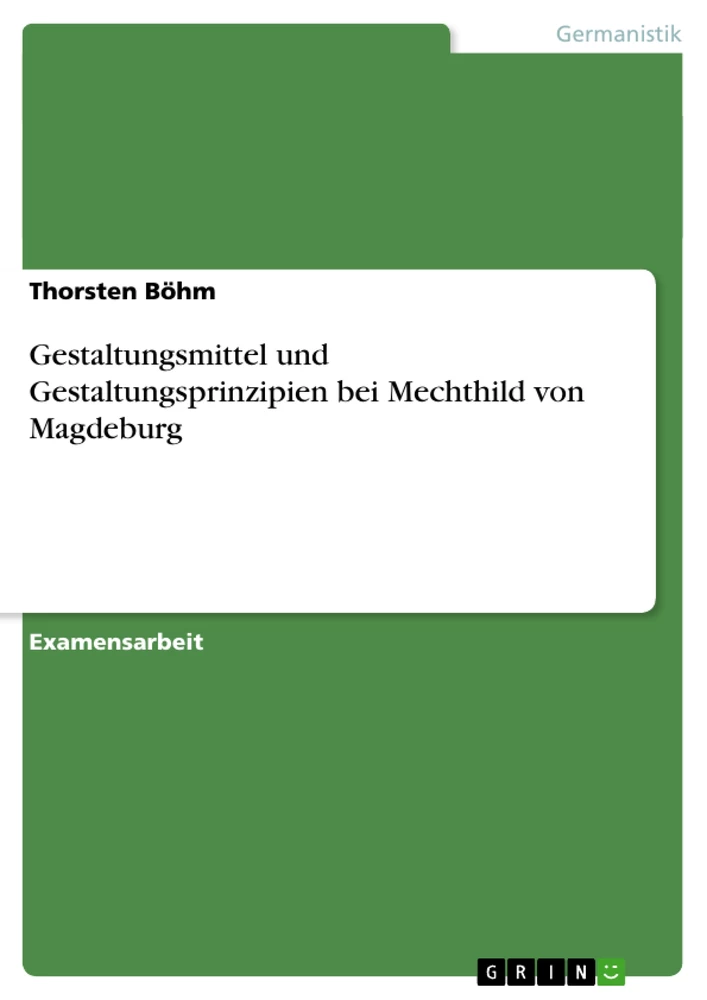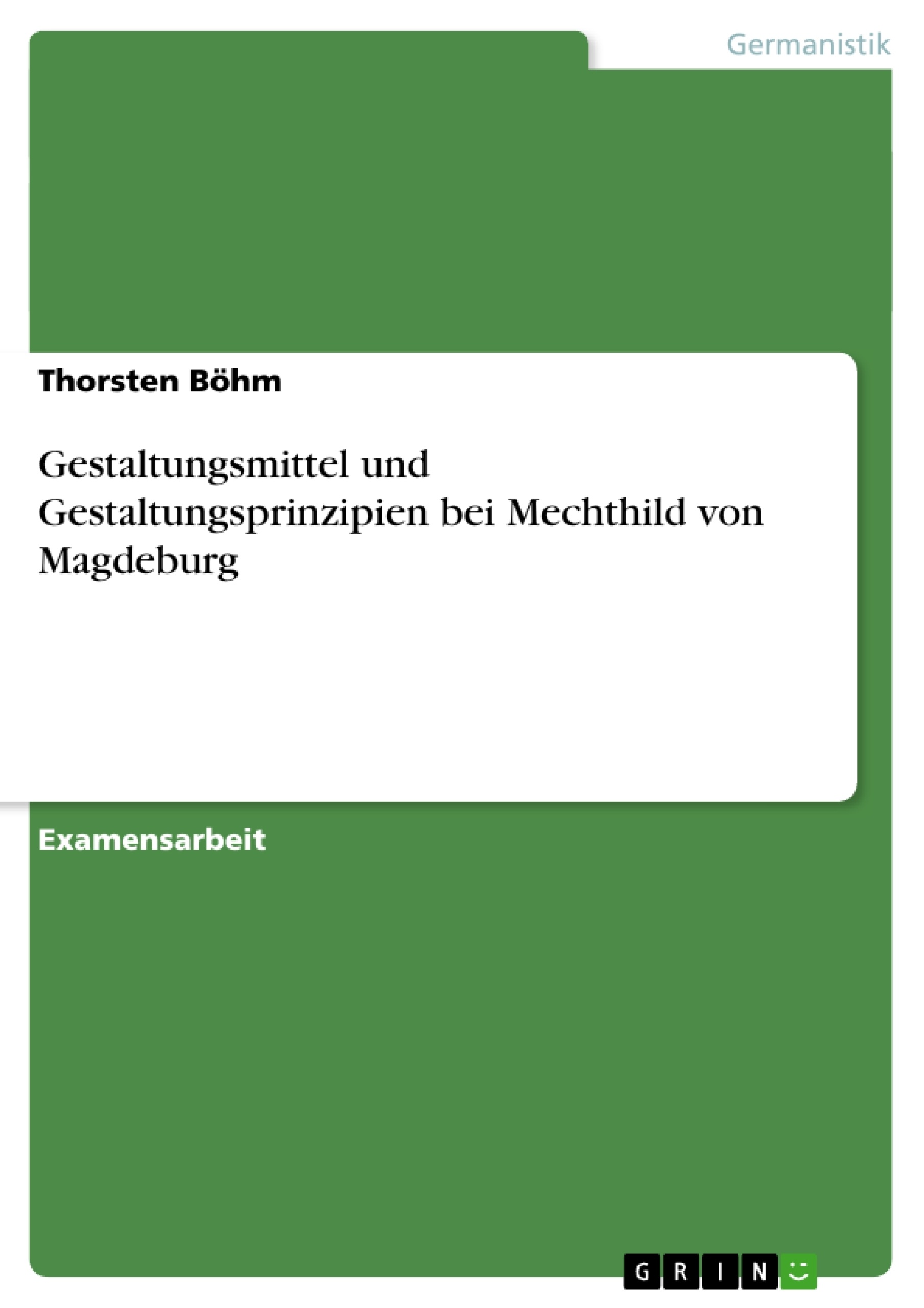Gestaltungsmittel und Gestaltungsprinzipien sind in jedem literarischen Werk sehr vielfältig und lassen sich unter zahlreichen Gesichtspunkten installieren. Das gilt vor allem für „Das fließende Licht der Gottheit“ von Mechthild von Magdeburg. Allegorese, Metaphernbildung, Symbolik oder religiöse Aspekte sind nur einige Themen, die jedes für sich eine eigenständige Arbeit rechtfertigen, da Mechthilds Werk in all diesen Bereichen höchst komplex und einzigartig ist. Es wird also eine Einengung des Themas vonnöten sein, um an einigen Stellen genügend in die Tiefe gehen zu können.
Die vorliegende Arbeit analysiert „Das fließende Licht der Gottheit“ in drei Schritten:
1.Das Selbstverständnis Mechthilds soll anhand ihres eigenen Werkes beleuchtet werden. Dabei wird sich herausstellen, dass es strukturgebend wirkt und als Schlüssel zum Verständnis des Gesamtwerks sehr hilfreich ist.
2.Die verwendete Symbolik und Metaphorik ist ungewöhnlich vielseitig. Marianne Heimbach stellte in ihrer Arbeit heraus, dass bereits der Titel des „Das fließende Licht der Gottheit“ in „metaphorisch verdichteter Gestalt“ andeutet, was Mechthild in ihrem Werk zum Ausdruck bringt. Ausgehend vom Titel werden die Metaphernkomplexe, die mit „fließen“ und „Licht“ gestaltet werden analysiert, wobei sich zeigen wird, das sehr zahlreiche Verknüpfungen zu anderen Metaphernkomplexen mit der Minne als sinngebendes Zentrum bestehen.
3.Zur Frage der Systematik in Mechthilds Werk kommt die Forschung zu konträren Ansichten. Es wird sowohl eine kontinuierliche Entwicklung als auch ein völliges Fehlen jeglicher Systematik postuliert. Bei Mechthilds Werk, das in seiner Komposition in vielerlei Hinsicht Lichtenbergs Sudelbüchern gleicht, ist weder die eine noch die andere These leicht zu begründen. Daher werden in einem letzten Schritt quantitative Analysemethoden auf „Das fließende Licht der Gottheit“ angewandt, um versteckte Entwicklungen und Strukturen sichtbar zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Das Selbstverständnis Mechthilds
- 1.1 Passio, Kenosis, Imitatio und Compassio
- 1.2 Weisheit und Erkenntnisse
- 1.2.1 Falsche und rechte Wahrheit
- 1.2.2 minne-bekantnisse-gebruchunge
- 1.2.3 Wahrnehmung der Erkenntnis
- 1.2.4 Antithetik
- 1.2.5 Das Selbstbewusstsein Mechthilds als Illitterata
- 1.3 Ablehnung weltlicher Regeln als strukturgebendes Element
- 2 Metaphern- und Symbolanalyse
- 2.1 Rechtfertigung des Titels
- 2.2 Die Voraussetzungen für den Empfang des Fließens
- 2.2.1 Geistlichkeit als Voraussetzung, oder für wen ist Mechthilds Werk gedacht?
- 2.2.2 Minne als Voraussetzung und Bestandteil des fließenden Lichts
- 2.3 Metaphern mit flüssigen Substanzen
- 2.3.1 Verschiedene Erscheinungsformen des Flüssigen
- 2.3.2 Fließen und Fluten allgemein
- 2.3.3 Fließen der Liebe und Minne
- 2.3.4 Andere Wahrnehmungen des Fließens
- 2.4 Lichtmetaphorik
- 2.4.1 Licht als Eigenschaft Gottes
- 2.4.2 Licht versus Finsternis, Licht als Eigenschaft des Guten
- 2.4.3 Spiegelmetaphern, Schein und Widerschein
- 2.4.4 Sonstige Bilder mit Licht
- 2.5 Fazit
- 3 quantitative Analyse
- 3.1 Allgemeines zu quantitativen Textanalysen
- 3.2 Systematik der quantitativen Textanalyse des „Fließenden Lichts der Gottheit“
- 3.3 Die Ergebnisse
- 3.4 Interpretation der quantitativen Ergebnisse
- 3.4.1 Die Volumenverteilung
- 3.4.2 Die Verteilung der Themenkategorien
- 3.5 Fazit zur quantitativen Untersuchung
- Literaturverzeichnis
- Anhang A
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert „Das fließende Licht der Gottheit“ von Mechthild von Magdeburg, um die Gestaltungsmittel und Gestaltungsprinzipien ihres Werkes zu beleuchten. Die Arbeit untersucht, wie Mechthilds Selbstverständnis und die Verwendung von Metaphern und Symbolen das Gesamtwerk prägen. Darüber hinaus wird durch eine quantitative Analyse nach versteckten Strukturen und Entwicklungen im Text gesucht.
- Mechthilds Selbstverständnis und dessen Einfluss auf ihr Werk
- Analyse der Metaphern und Symbole in „Das fließende Licht der Gottheit“, insbesondere die Bedeutung von „Fließen“ und „Licht“
- Quantitative Analyse des Werks zur Erforschung von Systematik und Struktur
- Die Rolle der Minne als zentrales sinngebendes Element in Mechthilds Werk
- Die besondere Sprachgestalt und der mystische Charakter von Mechthilds Schriften
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Selbstverständnis Mechthilds von Magdeburg, welches anhand ihres Werkes „Das fließende Licht der Gottheit“ beleuchtet wird. Es werden Themen wie Passio, Kenosis, Imitatio und Compassio sowie die von Mechthild beschriebenen Weisheiten und Erkenntnisse analysiert. Das Kapitel beleuchtet auch Mechthilds Ablehnung weltlicher Regeln und ihr Selbstverständnis als Illitterata. Das zweite Kapitel analysiert die Metaphern und Symbole, die Mechthild in ihrem Werk verwendet. Es wird besonders auf die Metaphern „Fließen“ und „Licht“ eingegangen und gezeigt, wie diese mit anderen Metaphernkomplexen, insbesondere der Minne, verknüpft sind. Das dritte Kapitel widmet sich einer quantitativen Analyse des „Fließenden Lichts der Gottheit“. Es werden allgemeine Aspekte quantitativer Textanalysen vorgestellt und eine spezifische Systematik zur Analyse von Mechthilds Werk erläutert. Die Ergebnisse der Analyse werden interpretiert und in Bezug auf die Volumenverteilung und die Verteilung der Themenkategorien betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von „Das fließende Licht der Gottheit“ von Mechthild von Magdeburg. Die Schlüsselwörter umfassen: Selbstverständnis, Metaphernanalyse, Symbolanalyse, quantitative Textanalyse, Fließen, Licht, Minne, Geistlichkeit, Illitterata, mystische Sprache, Gestaltungsmittel, Gestaltungsprinzipien, Sprachgestalt.
- Quote paper
- Thorsten Böhm (Author), 2005, Gestaltungsmittel und Gestaltungsprinzipien bei Mechthild von Magdeburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79248