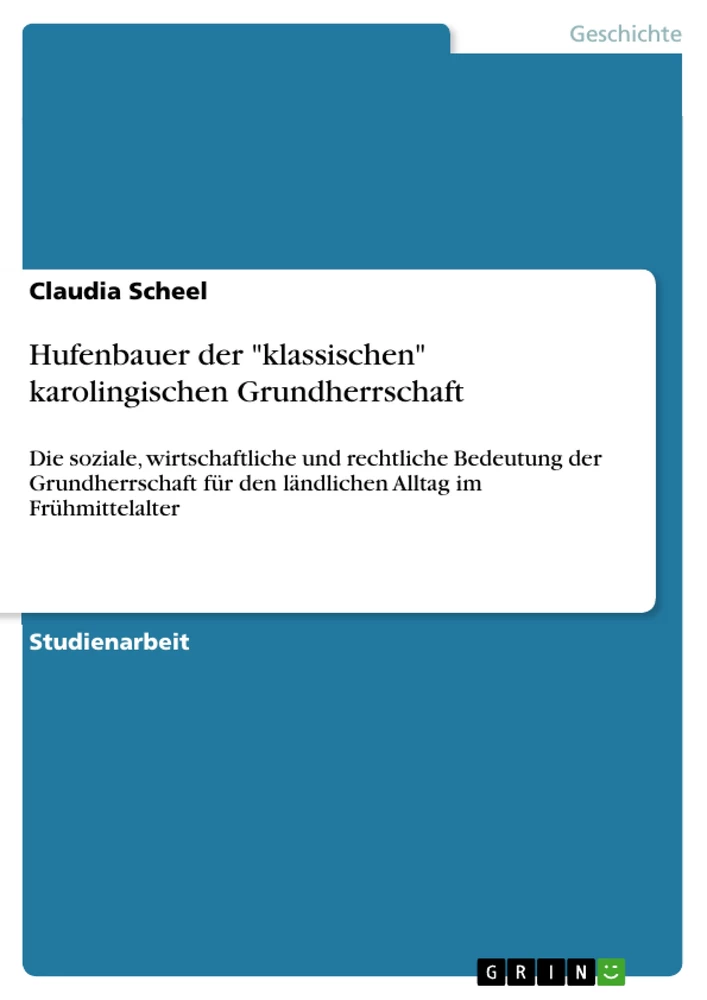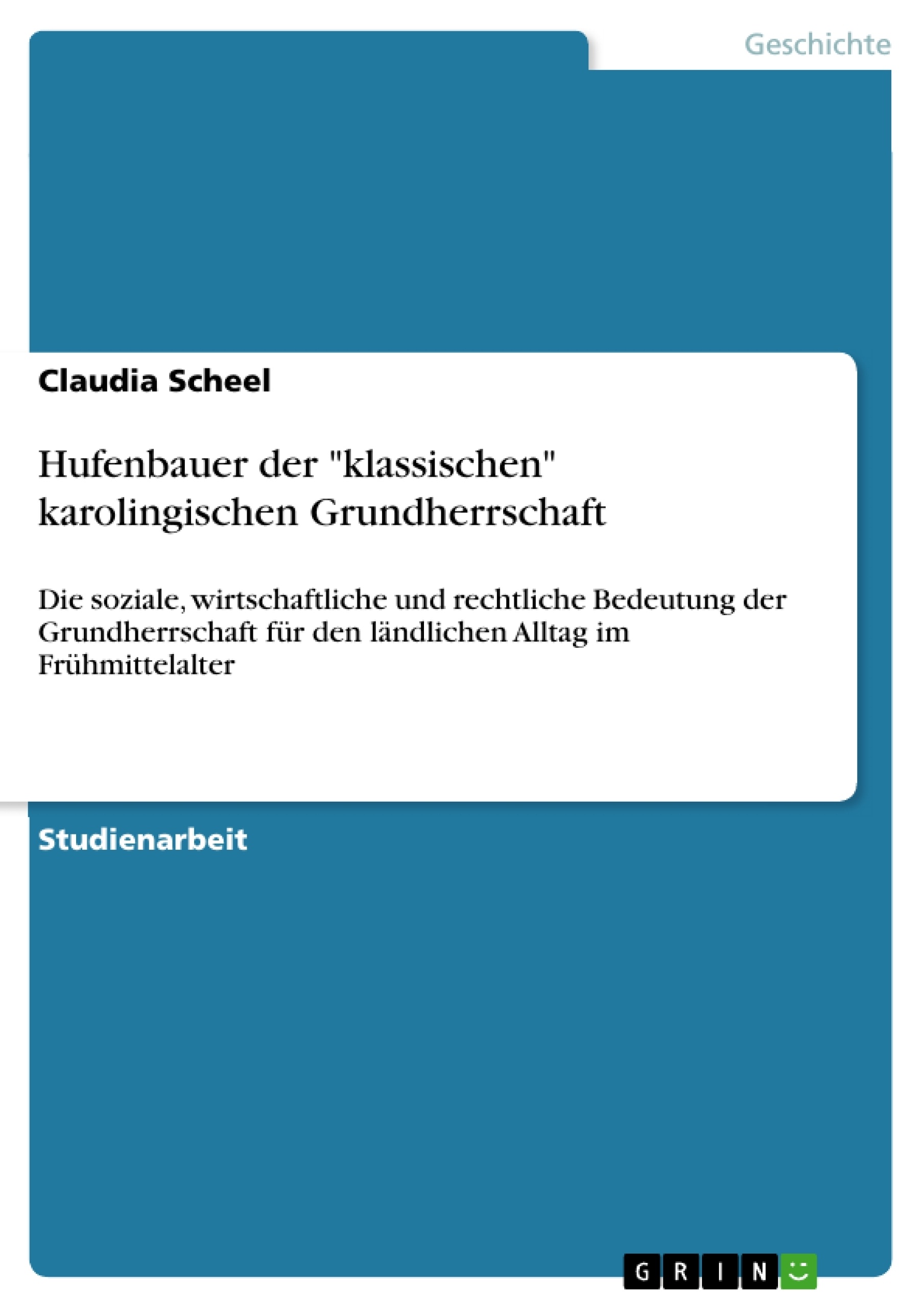Mit der Institution Grundherrschaft ist eine agrikole Betriebsform angesprochen, die die Lebensweise unzähliger Menschen des Mittelalters in ganz unmittelbarer Weise bestimmt hat und weit mehr darstellt als eine bloße Wirtschafts- und Herrschaftsorganisation auf agrarischer Basis.
Die Arbeit verfolgt die These, dass die frühmittelalterliche 'klassische' Ausprägung der Grundherrschaft, die Villikation, den ländlichen Alltag in einem Ausmaß prägte, das das spätere Mittelalter nicht mehr kennen sollte. Auf der Basis zweier Quellen ("Capitulare de villis et curtis imperialibus" sowie der "Hofbeschreibung Rommersheim" aus dem Prümer Urbar) wird die Villikationsverfassung als gesellschaftliche und rechtliche Organisationsform, als Wirtschaftsform und als Kultgemeinschaft - mit den entsprechenden Konsequenzen für den bäuerlichen Alltag - untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Das Karolingerreich im 9. Jahrhundert
- Die Grundherrschaft – eine Begriffsbestimmung
- Grundherrschaft als Organisationsform der mittelalterlichen Gesellschaft (Stagnierende bäuerliche Schichten oder gesellschaftliche Mobilität?)
- Die villa als lokaler Schauplatz grundherrlichen Handelns
- Die familia als Verbandsform
- Der mansus in seinen verschiedenen Formen
- Grundherrschaft als agrarische Wirtschaftsform (Bäuerliche Arbeit in ihren Facetten)
- Census et servitium - Der mansus als Kernzelle des grundherrlichen Systems
- Grundherrschaft als Rahmen (technischer) Innovation
- Karolingische Renaissance der (Hand)arbeit
- Grundherrschaft als Kultgemeinschaft (Verchristlichung oder Volksmassen in „heidnischer Folklore“?)
- Prüm eine klösterliche Grundherrschaft
- Grundherrliche Bestrebungen zur Verchristlichung der familia
- Grundherrschaft als rechtlicher Rahmen (Potentes und pauperes)
- Schutz und Schirm
- Konflikte und grundherrliche Immunität
- Grundherrschaft als Organisationsform der mittelalterlichen Gesellschaft (Stagnierende bäuerliche Schichten oder gesellschaftliche Mobilität?)
- Fazit/Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die „klassische“ karolingische Grundherrschaft im ausgehenden 8. und 9. Jahrhundert und deren Bedeutung für den ländlichen Alltag. Sie hinterfragt die These, dass diese Form der Grundherrschaft den ländlichen Alltag in einem universellen Ausmaß prägte und die damalige Gesellschaft noch keinen einheitlichen „Bauernstand“ kannte. Die Arbeit analysiert die Grundherrschaft nicht nur als Wirtschafts- und Herrschaftsform, sondern auch als soziale und rechtliche Institution sowie als Kultgemeinschaft.
- Die Organisation der karolingischen Grundherrschaft (Villa, Familia, Mansus)
- Die agrarische Wirtschaftsform der Grundherrschaft und ihre technischen Innovationen
- Der Einfluss der Grundherrschaft auf den religiösen Alltag
- Der rechtliche Rahmen der Grundherrschaft und die Beziehungen zwischen Grundherren und Bauern
- Die karolingische Renaissance und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das Karolingerreich im 9. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt das Karolingerreich im 9. Jahrhundert als ein riesiges Gebiet mit unterschiedlichen materiellen und kulturellen Bedingungen. Es betont zwei gegensätzliche Tendenzen: den Fortschritt in der Agrartechnik (Dreifelderwirtschaft, schwerer Pflug, Wassermühlen) und die „karolingische Renaissance“. Die verbesserte Agrartechnik führte zu einer starken wirtschaftlichen Dynamik und Bevölkerungswachstum, während die karolingische Renaissance eine Ideologie der produktiven Anstrengung darstellte. Der „mittelalterliche Landesausbau“ eröffnete neue Perspektiven für bäuerliche Schichten, erforderte aber gleichzeitig ein System zur Bewältigung der damit verbundenen Aufgaben, was zur zunehmenden Verhufung beitrug.
Die Grundherrschaft – eine Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Grundherrschaft“ und untersucht sie als Organisationsform der mittelalterlichen Gesellschaft, als agrarische Wirtschaftsform, als Kultgemeinschaft und als rechtlichen Rahmen. Es analysiert die Rolle der Villa, der Familia und des Mansus als zentrale Elemente der Grundherrschaft, beleuchtet die bäuerliche Arbeit, die technischen Innovationen und die Verchristlichungsprozesse. Der rechtliche Rahmen wird im Kontext von Schutz und Schirm sowie Konflikten und grundherrlicher Immunität erörtert. Das Kapitel verwendet das „Capitulare de villis et curtis imperialibus“ und die Hofbeschreibung von Rommersheim aus dem Prümer Urbar als Quellen, um die Theorie mit der Praxis zu vergleichen. Es betont die Herausforderungen der Quelleninterpretation und die Schwierigkeit, den ländlichen Alltag im Frühmittelalter umfassend zu rekonstruieren.
Häufig gestellte Fragen zum Text über die karolingische Grundherrschaft
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über die karolingische Grundherrschaft im 9. Jahrhundert. Er untersucht diese nicht nur als Wirtschafts- und Herrschaftsform, sondern auch als soziale, rechtliche Institution und Kultgemeinschaft. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, inwieweit die Grundherrschaft den ländlichen Alltag prägte und ob von einem einheitlichen „Bauernstand“ gesprochen werden kann.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in die Kapitel „Das Karolingerreich im 9. Jahrhundert“, „Die Grundherrschaft – eine Begriffsbestimmung“, und „Fazit/Ausblick“ (letzteres ist im Preview nicht vollständig enthalten). Das Kapitel zur Grundherrschaft unterteilt sich in Unterkapitel, die verschiedene Aspekte dieser Institution beleuchten: Grundherrschaft als Organisationsform, agrarische Wirtschaftsform, Kultgemeinschaft und rechtlicher Rahmen.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die Organisation der karolingischen Grundherrschaft (Villa, Familia, Mansus), die agrarische Wirtschaftsform und technische Innovationen, der Einfluss der Grundherrschaft auf den religiösen Alltag, der rechtliche Rahmen und die Beziehungen zwischen Grundherren und Bauern sowie die karolingische Renaissance und deren Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Der Text hinterfragt die gängige Vorstellung einer universellen Prägung des ländlichen Alltags durch die Grundherrschaft.
Welche Quellen werden verwendet?
Der Text erwähnt explizit das „Capitulare de villis et curtis imperialibus“ und die Hofbeschreibung von Rommersheim aus dem Prümer Urbar als Quellen, um die theoretischen Überlegungen mit der Praxis zu vergleichen. Die Herausforderungen der Quelleninterpretation und die Schwierigkeit, den ländlichen Alltag im Frühmittelalter umfassend zu rekonstruieren, werden hervorgehoben.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage betrifft die Bedeutung der karolingischen Grundherrschaft für den ländlichen Alltag im ausgehenden 8. und 9. Jahrhundert. Es wird hinterfragt, ob diese Form der Grundherrschaft den Alltag in einem universellen Ausmaß prägte und ob zu dieser Zeit bereits ein einheitlicher „Bauernstand“ existierte.
Welche Aspekte der Grundherrschaft werden besonders untersucht?
Der Text untersucht die Grundherrschaft aus verschiedenen Perspektiven: als Organisationsform (mit Fokus auf Villa, Familia und Mansus), als agrarische Wirtschaftsform (inkl. technischer Innovationen), als Kultgemeinschaft (Verchristlichungsprozesse) und als rechtlicher Rahmen (Schutz, Schirm, Konflikte, Immunität).
Was ist das Fazit (so weit im Preview ersichtlich)?
Das Fazit ist im vorliegenden Preview nicht vollständig enthalten. Es wird jedoch angedeutet, dass die Arbeit die Komplexität der karolingischen Grundherrschaft und deren Auswirkungen auf den ländlichen Alltag beleuchtet und gängige Vorstellungen hinterfragt.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist aufgrund seines wissenschaftlichen Ansatzes und der detaillierten Analyse primär für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich mit dem Frühmittelalter, der karolingischen Geschichte und der ländlichen Sozialstruktur beschäftigt.
- Quote paper
- Claudia Scheel (Author), 2007, Hufenbauer der "klassischen" karolingischen Grundherrschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79131