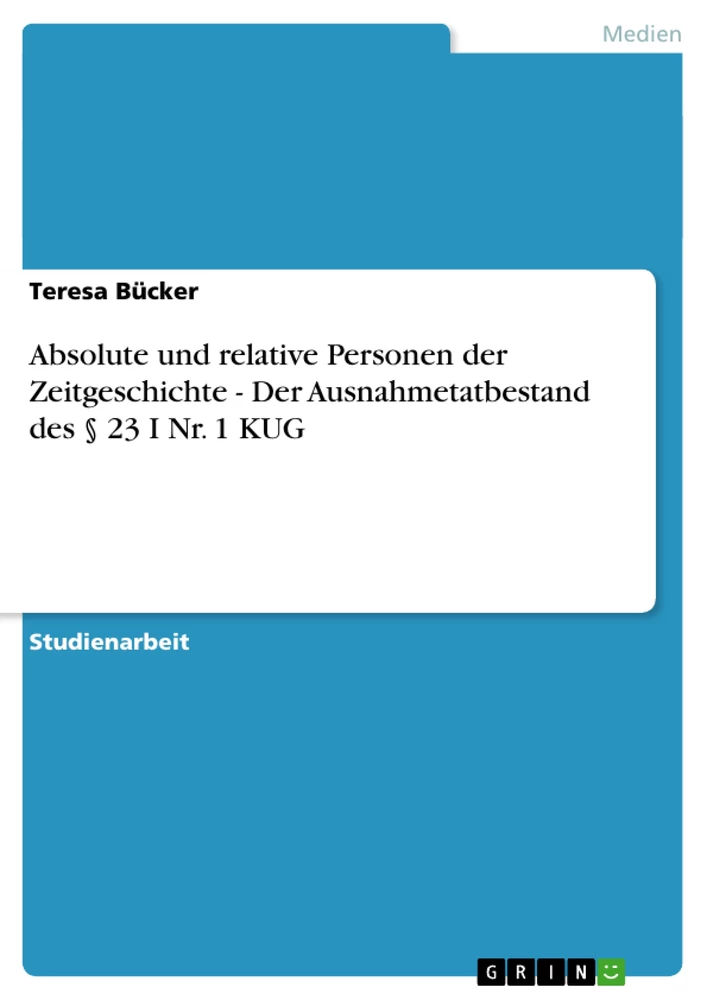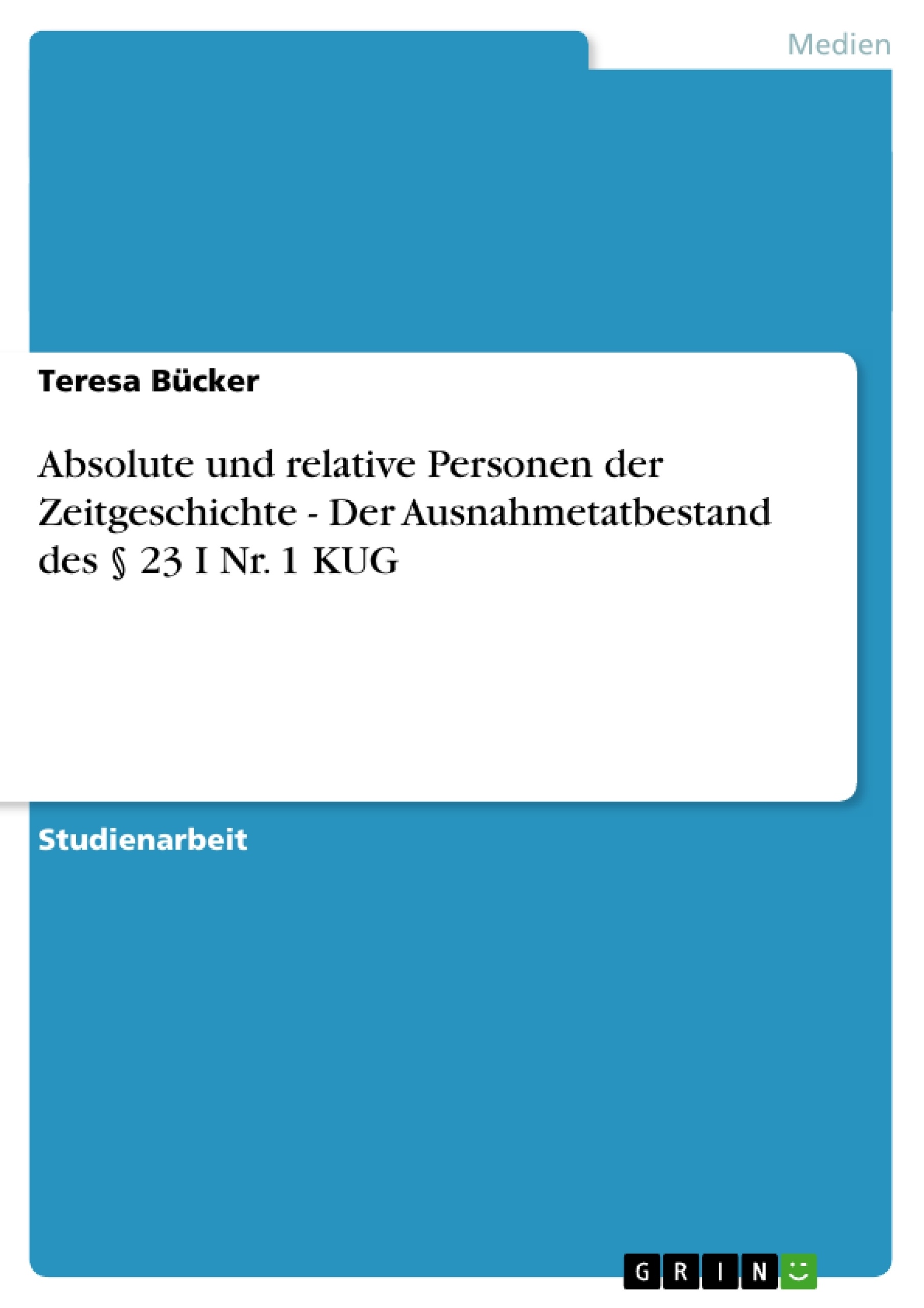Die Präferenzen der deutschen Zeitungsleser sind klar: Wer einen Blick auf die auflagenstärkste Tageszeitung in Deutschland wirft, sieht schnell, dass hier Bilder dominieren, und nicht der Text. Die Bild-Zeitung, lebt wortwörtlich vom Bildjournalismus. Information durch Bilder hat in der Entwicklung der modernen Informationsgesellschaft nicht nur durch den technischen Fortschritt stetig an Bedeutung gewonnen. Kaum eine Zeitung verzichtet darauf, ihre Titelseite durch die Gestaltung mit Fotos für den potenziellen Leser attraktiver zu machen. Der Wettbewerb um Motive ist groß. Während überregionale Tageszeitungen mit Akademiker-Klientel ausreichenden Erfolg verzeichnen zu können, wenn ihre Bildgestaltung hauptsächlich auf Politik, Gesellschaft und Sport zurückgreift, ist der Schwerpunkt der Boulevard-Zeitungen anders. Der Leser möchte Menschen sehen – egal ob Prominenz, Politiker oder einfache Bürger. Was zählt ist die Geschichte, oder das Schicksal, durch Bilder lebendig in Szene gesetzt. Die Vorgehensweise von Fotografen, Bildjournalisten oder deren besonders hartnäckigen Variante, den Paparazzi, ist schon lange umstritten. Die Bild-Zeitung verschärfte durch eine neue Rubrik die Situation für alle begehrten Fotoobjekte sogar noch weiter und sorgte in den letzten Wochen mit einer Leserreporter-Aktion für Furore unter Journalisten, Medienrechtlern und Prominenten. Die Aktion ist ein eindeutiges Bekenntnis zur enormen Bedeutung des Bildes für die BILD: Das Boulevard-Blatt druckt derzeit Schnappschüsse ab, die Leser mit ihrem Fotohandy knipsen und zahlt bis zu 500 Euro dafür. Dank der hohen Beteiligung der Leser steht der BILD somit ein Netzwerk von billigen Aushilfsjournalisten zur Verfügung, die vermutlich weniger als eine vage Ahnung davon haben, auf welch juristisch heikles Terrain sie sich begeben. Doch dies ist nur die eine Seite der Medaille. Während die Leserreporter eigens zur Verantwortung gezogen werden können , hat die belästigende Beobachtung prominenter Personen sich verschärft, und die Zahl ihrer „journalistischen“ Verfolger vervielfacht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung in die Thematik
- 2. Das Recht am eigenen Bild nach dem KUG
- 2.1 Das Recht am eigenen Bild nach § 22 KUG
- 2.2 Die Ausnahmen vom Bildnisschutz nach § 23 KUG
- 2.3 Der Bildnis-Begriff
- 2.4 Die Bedeutung des Begriffs Zeitgeschichte
- 2.5 Zeitgeschehen und Öffentlichkeit - Das legitime Informationsinteresse
- 3. Die Person der Zeitgeschichte
- 3.1 Die Begriffseinführung durch Neumann-Duesberg
- 3.2 Die absolute Person der Zeitgeschichte
- 3.3 Relative Personen der Zeitgeschichte
- 3.4 Begleitpersonenrechtsprechung: Ein Sonderproblem
- 3.5 Kritik am Begriff der Person der Zeitgeschichte (Beuthien)
- 4. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Recht am eigenen Bild im Kontext des Kunsturhebergesetzes (KUG), §§ 22 und 23, mit besonderem Fokus auf die Rechtsfiguren der absoluten und relativen Personen der Zeitgeschichte. Ziel ist es, die Kriterien und Voraussetzungen für die zulässige Abbildung von Personen im Journalismus zu klären und die bestehenden rechtlichen Grauzonen zu beleuchten.
- Recht am eigenen Bild nach KUG
- Ausnahmen vom Bildnisschutz nach § 23 KUG
- Begriff der Person der Zeitgeschichte (absolut und relativ)
- Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und öffentlichem Informationsinteresse
- Kritik an der Rechtsprechung zum Thema
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung in die Thematik: Die Einleitung beleuchtet die dominante Rolle von Bildern im modernen Journalismus, insbesondere im Boulevardjournalismus, und die damit verbundenen rechtlichen Herausforderungen. Sie führt in die Problematik der Bildberichterstattung ein, wobei die Praxis der Bild-Zeitung mit ihrer Leserreporter-Aktion als Beispiel für die Spannungen zwischen Pressefreiheit und Persönlichkeitsrechten dient. Die Schwierigkeit, Rechtsverletzungen durch Bildberichterstattung eindeutig zu identifizieren und die unzureichende Klärung durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht und den Pressekodex werden hervorgehoben.
2. Das Recht am eigenen Bild nach dem KUG: Dieses Kapitel analysiert das Recht am eigenen Bild gemäß § 22 KUG und die Ausnahmen nach § 23 KUG. Es definiert den Bildnisbegriff und untersucht die Bedeutung des Begriffs "Zeitgeschichte" im Kontext des Bildnisschutzes. Ein Schwerpunkt liegt auf der Abwägung zwischen dem legitimen Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem Persönlichkeitsrecht der abgebildeten Personen. Die Kapitel untersuchen kritische Aspekte der Rechtsprechung, insbesondere in Bezug auf die kommerzielle Ausnutzung von Bildnissen.
3. Die Person der Zeitgeschichte: Das Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Begriff der "Person der Zeitgeschichte", wie er von Neumann-Duesberg eingeführt wurde. Es differenziert zwischen absoluten und relativen Personen der Zeitgeschichte und analysiert die damit verbundene Rechtsprechung, einschließlich der Problematik der "Begleitpersonen". Der Abschnitt schließt mit einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Konzept der Person der Zeitgeschichte nach Beuthien ab, und bewertet die Stärken und Schwächen des juristischen Ansatzes.
Schlüsselwörter
Recht am eigenen Bild, § 22 KUG, § 23 KUG, Person der Zeitgeschichte, absoluter Bildnisschutz, relativer Bildnisschutz, Pressefreiheit, Persönlichkeitsrecht, öffentliches Informationsinteresse, Bildjournalismus, Boulevardpresse, Paparazzi, Medienrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Recht am eigenen Bild im Kontext des Kunsturhebergesetzes (KUG)
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über das Recht am eigenen Bild im Kontext des deutschen Kunsturhebergesetzes (KUG), §§ 22 und 23. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Rechtsfigur der "Person der Zeitgeschichte" (absolut und relativ) und der Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und öffentlichem Informationsinteresse.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Kernfragen: Das Recht am eigenen Bild nach § 22 KUG, die Ausnahmen vom Bildnisschutz nach § 23 KUG, den Begriff der "Person der Zeitgeschichte" (inkl. absoluter und relativer Personen sowie der Problematik von Begleitpersonen), die Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und öffentlichem Informationsinteresse, sowie die Kritik an der bestehenden Rechtsprechung. Es wird auch die Rolle von Bildern im modernen Journalismus, insbesondere im Boulevardjournalismus, beleuchtet.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Ziel ist es, die Kriterien und Voraussetzungen für die zulässige Abbildung von Personen im Journalismus zu klären und die bestehenden rechtlichen Grauzonen im Kontext des Rechts am eigenen Bild und des KUG zu beleuchten. Es geht darum, die Abwägung zwischen Pressefreiheit und Persönlichkeitsrechten zu analysieren.
Welche Kapitel umfasst das Dokument und worum geht es in ihnen?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Problematik der Bildberichterstattung und die Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen Pressefreiheit und Persönlichkeitsrechten. Kapitel 2 (Recht am eigenen Bild nach KUG): Analyse von § 22 und § 23 KUG, Definition des Bildnisbegriffs und Abwägung des Informationsinteresses mit dem Persönlichkeitsrecht. Kapitel 3 (Person der Zeitgeschichte): Ausführliche Betrachtung des Begriffs "Person der Zeitgeschichte" nach Neumann-Duesberg, Unterscheidung zwischen absoluten und relativen Personen und kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept nach Beuthien. Kapitel 4 (Zusammenfassung und Ausblick): Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick auf weitere Forschungsfragen.
Was sind die wichtigsten Schlüsselwörter?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Recht am eigenen Bild, § 22 KUG, § 23 KUG, Person der Zeitgeschichte, absoluter Bildnisschutz, relativer Bildnisschutz, Pressefreiheit, Persönlichkeitsrecht, öffentliches Informationsinteresse, Bildjournalismus, Boulevardpresse, Paparazzi, Medienrecht.
Wer ist die Zielgruppe dieses Dokuments?
Das Dokument richtet sich an Personen, die sich akademisch mit dem Recht am eigenen Bild, dem Medienrecht und dem Kunsturhebergesetz auseinandersetzen möchten. Es ist insbesondere für Studierende der Rechtswissenschaften, Journalisten und Medienwissenschaftler relevant.
Welche Rechtsquellen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument befasst sich primär mit den §§ 22 und 23 des Kunsturhebergesetzes (KUG) und der damit verbundenen Rechtsprechung. Es werden auch allgemeine Prinzipien des Persönlichkeitsrechts und der Pressefreiheit berücksichtigt.
- Quote paper
- Teresa Bücker (Author), 2006, Absolute und relative Personen der Zeitgeschichte - Der Ausnahmetatbestand des § 23 I Nr. 1 KUG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79091