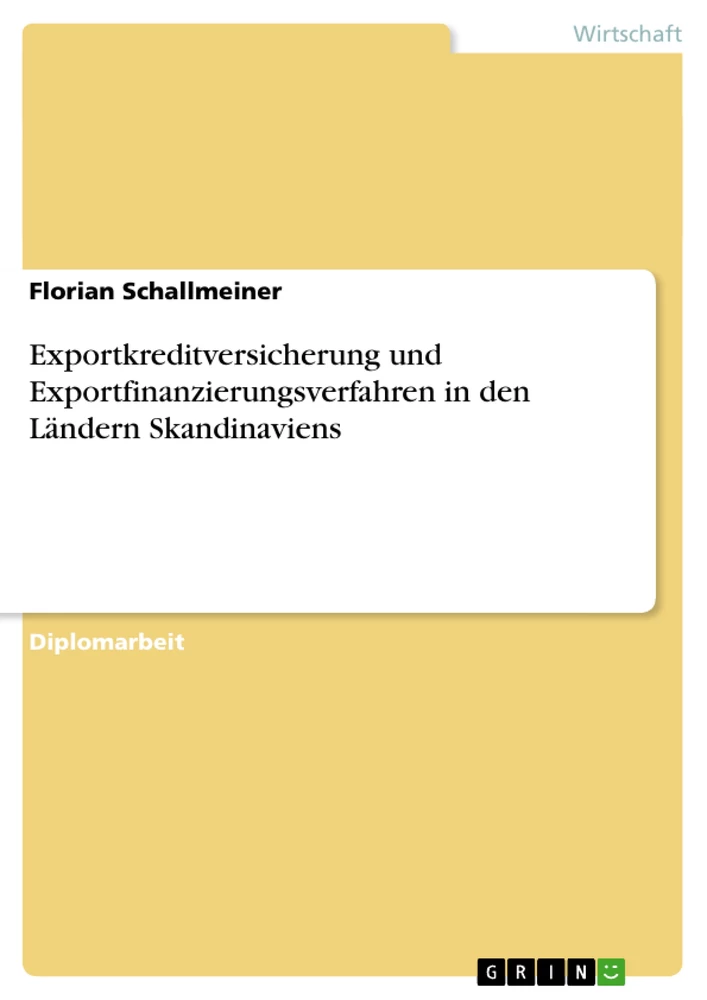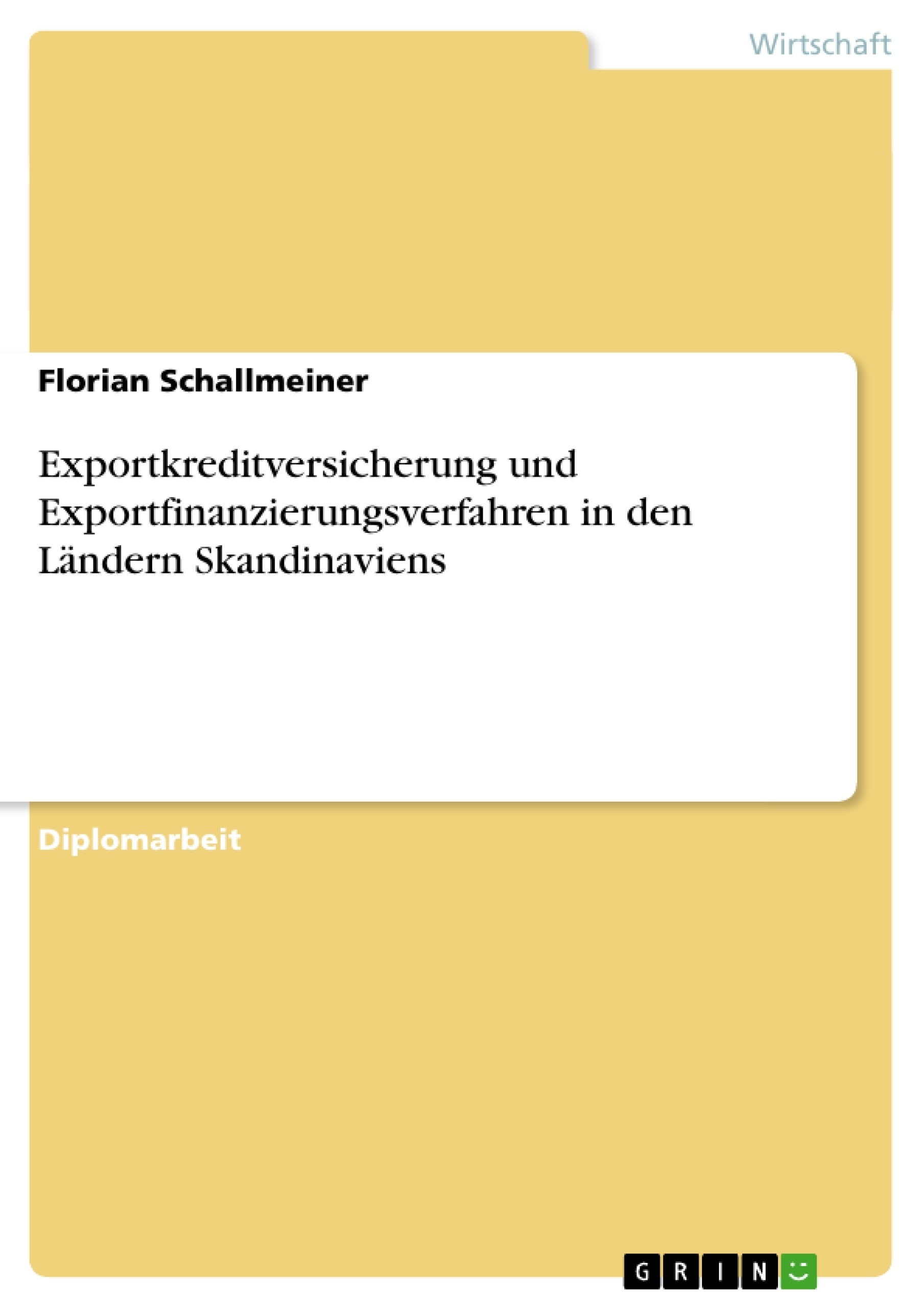Finanzierungs- und Absicherungsmöglichkeiten stellen notwendige Voraussetzungen für Exportgeschäfte dar. Ohne ausländischen Partnern eine Finanzierung anzubieten, wäre es nur schwer möglich, zu bestehen. Da der Exporteur in den seltensten Fällen selbst für die Finanzierung sorgen kann, erfolgt diese meist über Dritte. Daher ist die Kenntnis der Methoden der Risikofinanzierung für den wirtschaftlichen Erfolg des Exportgeschäfts unabdingbar. Oft können oder wollen private Risikoversicherer und -kapitalgeber auf Grund der Risikosituation Kredite und Garantien zu kommerziellen Bedingungen bereitstellen. In solchen Fällen erfolgt ein Eingreifen staatlicher Spezialinstitutionen. Gegenwärtig verfügt jeder Mitgliedstaat der OECD über derartige Institutionen.
Diese setzen Exportkreditgarantien und -finanzierung, welche dem Exporteur, dem Importeur oder anderen Beteiligten zur Verfügung gestellt werden ein. Auf Grund der Einbindung staatlicher Institutionen in die Finanzierung oder Versicherung von Exportgeschäften sind im Regelfall Subventionselemente enthalten. Da der Einsatz von Beihilfen zu Wettbewerbsverzerrungen führen kann, wurden multilaterale Regelungen und Beschränkungen zur Eindämmung und Harmonisierung der offiziellen Förderpolitik getroffen. Diese haben das Ziel, einer Ausweitung derartiger Handelpraktiken entgegenwirken und einen Subventionswettbewerb zu unterbinden, da oftmals das Förderungsausmaß für den Erfolg einer Exporttransaktion ausschlaggebend zu sein scheint.
Im Rahmen der Arbeit werden die Fördermaßnahmen der Länder Finnland, Dänemark, Schweden und Norwegen dargestellt. Darauf basierend sollen die Unterschiede dieser Länder hervorgehoben werden.
Die Länder eignen sich deshalb für eine Analyse, da sie einerseits offene und in vielerlei Hinsicht homogene Volkswirtschaften sind. Ein Beispiel für die intensive Zusammenarbeit aus wirtschaftlicher Sicht kommt durch die „nordische Kooperation“ zum Ausdruck. Andererseits sind diese Länder aber auch Konkurrenten im globalen Wettbewerb um Exportanteile, und somit angehalten, ihre nationalen Exportunternehmen für den Wettbewerb zu rüsten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. RISIKOABSICHERUNG UND VERFAHRENSMÄẞIGE FINANZIERUNG IM EXPORT
- 2.1 Exportmotive und Exportbarrieren
- 2.2 Risiken im Außenhandel
- 2.2.1 Risikomanagement
- 2.2.2 Kommerzielle Risiken und politische Risiken
- 2.2.3 Marktfähige und nicht-marktfähige Risiken
- 2.3 Offiziell unterstützte Exportförderung
- 2.3.1 Der Begriff „Exportförderung“
- 2.3.2 Arten der Exportförderung
- 2.3.2.1 Funktionelle Exportförderung
- 2.3.2.2 Finanzielle Exportförderung
- 2.4 Pure Cover versus Finanzierung
- 2.4.1 Ausfuhrgarantien
- 2.4.2 Ausfuhrfinanzierung
- 2.4.2.1 Finanzierungsbedarf im Außenhandel
- 2.4.2.2 Kurzfristige Außenhandelsfinanzierung
- 2.4.2.3 Mittel- und langfristige Außenhandelsfinanzierung
- 2.4.3 Verhältnis offizieller und privater Exportförderung
- 2.5 Internationale Rechtsgrundlagen
- 2.5.1 International Credit Insurance & Surety Association und Berner Union
- 2.5.2 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
- 2.5.2.1 Mitglieder und Ziele
- 2.5.2.2 OECD-Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits
- 2.5.3 Europäische Union
- 2.5.3.1 EU-Mitteilung zur kurzfristigen Exportkreditversicherung
- 2.5.3.2 EU-Richtlinie zu mittel- und langfristigen Geschäften
- 2.5.3.3 Konsultationsverfahren der Europäischen Union
- 2.5.4 Welthandelsorganisation
- 2.5.4.1 Der Subventionskodex von 1979
- 2.5.4.2 Die gegenwärtige Subventionsordnung der WTO
- 2.5.4.3 Definition der Subvention, der Spezifizität und Nicht-Spezifizität
- 2.5.4.4 Das Ampelverfahren
- 2.5.4.5 Vorgehensweise bei Vertragsverletzungen
- 2.5.4.6 Ausnahmen für Entwicklungs- und Transformationsländer
- 3. LÄNDERANALYSE
- 3.1 Die nordische Finanzgruppe
- 3.1.1 Die nordische Investitionsbank
- 3.1.2 Der nordische Entwicklungsfonds
- 3.1.3 Die nordische Umweltfinanzierungsgesellschaft
- 3.1.4 Der nordische Projektfonds
- 3.2 Finnland
- 3.2.1 Länderprofil
- 3.2.2 Staatliche Exportförderung
- 3.2.2.1 Finnvera
- 3.2.2.2 Finnish Export Credit
- 3.2.2.3 Sitra und Tekes
- 3.2.3 Projektfinanzierung
- 3.2.3.1 Sampo Gruppe
- 3.2.3.2 Finnfund
- 3.2.4 Privatinstitutionen
- 3.2.4.1 Euler Hermes
- 3.2.4.2 Atradius
- 3.2.5 Zusammenfassung Finnland
- 3.3 Dänemark
- 3.3.1 Länderprofil
- 3.3.2 Staatliche Exportförderung
- 3.3.2.1 Eksport Kredit Fonden
- 3.3.2.2 Danida
- 3.3.3 Projektfinanzierung
- 3.3.4 Privatinstitutionen
- 3.3.4.1 Atradius
- 3.3.4.2 Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab
- 3.3.4.3 Zusammenfassung Dänemark
- 3.4 Schweden
- 3.4.1 Länderprofil
- 3.4.2 Staatliche Exportförderung
- 3.4.2.1 Exportkreditnämden
- 3.4.2.2 Swedish Export Credit Corporation
- 3.4.2.3 Sida
- 3.4.2.4 Swedfund
- 3.4.3 Projektfinanzierung
- 3.4.4 Privatinstitutionen
- 3.4.4.1 Euler Hermes Nordic
- 3.4.4.2 Atradius
- 3.4.5 Zusammenfassung
- 3.5 Norwegen
- 3.5.1 Länderprofil
- 3.5.2 Staatliche Exportförderung
- 3.5.2.1 Garantie-Instituttet for Eksportkreditt
- 3.5.2.2 GIEK Kredittforsikring AS
- 3.5.2.3 Eksportfinans
- 3.5.2.4 Norad
- 3.5.2.5 Innovation Norway
- 3.5.3 Projektfinanzierung
- 3.5.4 Privatinstitutionen
- 3.5.4.1 Atradius
- 3.5.5 Zusammenfassung
- Exportkreditversicherungs- und Exportfinanzierungsverfahren in Skandinavien
- Staatliche und private Exportförderung
- Länderspezifische Unterschiede in den Exportförderungssystemen
- Rechtsgrundlagen der Exportförderung
- Internationale Kooperation und Harmonisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit den Exportkreditversicherungs- und Exportfinanzierungsverfahren in den Ländern Skandinaviens. Sie untersucht die unterschiedlichen Modelle der staatlichen und privaten Exportförderung in den vier skandinavischen Ländern Finnland, Dänemark, Schweden und Norwegen. Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Bild der skandinavischen Exportförderungssysteme zu zeichnen und deren Besonderheiten herauszustellen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Arbeit führt in die Thematik ein und erläutert die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit. Es bietet zudem einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
Im zweiten Kapitel werden die grundlegenden Aspekte der Risikoabsicherung und Finanzierung im Export erläutert. Es werden die Exportmotive und Exportbarrieren, die Risiken im Außenhandel, die verschiedenen Arten der Exportförderung und die internationalen Rechtsgrundlagen behandelt.
Das dritte Kapitel widmet sich der Länderanalyse. Es stellt die vier skandinavischen Länder Finnland, Dänemark, Schweden und Norwegen mit ihren jeweiligen Exportförderungssystemen vor. Es werden die staatlichen und privaten Exportkreditversicherungen, Exportkreditagenturen, Projektfinanzierungsinstitutionen und andere relevante Organisationen in jedem Land detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Exportkreditversicherung, Exportfinanzierung, staatliche Exportförderung, private Exportförderung, Skandinavien, Finnland, Dänemark, Schweden, Norwegen, internationale Rechtsgrundlagen, OECD-Arrangement, EU-Richtlinien, WTO-Subventionskodex.
- Citation du texte
- Magister Florian Schallmeiner (Auteur), 2005, Exportkreditversicherung und Exportfinanzierungsverfahren in den Ländern Skandinaviens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79061