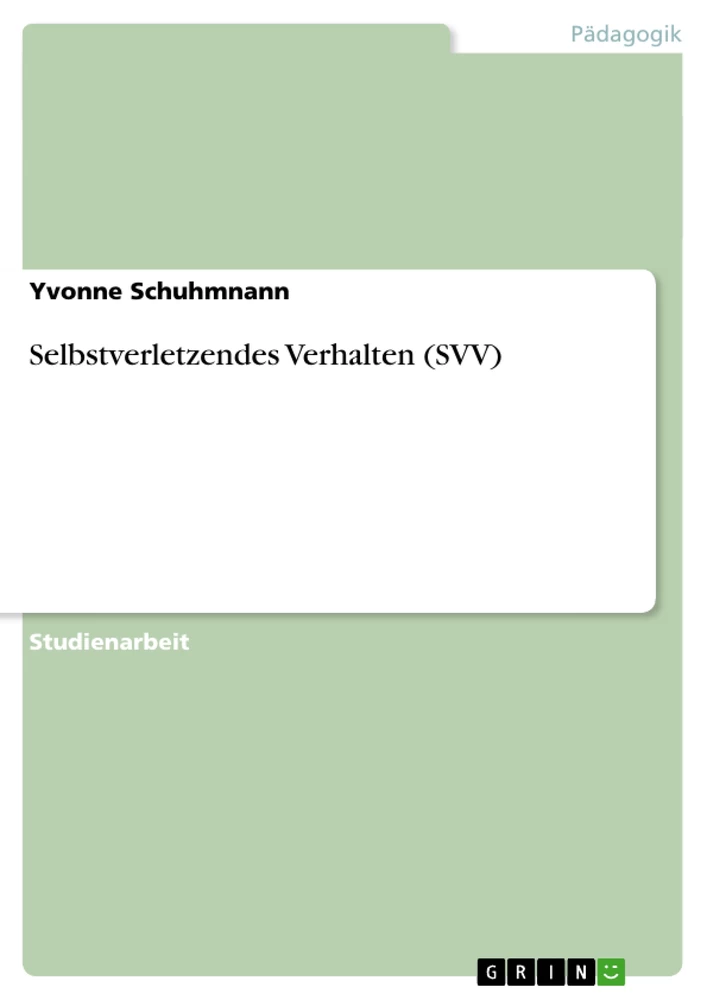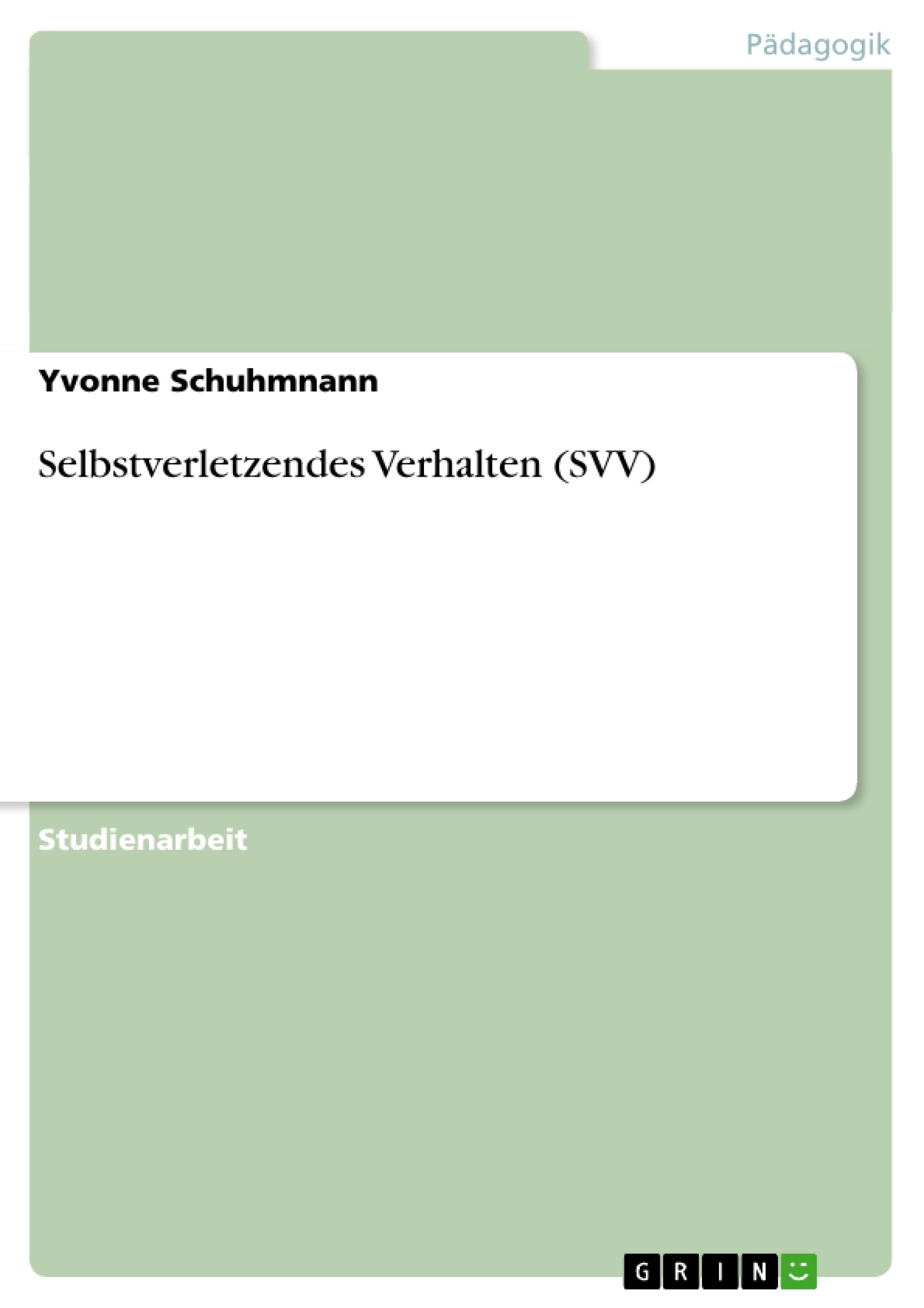Selbstverletzendes Verhalten gehört wohl zu den erschreckendsten Verhaltensweisen, insbesondere dann, wenn dies bei Kindern und Jugendlichen auftritt. Solch ein Verhalten löst in der Umwelt Befremden, Entsetzen, Unverständnis und Ohnmacht, aber gleichzeitig auch Mitgefühl, Erbarmen, Ablehnung sowie Verurteilung und Distanzierung aus (vgl. Klosinski 1999, S.10). In unserer Gesellschaft haben Aggressionen nur wenig Raum, sie müssen unterdrückt oder in anderen Handlungen sublimiert werden. Selbstverletzungen werden überwiegend heimlich, im "stillen Kämmerlein", vollzogen. Aufgrund dessen gibt es nur wenig gesicherte Daten über Auftretenshäufigkeit und die Verteilung. Jedoch wird in der Literatur immer wieder die signifikante Häufigkeit bei Mädchen bzw. Frauen erwähnt (vgl. Schmeißer 2000, S.7).
In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich mit dem Thema "Selbstverletzendes Verhalten" beschäftigen. Dabei möchte ich Antworten auf folgende Fragen finden: Was versteht man unter selbstverletzendem Verhalten und welche Erscheinungsformen gibt es? Warum zeigen überwiegend weibliche Personen solch ein Verhalten? Welche Ursachen und Bedeutungen könnten Selbstverletzungen haben?
Zur Erarbeitung habe ich mich hauptsächlich auf das Buch von S. Schmeißer "Selbstverletzung, Symptome, Ursachen, Behandlung" gestützt. Zur Ergänzung meiner Aufzeichnungen verwendete ich Literatur von Teuber, Klosinski und anderen (siehe Literaturliste).
Zunächst werde ich versuchen selbstverletzendes Verhalten zu definieren, und die verschiedenen Formen von Selbstverletzung beschreiben. Im Weiteren werde ich auf die Auftretenshäufigkeit und auf die Verteilung selbstverletzenden Verhaltens zu sprechen kommen. Dann werde ich auf die Frage eingehen, welche Ursachen und Erfahrungshintergründe selbstverletzenden Verhaltens zu Grunde liegen könnten. Zum Schluss möchte ich noch kurz auf Funktion und Therapiemöglichkeiten eingehen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung
- 3. Erscheinungsformen selbstverletzenden Verhaltens
- 3.1. Die offene Selbstverletzung
- 3.2. Die artifiziellen Erkrankungen
- 3.2.1. Die artifizielle Krankheit
- 3.2.2. Das Münchhausen-Syndrom oder die chronisch-artifizielle Erkrankung
- 3.2.3. Das erweiterte Münchhausen-Syndrom
- 4. Auftretenshäufigkeit und Verteilung selbstverletzenden Verhaltens
- 5. Erklärungsmodelle und Erfahrungshintergründe
- 5.1. Erklärungsmodelle
- 5.1.1. Biologischer Erklärungsansatz
- 5.1.2. Lerntheoretischer Erklärungsansatz
- 5.2. Störungen in der Kindheit
- 5.2.1. Deprivation
- 5.2.2. Körperliche Misshandlung
- 5.2.3. Sexueller Missbrauch
- 5.1. Erklärungsmodelle
- 6. Funktionen selbstverletzenden Verhaltens
- 7. Therapie
- 7.1. Psychoanalytisch-orientierte Therapie
- 7.2. Begleittherapien
- 8. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht selbstverletzendes Verhalten (SVV) bei Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, SVV zu definieren, verschiedene Erscheinungsformen zu beschreiben und mögliche Ursachen sowie die Bedeutung dieses Verhaltens zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet auch die Häufigkeit von SVV und skizziert Therapieansätze.
- Definition und Erscheinungsformen von selbstverletzendem Verhalten
- Häufigkeit und Verteilung von SVV
- Mögliche Ursachen und Erfahrungshintergründe von SVV
- Funktionen von SVV
- Therapieansätze bei SVV
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema selbstverletzendes Verhalten (SVV) ein und beschreibt die damit verbundenen Reaktionen in der Gesellschaft. Sie benennt die Forschungsfragen der Arbeit: Was ist SVV, welche Erscheinungsformen gibt es, warum tritt es überwiegend bei Frauen auf, und welche Ursachen und Bedeutungen hat es? Die Arbeit stützt sich hauptsächlich auf das Buch von S. Schmeißer und ergänzende Literatur. Es wird der Aufbau der Arbeit skizziert, der die Definition von SVV, die Beschreibung verschiedener Formen, die Häufigkeit und Verteilung, die Ursachen und Erfahrungshintergründe sowie die Funktionen und Therapieoptionen umfasst.
2. Begriffsklärung: Dieses Kapitel befasst sich mit der vielschichtigen Definition von selbstverletzendem Verhalten. Es werden verschiedene, in der Literatur verwendete Begriffe wie Automutilation, Autoaggression und Selbstbeschädigung erläutert und ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Die Uneinheitlichkeit in der Definition wird hervorgehoben, wobei die Meinungen von verschiedenen Experten wie Törne, Nissen, Schmeißer und Klosinski gegenübergestellt werden. Die verschiedenen Autoren bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Definition und Einordnung von SVV, von Kommunikationsproblemen bis hin zu ungeleiteten aggressiven Handlungen. Die Klassifizierung nach Schweregrad (leicht, mittel, schwer) wird anhand von Beispielen illustriert.
Schlüsselwörter
Selbstverletzendes Verhalten, Automutilation, Autoaggression, Selbstbeschädigung, Ursachen, Erscheinungsformen, Häufigkeit, Verteilung, Therapie, Erklärungsmodelle, Kindheit, Misshandlung, Deprivation, Sexueller Missbrauch.
Häufig gestellte Fragen zu "Selbstverletzendes Verhalten bei Kindern und Jugendlichen"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über selbstverletzendes Verhalten (SVV) bei Kindern und Jugendlichen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Die Arbeit beleuchtet Definition, Erscheinungsformen, Häufigkeit, Ursachen, Funktionen und Therapieansätze von SVV.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Definition und Begriffsklärung von selbstverletzendem Verhalten (inkl. Automutilation, Autoaggression, Selbstbeschädigung), verschiedene Erscheinungsformen (z.B. offene Selbstverletzung, artifizielle Erkrankungen, Münchhausen-Syndrom), Häufigkeit und Verteilung, Erklärungsmodelle (biologisch, lerntheoretisch), Erfahrungshintergründe (Kindheitsstörungen wie Deprivation, körperliche und sexuelle Misshandlung), Funktionen des SVV, und verschiedene Therapieansätze (psychoanalytisch-orientierte Therapie und Begleittherapien).
Welche Arten von Selbstverletzendem Verhalten werden beschrieben?
Das Dokument unterscheidet verschiedene Arten von selbstverletzendem Verhalten, darunter die offene Selbstverletzung und artifizielle Erkrankungen wie die artifizielle Krankheit, das Münchhausen-Syndrom (chronisch-artifizielle Erkrankung) und das erweiterte Münchhausen-Syndrom. Es wird auf die unterschiedlichen Schweregrade eingegangen.
Welche Ursachen und Hintergründe für selbstverletzendes Verhalten werden genannt?
Als mögliche Ursachen und Hintergründe werden biologische und lerntheoretische Erklärungsansätze sowie negative Erfahrungen in der Kindheit, wie Deprivation, körperliche und sexuelle Misshandlung, diskutiert.
Welche Funktionen hat selbstverletzendes Verhalten laut dem Dokument?
Das Dokument beschreibt die Funktionen von selbstverletzendem Verhalten, geht aber nicht detailliert darauf ein. Diese Funktion wird als ein weiterer wichtiger Aspekt der Untersuchung genannt.
Welche Therapieansätze werden vorgestellt?
Es werden psychoanalytisch-orientierte Therapien und Begleittherapien als Therapieansätze bei selbstverletzendem Verhalten skizziert.
Wie ist das Dokument aufgebaut?
Das Dokument ist strukturiert in eine Einleitung, eine Begriffsklärung, Kapitel zu Erscheinungsformen, Häufigkeit, Erklärungsmodellen und Erfahrungshintergründen, Funktionen des SVV, Therapieansätzen und einer Zusammenfassung. Es enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Selbstverletzendes Verhalten, Automutilation, Autoaggression, Selbstbeschädigung, Ursachen, Erscheinungsformen, Häufigkeit, Verteilung, Therapie, Erklärungsmodelle, Kindheit, Misshandlung, Deprivation, Sexueller Missbrauch.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Das Dokument ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen im Bereich selbstverletzenden Verhaltens. Es ist auf die Bedürfnisse von Personen ausgerichtet, die sich wissenschaftlich mit diesem Thema auseinandersetzen.
- Quote paper
- Yvonne Schuhmnann (Author), 2002, Selbstverletzendes Verhalten (SVV), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7899