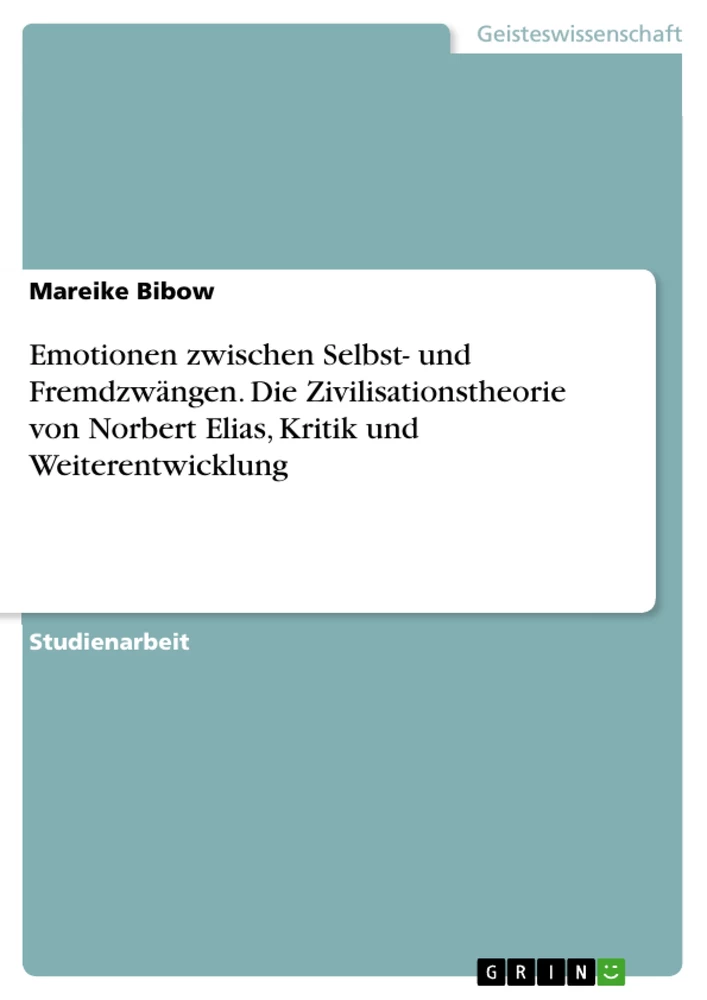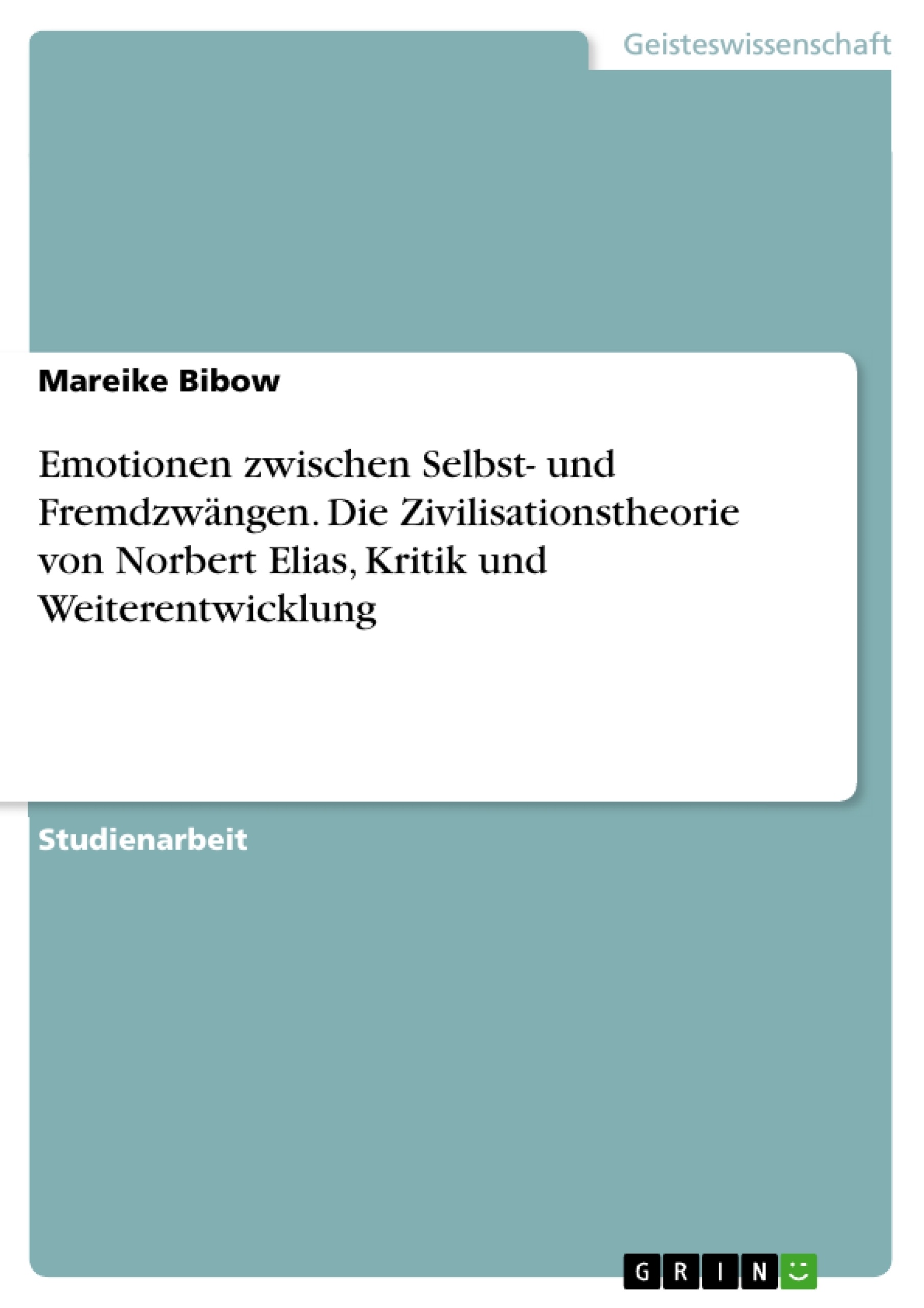Norbert Elias untersuchte in den 1930er Jahren Etikette- bzw. Anstandsbücher aus dem 15. bis zum 19. Jahrhundert und entwickelte daraus sein zum Klassiker avanciertes Werk „Über den Prozess der Zivilisation“. Auf seiner Theorie und Methode aufbauend tat Cas Wouters ab den 70er Jahren dasselbe: Etikettebücher seien vielleicht eine Mischung aus wirklichem und idealem Verhalten, aber auch diese Ideale seien real, so Wouters, und nicht von Sozialwissenschaftlern konstruiert. Dieses Quellenmaterial sollte beweisen, wie sich die psychische Struktur des Menschen im Laufe der Zeit veränderte – an Hand von Verhaltensänderungen in der Gesellschaft. Nach Elias sind Verhaltensregeln Ausdruck sozialer Kontrolle, also der von anderen ausgehenden Zwang zur Selbstkontrolle. In „Über den Prozess der Zivilisation“ versucht Elias, den gesellschaftlichen Übergangsprozess vom mittelalterlichen feudalen System in Westeuropa zum System des französischen absolutistischen Nationalstaats darzustellen. Sein erklärtes Ziel ist dabei, die langfristigen Wandlungsprozesse nicht nur im sozialen Habitus, sondern auch im Denken und Fühlen von Menschengruppen zu erforschen.
Der Ansatz von Elias, Psychogenese und Soziogenese miteinander zu verbinden, den Zusammenhang zwischen der menschlichen Psyche und den Strukturen der menschlichen Gesellschaft zu erforschen, machte sein Werk zu „einer Pionierstudie der Soziologie der Emotionen ohne diesen Namen zu tragen. Die Soziogenese von Scham und Peinlichkeit ist wohl ihr Kernstück. Viel deutlicher als bei den Klassikern Durkheim und Weber wird bei Elias die soziale Grundlegung von Gefühlen behandelt.
Cas Wouters hat diesen Ansatz ebenso verfolgt und steht damit in der Entwicklung eines wachsenden Interesses der Soziologie, Psychologie und Geschichte an Emotionen seit Mitte der 70er Jahre. Er hat sich dabei zunehmend auf das geschlechtsspezifische Verhalten konzentriert. Während Elias jedoch in „Über den Prozess der Zivilisation“ eine fortschreitende Verschärfung der Codes für Verhalten und Gefühle feststellt und damit eine zunehmende „Formalisierung“, widmet sich Wouters der These, im 20. Jahrhundert kam es zur „Informalisierung“, einem Prozess, in dem immer mehr Gefühls- und Verhaltensformen akzeptabel wurden Der Autor diskutiert folglich auch die Frage, ob der Zivilisationsprozess seine Richtung geändert hat.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einblick in die Zivilisationstheorie von Norbert Elias
- Monopolmechanismus und Differenzierung
- Angst und Schamgefühle
- „Verringerung der Kontraste, Vergrößerung der Spielarten“
- Kritik an der Zivilisationstheorie
- Die Frage der „,Triebkontrolle“ und „Affektmodellierung“
- Die Frage nach den gestiegenen Selbstzwängen
- Andere Kritikpunkte an der Zivilisationstheorie
- Weiterentwicklung durch Cas Wouters
- Die Informalisierungsthese
- Weibliche Emanzipation und der westliche Wohlfahrtsstaat
- Formalisierung und Informalisierung: ein Richtungswechsel?
- Schlussfragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Zivilisationstheorie von Norbert Elias und deren Weiterentwicklung durch Cas Wouters. Ziel ist es, den Prozess der Zivilisation im Hinblick auf die Veränderung der psychischen Struktur des Menschen zu analysieren, wobei der Fokus auf die Entwicklung von Verhaltens- und Gefühlsformen im Laufe der Zeit liegt. Dabei werden sowohl die Kritik an der Theorie als auch die Frage nach einer möglichen Umkehr des Zivilisationsprozesses in Richtung „Informalisierung“ im 20. Jahrhundert beleuchtet.
- Der Zivilisationsprozess und die Transformation von Fremd- in Selbstzwänge
- Der Monopolmechanismus und die zunehmende Differenzierung der Gesellschaft
- Die Rolle von Angst und Schamgefühlen im Zivilisationsprozess
- Die Kritik an der Zivilisationstheorie und die Frage nach den gestiegenen Selbstzwängen
- Die Informalisierungsthese von Cas Wouters und die mögliche Umkehr des Zivilisationsprozesses
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Zivilisationstheorie von Norbert Elias vor und hebt die Bedeutung von Etikettebüchern als Quelle für die Analyse von Veränderungen im menschlichen Verhalten und in der psychischen Struktur hervor. Sie führt zudem die Weiterentwicklung der Theorie durch Cas Wouters ein, der die „Informalisierung“ als einen im 20. Jahrhundert einsetzenden Prozess beschreibt.
- Einblick in die Zivilisationstheorie von Norbert Elias: Dieses Kapitel erläutert Elias' Konzept des Zivilisationsprozesses und die Transformation von Fremd- in Selbstzwänge. Der „Monopolmechanismus“ und die zunehmende Differenzierung der Gesellschaft werden als zentrale Faktoren des Zivilisationsprozesses hervorgehoben. Die Bedeutung von Angst und Schamgefühlen in diesem Prozess wird ebenfalls beleuchtet.
- Kritik an der Zivilisationstheorie: Dieses Kapitel widmet sich der Kritik an der Zivilisationstheorie von Elias. Es wird die Frage der „Triebkontrolle“ und „Affektmodellierung“ aufgeworfen und diskutiert, inwiefern die Theorie die gestiegenen Selbstzwänge des Menschen im Zivilisationsprozess ausreichend berücksichtigt. Weitere Kritikpunkte an Elias' Theorie werden ebenfalls vorgestellt.
- Weiterentwicklung durch Cas Wouters: Dieses Kapitel befasst sich mit der Weiterentwicklung der Zivilisationstheorie durch Cas Wouters. Es wird die „Informalisierungsthese“ vorgestellt, die eine Umkehr des Zivilisationsprozesses im 20. Jahrhundert postuliert. Weiterhin werden die Rolle der weiblichen Emanzipation und des westlichen Wohlfahrtsstaates im Kontext der Informalisierung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den zentralen Konzepten der Zivilisationstheorie von Norbert Elias, insbesondere mit der Transformation von Fremd- in Selbstzwänge, dem Monopolmechanismus und der Differenzierung der Gesellschaft, sowie mit der Bedeutung von Angst und Schamgefühlen im Zivilisationsprozess. Des Weiteren wird die Weiterentwicklung der Theorie durch Cas Wouters und seine „Informalisierungsthese“ behandelt.
- Quote paper
- M.A. Mareike Bibow (Author), 2005, Emotionen zwischen Selbst- und Fremdzwängen. Die Zivilisationstheorie von Norbert Elias, Kritik und Weiterentwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78883