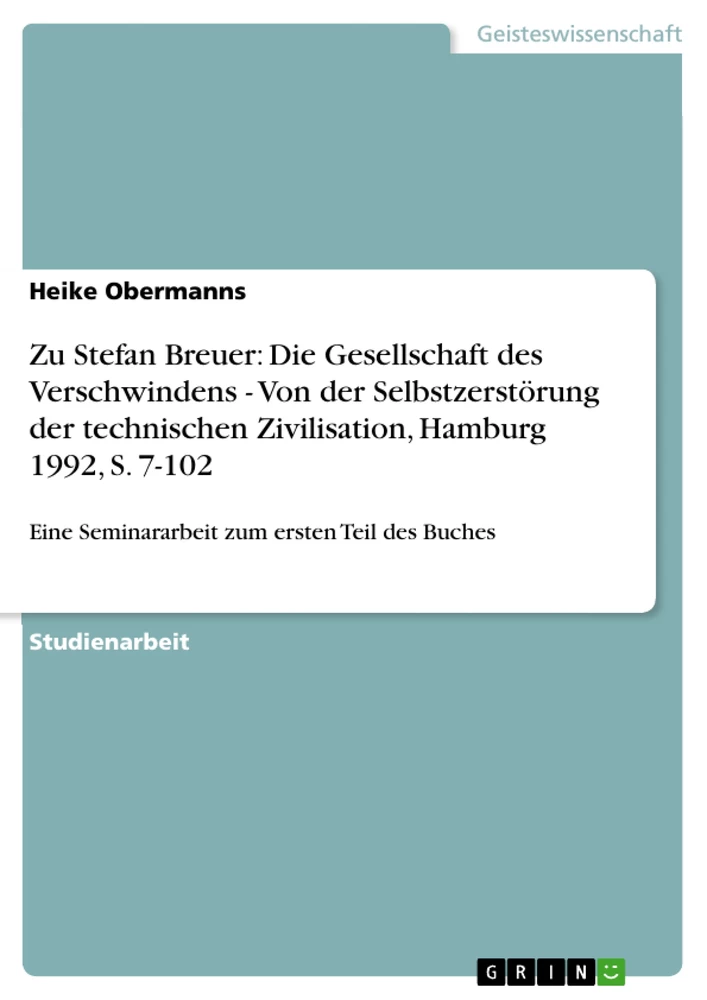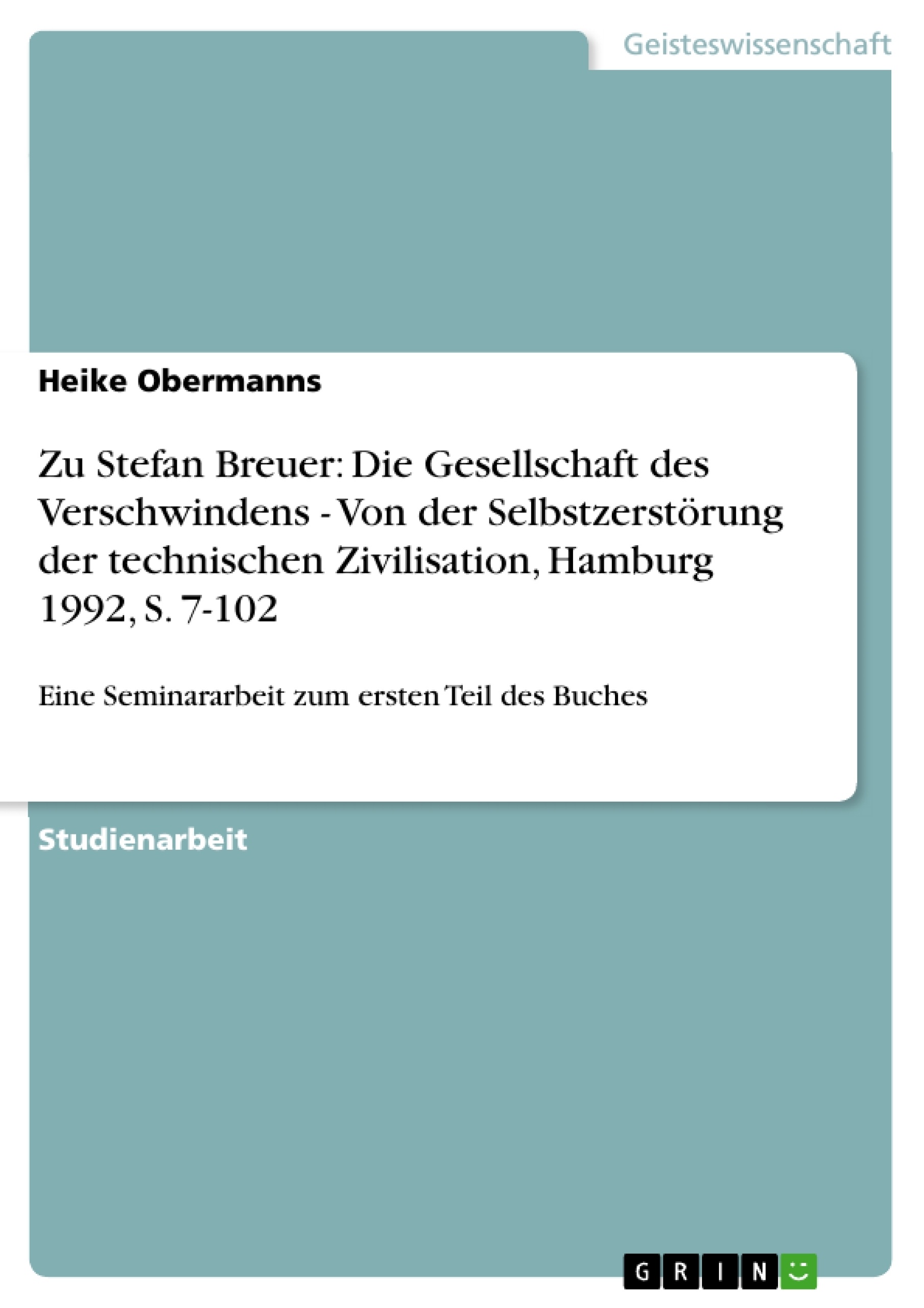In der Einleitung grenzt Breuer sich zunächst scharf gegenüber der Postmoderne ab, um dann seinen gesellschaftstheoretischen Standpunkt ausgehend von der Dialektik Hegels und Marx’ näher auszuführen.
Die durch J.F. Lyotards Buch «Das postmoderne Wissen» initiierte postmoderne Bewegung sieht die moderne Gesellschaft, ebenso wie Breuer, im Zeichen des Verschwindens (S.7), dies aber in einem ganz anderen Sinne. Am Verschwinden ist nach Lyotard die Glaubwürdigkeit der ‹großen Erzählungen›, durch die die neuzeitliche Philosophie, vor allem der deutsche Idealismus und die Aufklärung bis hin zu Marx bis ins 20. Jahrhundert das Welt- und Geistesgeschehen umfassend erklären und prägen wollte. Diese ‹Metaerzählungen› über die Dialektik des Geistes, die Hermeneutik des Sinns und die Emanzipation der Gattung bezeichnet Lyotard als Fabeln, denen heutzutage keine Funktion mehr zukommt. Die Ablehnung der postmodernen Intellektuellen gilt daher aller vereinheitlichenden, universalisierenden und totalisierenden Wissenschaft. Die Entwicklung der Relativitätstheorie und Quantenphysik ist für sie der Beweis, dass der Absolutheitsanspruch der cartesischen mathesis universalis zerbrochen ist, und, so W. Welsch, das Operieren ohne letztes Fundament zur Grundsituation heutiger Wissenschaft wird. Wissenschaft versteht sich demnach insofern als postmodern, als sie sich auf eine bunte Vielfalt von Horizonten, Lebenswelten und Wissensformen stützt und nicht mehr auf die ‹Metaphysik› bzw. auf eine ‹Monokultur›. Wo das Ganze verschwindet, beginnt für die Postmoderne die begrüßenswerte Freisetzung der Teile (S.8).
Hier setzt Breuers Kritik an: Offen bleibt für ihn, welche Art von Pluralität dem neuzeitlichen Absolutheitsanspruch entgegengesetzt werden soll: eine Pluralität, die noch auf Synthetisierung wartet; eine Vielheit, die wie bei Hegel einer Einheit entsprungen ist und daher auch außerhalb dieser bei sich selbst bleibt; oder etwa eine irreduzible Pluralität, die nicht zu homogenisieren ist.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung zur dialektischen Denktradition
- I. Die Einleitung: Totalität und Verschwinden der modernen Gesellschaft
- II. Ist die moderne Gesellschaft zivilisiert? Die Auseinandersetzung mit Norbert Elias
- 1. Zum Inhalt des Buches «Über den Prozess der Zivilisation»
- 2. Kritische Überprüfung der Zivilisationstheorie
- a) Zur soziogenetischen Linie
- b) Zur psychogenetischen Linie
- c) Zur handlungstheoretischen Linie
- 3. Resümee: Die Dialektik der Vergesellschaftung
- III. Wird die moderne Gesellschaft diszipliniert? Die Auseinandersetzung mit Michel Foucault
- 1. Die Macht der Kerker-Netze: Foucaults Theorie
- 2. Die Metaphysik der Macht: Kritik an Foucault
- 3. Verneinung und Bejahung: Festzuhaltende und entdisziplinierende Aspekte
- 4. Entdisziplinierung
- IV. Adorno und Luhmann: Selbstdestruktion oder offene Zukunft der modernen Gesellschaft?
- 1. Totalität und System: Zwei Charakterisierungen der modernen Gesellschaft
- a) Die abstrakte Totalität des Tauschprinzips: Adornos Begriff der bürgerlichen Gesellschaft
- b) Die Autopoiesis der Funktionssysteme: Luhmanns Begriff der modernen Gesellschaft
- 2. Entwicklungstendenzen der modernen Gesellschaft: Selbstzerstörung und Entdifferenzierung
- a) Adorno: Zerstörung durch totale Vermittlung
- b) Luhmann: Folgeprobleme funktionaler Differenzierung
- 3. Konvergenzen und Lernprozesse zwischen beiden Theorien
- a) Revisionen der kritischen Theorie
- b) Nicht konservativ, aber auch nicht kritisch: Kritik an Luhmann
- 1. Totalität und System: Zwei Charakterisierungen der modernen Gesellschaft
- Schlussbemerkung: Luhmann und die Dialektik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit analysiert den ersten Teil von Stefan Breuers Buch "Die Gesellschaft des Verschwindens: Von der Selbstzerstörung der technischen Zivilisation" aus dem Jahr 1992. Sie beschäftigt sich mit Breuers dialektischer Kritik an der modernen Gesellschaft und ihrer Entwicklung. Die Arbeit untersucht insbesondere die Argumentation Breuers, wie die moderne Gesellschaft in ihrer Selbstzerstörung begriffen werden kann und welche Rolle dabei die dialektische Denktradition spielt.
- Die Selbstzerstörung der modernen Gesellschaft
- Die Kritik an der Postmoderne und ihren Konzepten von Pluralität und Dekonstruktion
- Die Rolle der dialektischen Denktradition in Breuers Analyse
- Die Auseinandersetzung mit zentralen soziologischen Denkern wie Norbert Elias, Michel Foucault, Theodor W. Adorno und Niklas Luhmann
- Die Auswirkungen des Kapitalismus und der modernen Produktionsweise auf die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorbemerkung zur dialektischen Denktradition: Breuer stellt seine dialektische Denktradition vor, die auf Hegel und Marx zurückgreift. Er argumentiert, dass die moderne Gesellschaft sich in einem Prozess der Selbstzerstörung befindet, der in einer "dialektischen Entropologie" gipfelt.
- I. Die Einleitung: Totalität und Verschwinden der modernen Gesellschaft: Breuer kritisiert die Postmoderne und ihre Ablehnung von großen Erzählungen. Für ihn ist die Moderne durch eine bestimmte Totalität gekennzeichnet, die sich in der Expansion des Kapitalismus, der Globalisierung und der modernen Wissenschaft zeigt.
- II. Ist die moderne Gesellschaft zivilisiert? Die Auseinandersetzung mit Norbert Elias: Breuer setzt sich kritisch mit Elias' Zivilisationstheorie auseinander und diskutiert deren Schwächen in Bezug auf die moderne Gesellschaft.
- III. Wird die moderne Gesellschaft diszipliniert? Die Auseinandersetzung mit Michel Foucault: Breuer analysiert Foucaults Macht- und Disziplinierungstheorien und hinterfragt deren Relevanz für die heutige Gesellschaft.
- IV. Adorno und Luhmann: Selbstdestruktion oder offene Zukunft der modernen Gesellschaft?: Breuer vergleicht die Theorien von Adorno und Luhmann und untersucht, wie sie die Entwicklung der modernen Gesellschaft und ihre möglichen Folgen betrachten.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: dialektische Denktradition, moderne Gesellschaft, Selbstzerstörung, Postmoderne, Kapitalismus, Globalisierung, Zivilisationstheorie, Macht, Disziplinierung, Totalität, Entropologie, Adorno, Luhmann, Elias, Foucault.
- Quote paper
- Heike Obermanns (Author), 1997, Zu Stefan Breuer: Die Gesellschaft des Verschwindens - Von der Selbstzerstörung der technischen Zivilisation, Hamburg 1992, S. 7-102, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78711