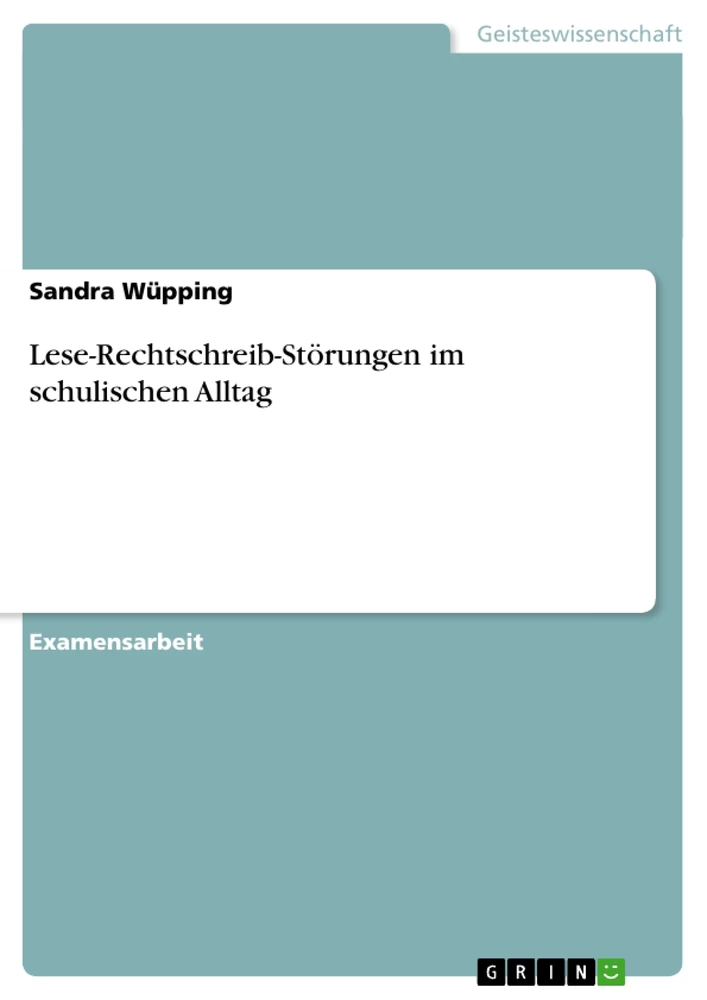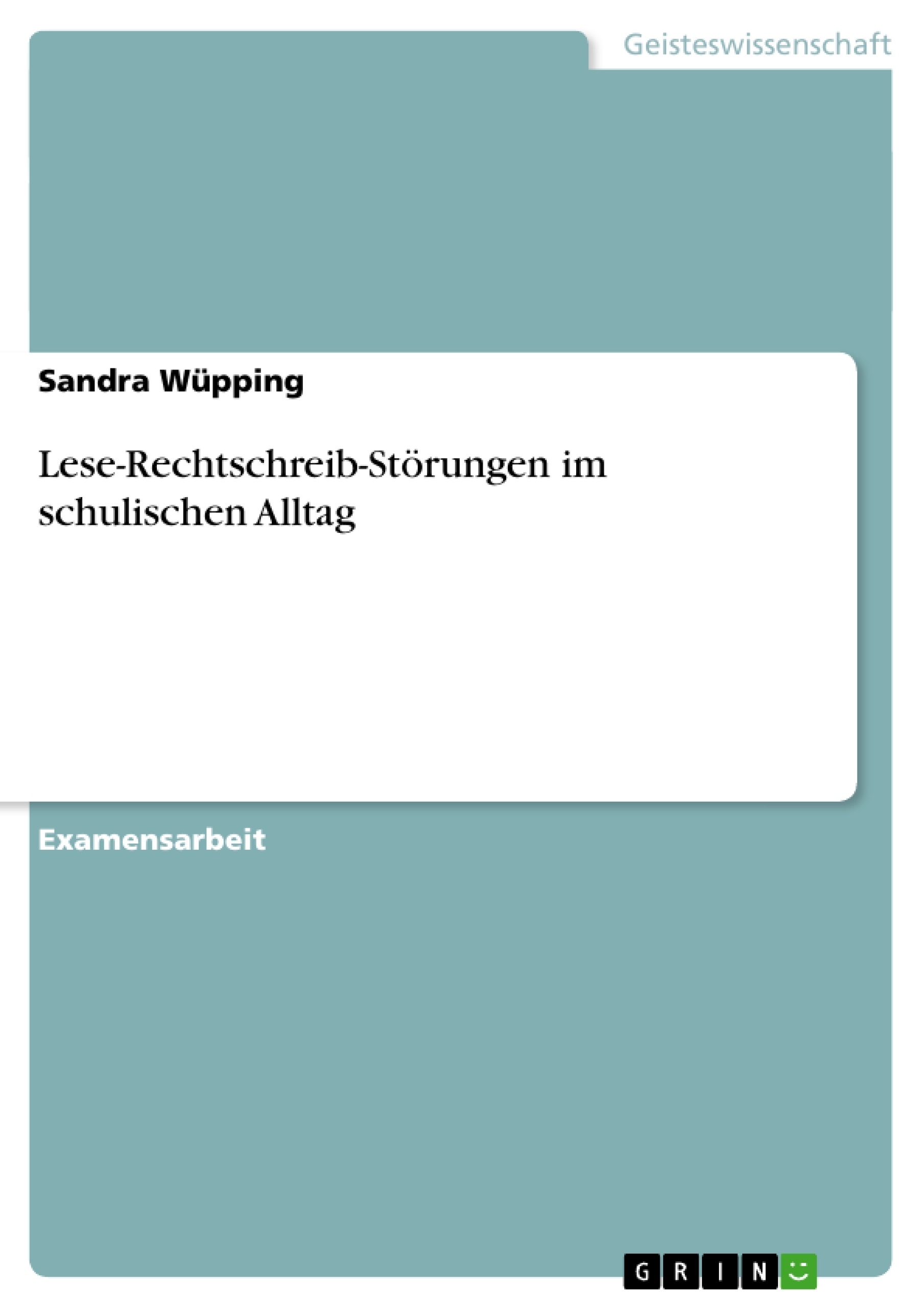Ein Blick in die Tageszeitung, ein Klick ins Internet und ein Knopfdruck via Fernbedienung, um die Nachrichten im Fernsehen zu schauen, gibt dem Menschen die Möglichkeit, aktuelle Ereignisse und Informationen aus aller Welt zu verfolgen und sich Weltwissen anzueignen. Um die medialen Angebote sinnvoll nutzen zu können, ist das Erlernen der deutschen Schriftsprache eine grundlegende Voraussetzung. Die Aneignung dieser Kulturtechnik ist im Zuge der Medialisierung – dessen Entwicklungen immer schneller voranschreiten – in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Um in der Schule und im Berufsleben erfolgreich sein zu können, ist die Beherrschung der Schriftsprache eine grundlegende Voraussetzung. Darüber hinaus entscheidet diese über das Ausmaß der Teilhabe am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben (Naegele / Valtin, 2003).
Lesen und Schreiben ist für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit. Es ist kaum vorstellbar, wie es Menschen ergeht, die nicht Lesen und Schreiben können, und vor allem wie schwierig es für Schüler sein kann, die Schriftsprache zu erlernen. Es ist nicht leicht, eine Antwort darauf zu geben, wie Lesen und Schreiben in der Schule gelehrt und von den Schülern gelernt wird. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Beherrschung der Orthographie nach wie vor ein wesentliches Auswahlkriterium für den Besuch weiterführender Schulen (insbesondere Realschule und Gymnasium) ist (Naegele / Valtin, 2003). Gerade im Hinblick auf nachfolgende Generationen muss die Institution Schule und insbesondere der Lehrkörper der Grundschule eine große Leistung vollbringen.
Mit dieser Arbeit soll die Verantwortung der Schule im Hinblick auf das Erlernen des Lesens und Schreibens hervorgehoben werden. Insbesondere soll es darum gehen, Möglichkeiten der Prävention und Förderung, die im schulischen Kontext umsetzbar sind, herauszustellen. Also welchen Beitrag die Schule bzw. der Lehrkörper im Hinblick auf eine gezielte Förderung bei Schülern mit LRS leisten kann.
Aufgrund von unterschiedlichen Definitionskriterien stellt sich eine eindeutige Definition von LRS als problematisch dar. Lange Zeit wurde der Begriff „Legasthenie“ verwendet. Doch aufgrund von Fehleinschätzungen wie zum Beispiel der Hypothese, dass „Legasthenie“ angeboren bzw. ererbt sei, hat der Begriff an Aktualität verloren...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die deutsche Schriftsprache: Merkmale und Strukturen
- 2.1 Das Deutsche – eine lautorientierte Alphabetschrift
- 2.1.1 „Phoneme“ – Laute
- 2.1.2 „Grapheme“ – Buchstaben
- 2.1.3 Silben und Silbenaufbau
- 2.1.4 Die 100 häufigsten Wörter der deutschen Schriftsprache
- 2.1.5 Der Grundwortschatz
- 2.2 „Orthographie“ – Die Struktur deutscher Wörter
- 2.2.1 „Schärfung“ und „Dehnung“ (Dehnungs-h) deutscher Wörter
- 2.2.2 Orthographische Prinzipien
- 2.3 Der Schriftspracherwerb
- 2.3.1 Zur Didaktik des Schriftspracherwerbs
- 2.3.2 Die Methodik des Schriftspracherwerbs
- 2.3.2.1 Der „Methodenstreit“
- 2.3.2.2 Der ganzheitliche Sprachansatz als kindzentrierter pädagogischer Ansatz
- 2.3.2.3 Auswirkungen der Unterrichtsform auf den Lernerfolg
- 2.3.3 Entwicklungsstufen des Schriftspracherwerbs
- 3. Voraussetzungen für das Erlernen von Lesen und Schreiben
- 3.1 Organische Voraussetzungen
- 3.2 Das menschliche Wahrnehmungssystem
- 3.3 Der Bereich der Nahsinne
- 3.3.1 Die vestibuläre Wahrnehmung
- 3.3.2 Die kinästhetische Wahrnehmung
- 3.3.3 Die taktile Wahrnehmung
- 3.3.4 Körperschemastörungen
- 3.4 Der Bereich der Fernsinne
- 3.4.1 Der visuelle Wahrnehmungsbereich
- 3.4.2 Die auditive Wahrnehmung
- 3.5 Die sensorische Integration
- 3.6 Spezielle Fähigkeiten
- 3.7 Das Zusammenwirken verschiedener Wahrnehmungsbereiche beim Schriftspracherwerb
- 4. Wie Kinder Lesen und Schreiben lernen
- 4.1 Wie Kinder die Schrift entdecken
- 4.2 Die Entwicklung des Lesens
- 4.3 Die Entwicklung des Rechtschreibens – Der Schreiblernprozess
- 4.4 Der Zusammenhang zwischen Lesen und Rechtschreiben
- 5. LRS - Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten beim Erlernen von Lesen und Schreiben
- 5.1 LRS vs. „Legasthenie“ – eine Begriffsbestimmung
- 5.2 Schwierigkeiten im Lesen und im Rechtschreiben
- 5.3 Verschiedene Formen von LRS
- 5.4 Schwierigkeiten im Leselernprozess
- 6. Ursachen der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten
- 7. Diagnostik
- 8. Präventions- und Fördermaßnahmen von LRS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) im schulischen Alltag. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis von LRS, ihren Ursachen und geeigneten Fördermaßnahmen zu entwickeln. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Schriftspracherwerbs, die Voraussetzungen für erfolgreiches Lesen und Schreibenlernen und die verschiedenen Erscheinungsformen von LRS.
- Entwicklung des Schriftspracherwerbs und seine Phasen
- Voraussetzungen für das Lesen- und Schreibenlernen (kognitive, sensorische und motorische Aspekte)
- Definition und Erscheinungsformen von LRS
- Ursachen von LRS (biologische, kognitive, soziale Faktoren)
- Diagnostik und Fördermöglichkeiten von LRS
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie betont die Relevanz des Themas für den schulischen Alltag und die Bedeutung frühzeitiger Diagnose und Förderung.
2. Die deutsche Schriftsprache: Merkmale und Strukturen: Dieses Kapitel beschreibt die Merkmale und Strukturen der deutschen Schriftsprache, um die Grundlage für das Verständnis des Schriftspracherwerbs zu legen. Es beleuchtet phonetische und orthographische Aspekte, die für das Lesen und Schreibenlernen essentiell sind. Die Darstellung der häufigsten Wörter und des Grundwortschatzes liefert wichtige Einblicke in den Spracherwerbsprozess. Die Erläuterung orthographischer Prinzipien wie Schärfung und Dehnung bildet die Basis für das Verständnis von Rechtschreibschwierigkeiten.
3. Voraussetzungen für das Erlernen von Lesen und Schreiben: Dieses Kapitel analysiert die vielschichtigen Voraussetzungen für das Erlernen von Lesen und Schreiben. Es betrachtet sowohl organische Faktoren als auch die Bedeutung verschiedener Wahrnehmungsbereiche (Nah- und Fernsinne). Besondere Aufmerksamkeit wird den visuellen und auditiven Wahrnehmungsleistungen gewidmet, da diese entscheidend für den Schriftspracherwerb sind. Die Rolle der sensorischen Integration und spezifischer Fähigkeiten wie Konzentration, Lateralität und Motorik wird ebenfalls eingehend beleuchtet.
4. Wie Kinder Lesen und Schreiben lernen: Dieses Kapitel beschreibt den Prozess des Lese- und Schreiblernens bei Kindern. Es erläutert Konzepte wie phonologische Bewusstheit und das innere orthographische Lexikon. Die Entwicklung des Lesens wird in verschiedenen Stufen dargestellt, von der Buchstaben- und Wortidentifikation bis zum sinnerfassenden Lesen und dem Verständnis komplexerer Texte. Ähnlich detailliert wird die Entwicklung des Rechtschreibens in verschiedenen Stufen beschrieben, inklusive der Bedeutung von „freiem Schreiben“. Der enge Zusammenhang zwischen Lesen und Schreiben wird hervorgehoben.
5. LRS - Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten beim Erlernen von Lesen und Schreiben: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und den verschiedenen Erscheinungsformen von LRS. Es differenziert zwischen LRS und Legasthenie und erläutert die diagnostischen Kriterien. Die verschiedenen Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben werden detailliert beschrieben, inklusive spezifischer Probleme in der Lesegeläufigkeit, dem Rechtschreiben, dem Leseverständnis und dem schriftlichen Ausdruck. Verschiedene Subtypen von LRS werden unterschieden und diskutiert.
6. Ursachen der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen von LRS unter Berücksichtigung eines interaktiven Modells. Biologische Faktoren, mangelnde kognitive Lernvoraussetzungen und soziale Einflüsse werden als mögliche Ursachen betrachtet. Der aktuelle Forschungsstand zu diesem komplexen Thema wird zusammengefasst.
7. Diagnostik: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene diagnostische Verfahren zur Erkennung von LRS. Es werden sowohl beobachtungsbasierte Methoden als auch standardisierte Testverfahren vorgestellt, die die Rechtschreibfähigkeit, Lesefähigkeit und phonologische Bewusstheit überprüfen. Zusätzlich werden Verfahren zur Überprüfung weiterer relevanter Bereiche wie visuelle Fähigkeiten, Graphomotorik, Lautdiskriminationsfähigkeit, Sprachverarbeitung und Intelligenz erläutert.
8. Präventions- und Fördermaßnahmen von LRS: Dieses Kapitel widmet sich den Präventions- und Fördermaßnahmen von LRS. Es werden Maßnahmen im Vorschulalter sowie im Rahmen des Unterrichts vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf didaktisch-methodischen Maßnahmen zur Vorbeugung von LRS. Es werden verschiedene Förderansätze und -programme erläutert, darunter das Marburger Rechtschreibtraining und die lautgetreue Rechtschreibförderung nach Reuter-Liehr. Die Bedeutung einer individuellen Förderung wird unterstrichen.
Schlüsselwörter
Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS), Legasthenie, Schriftspracherwerb, Phonologische Bewusstheit, Orthographie, Lesedidaktik, Rechtschreibdidaktik, Diagnostik, Förderung, Prävention, Wahrnehmung, visuelle Wahrnehmung, auditive Wahrnehmung, kognitive Fähigkeiten, Lese- und Schreibentwicklung, Teilleistungsstörungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS)
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS). Sie behandelt die Entwicklung des Schriftspracherwerbs, die Voraussetzungen für erfolgreiches Lesen und Schreiben, verschiedene Erscheinungsformen von LRS, ihre Ursachen, Diagnostik und geeignete Fördermaßnahmen. Die Arbeit beinhaltet ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselbegriffe.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert. Kapitel 1 dient als Einleitung. Kapitel 2 beschreibt die Merkmale und Strukturen der deutschen Schriftsprache. Kapitel 3 analysiert die Voraussetzungen für das Erlernen von Lesen und Schreiben (organische Faktoren, Wahrnehmung). Kapitel 4 erklärt den Prozess des Lese- und Schreiblernens bei Kindern. Kapitel 5 befasst sich mit der Definition und den Erscheinungsformen von LRS, inklusive der Unterscheidung zu Legasthenie. Kapitel 6 untersucht die Ursachen von LRS. Kapitel 7 beschreibt verschiedene diagnostische Verfahren. Kapitel 8 widmet sich den Präventions- und Fördermaßnahmen von LRS.
Welche Voraussetzungen werden für das Erlernen von Lesen und Schreiben genannt?
Die Arbeit benennt sowohl organische Voraussetzungen als auch die Bedeutung verschiedener Wahrnehmungsbereiche (Nah- und Fernsinne, insbesondere visuelle und auditive Wahrnehmung). Zusätzlich werden die Rolle der sensorischen Integration und spezifischer Fähigkeiten wie Konzentration, Lateralität und Motorik hervorgehoben.
Wie werden Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) definiert und welche Erscheinungsformen gibt es?
Die Hausarbeit definiert LRS und unterscheidet sie von Legasthenie. Sie beschreibt detailliert verschiedene Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben, wie Probleme in der Lesegeläufigkeit, dem Rechtschreiben, dem Leseverständnis und dem schriftlichen Ausdruck. Verschiedene Subtypen von LRS werden unterschieden und diskutiert.
Welche Ursachen für LRS werden betrachtet?
Die Ursachen von LRS werden unter Berücksichtigung eines interaktiven Modells untersucht. Biologische Faktoren, mangelnde kognitive Lernvoraussetzungen und soziale Einflüsse werden als mögliche Ursachen betrachtet. Der aktuelle Forschungsstand zu diesem komplexen Thema wird zusammengefasst.
Welche diagnostischen Verfahren werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene diagnostische Verfahren zur Erkennung von LRS vor. Dies beinhaltet sowohl beobachtungsbasierte Methoden als auch standardisierte Testverfahren zur Überprüfung der Rechtschreibfähigkeit, Lesefähigkeit, phonologischen Bewusstheit und weiterer relevanter Bereiche wie visuelle Fähigkeiten, Graphomotorik, Lautdiskriminationsfähigkeit, Sprachverarbeitung und Intelligenz.
Welche Präventions- und Fördermaßnahmen werden empfohlen?
Die Hausarbeit präsentiert Maßnahmen zur Prävention und Förderung von LRS im Vorschulalter und im Unterricht. Der Schwerpunkt liegt auf didaktisch-methodischen Maßnahmen. Verschiedene Förderansätze und -programme werden erläutert (z.B. Marburger Rechtschreibtraining, lautgetreue Rechtschreibförderung nach Reuter-Liehr). Die Bedeutung einer individuellen Förderung wird betont.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS), Legasthenie, Schriftspracherwerb, Phonologische Bewusstheit, Orthographie, Lesedidaktik, Rechtschreibdidaktik, Diagnostik, Förderung, Prävention, Wahrnehmung, visuelle Wahrnehmung, auditive Wahrnehmung, kognitive Fähigkeiten, Lese- und Schreibentwicklung, Teilleistungsstörungen.
- Arbeit zitieren
- Sandra Wüpping (Autor:in), 2006, Lese-Rechtschreib-Störungen im schulischen Alltag, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78646