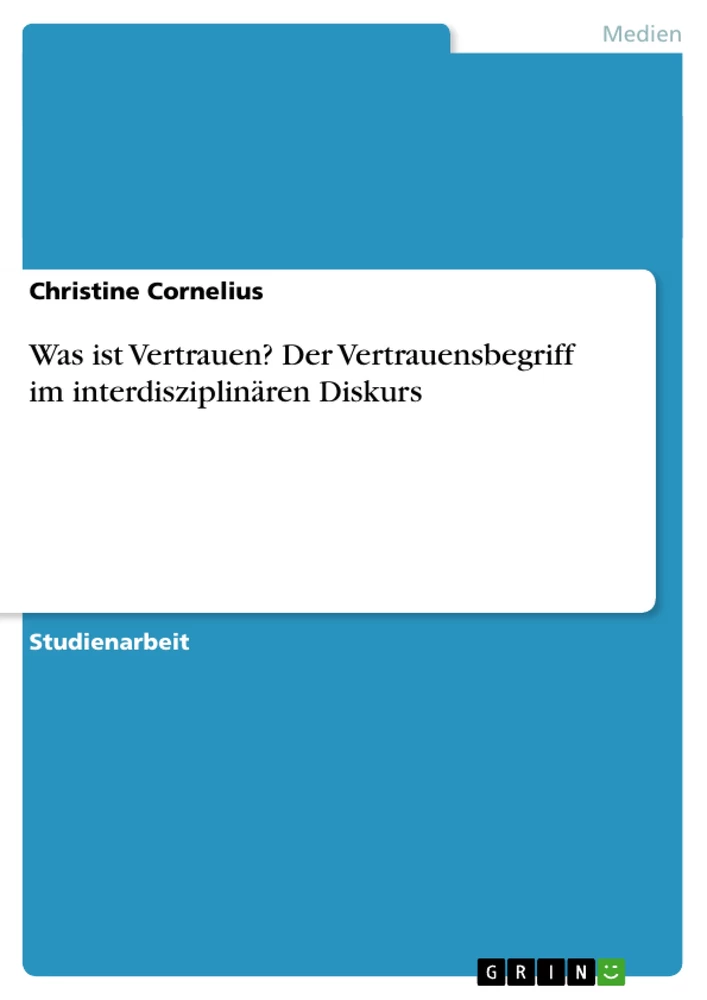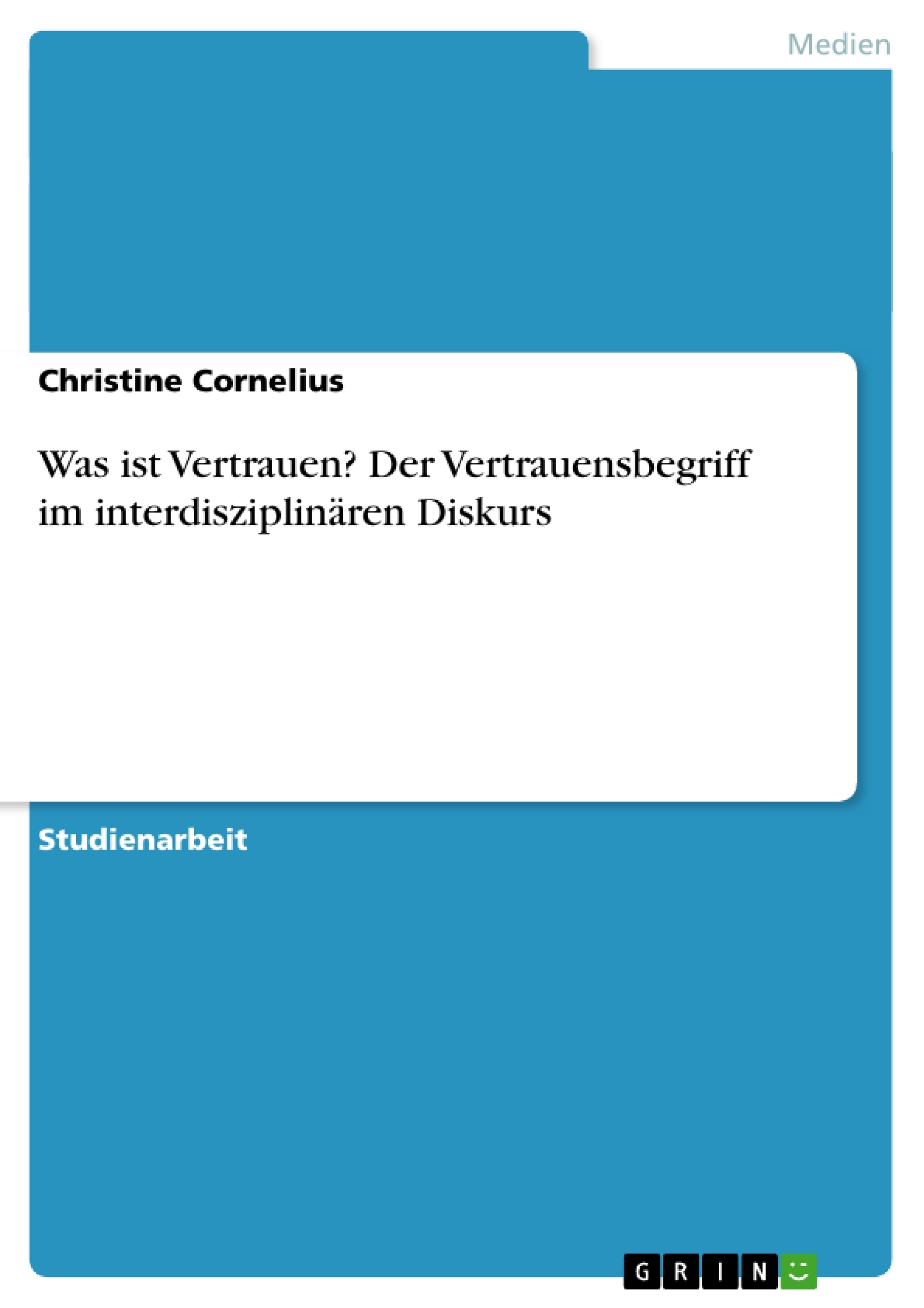Vertrauen gilt als die Basis sozialer Beziehungen (vgl. Dernbach/Meyer 2005: 12). Tagtäglich werden Menschen angehalten, anderen Personen ihr Vertrauen zu schenken. Die Liste derjenigen, die Vertrauen einfordern, ist lang und ließe sich beliebig erweitern: Ärzte, Politiker, Verwandte, Freunde, Versicherungsvertreter, Verkäufer, Handwerker – die Interaktion mit Repräsentanten dieser Gruppen erfordert an einem gewissen Punkt, dass geglaubt wird, was sie sagen, dass die Diagnosen, die sie stellen, richtig sind oder die Produkte, die sie verkaufen, bedenkenlos konsumiert werden können.
Menschen vertrauen jedoch nicht nur auf der Mikroebene. Der Vertrauensbegriff ist auf allen nur erdenklichen Gebieten relevant. Ohne das Vertrauen in Organisationen, Institutionen, Wissenschaft und Technik wäre das Funktionieren unserer modernen Gesellschaft nicht vorstellbar. Gerade weil sich der Vertrauensbegriff auf so viele unterschiedliche Bedeutungsfelder beziehen lässt, hat sich bislang keine klare und eindeutige Definition herausgebildet, die von allen Vertrauensforschern einvernehmlich benutzt wird (vgl. Laucken 2005: 95).
Der Versuch, eine solche zu formulieren, wird zudem dadurch erschwert, dass sich sehr unterschiedliche Wissenschaften mit dem Phänomen Vertrauen auseinandersetzen und die Materie jeweils aus einer anderen Perspektive betrachten. Neben der Soziologie, Psychologie, Philosophie und Publizistikwissenschaft beschäftigt sich auch die Betriebswirtschaftslehre mit dem Themenkomplex (vgl. Petermann 1996: 9). Im Rahmen dieser Arbeit soll eine Annäherung an den Vertrauensbegriff vorgenommen und auf seine verschiedenen Aspekte eingegangen werden. Ziel ist eine interdisziplinäre Analyse, die versucht, eine Antwort auf die Frage Was ist Vertrauen? zu finden. Es soll untersucht werden, wie Vertrauen entsteht, welche Funktionen es erfüllt und in wen es aus welchen Gründen gesetzt wird. Verschiedene Formen des Vertrauens werden aufgezeigt und unterschiedliche Definitionen miteinander verglichen.
Die vorliegende Hausarbeit hebt sich mit dieser Zielsetzung bewusst von dem üblichen Forschungsbereich der Publizistikwissenschaft ab, die sich auf diesem Gebiet hauptsächlich mit dem Themenkomplex Vertrauen in Massenmedien auseinandersetzt. Grundlegend hierfür ist jedoch zunächst eine ausführliche Analyse des Vertrauensbe- griffs. Einen solchen Ausgangspunkt für eine weiterführende Beschäftigung mit dem Thema möchte diese Arbeit erreichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Vertrauensbegriff im interdisziplinären Diskurs
- Vertrauen in der Philosophie
- Vertrauen in der Psychologie
- Das Urvertrauen
- Fünf Stufen der Vertrauensentwicklung
- Indikatoren für vertrauensvolles Verhalten
- Vertrauen in der Soziologie
- Vertrauen aus ökonomischer Perspektive
- Formen von Vertrauen
- Systemisches Vertrauen
- Personales Vertrauen
- Vertrauen in Freundschaften
- Vertrauen in Liebesbeziehungen
- Sonderformen des Vertrauens
- Gottvertrauen
- Selbstvertrauen
- Funktionen von Vertrauen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem interdisziplinären Vertrauensbegriff. Ziel ist es, eine umfassende Analyse des Vertrauens zu erstellen und die verschiedenen Aspekte des Konzepts zu beleuchten. Dazu sollen die Entstehung, die Funktionen und die Gründe für das Setzen von Vertrauen untersucht werden. Verschiedene Formen des Vertrauens werden aufgezeigt und unterschiedliche Definitionen miteinander verglichen.
- Interdisziplinäre Analyse des Vertrauensbegriffs
- Entstehung von Vertrauen
- Funktionen von Vertrauen
- Gründe für das Setzen von Vertrauen
- Verschiedene Formen von Vertrauen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung von Vertrauen in sozialen Beziehungen und im Kontext unserer modernen Gesellschaft dar. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition des Vertrauensbegriffs aufgrund seiner Vielschichtigkeit und der verschiedenen Perspektiven der beteiligten Wissenschaften.
- Der Vertrauensbegriff im interdisziplinären Diskurs: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über klassische Anschauungen zum Vertrauensbegriff in Philosophie, Psychologie, Soziologie und Ökonomie. Der Schwerpunkt liegt auf der Psychologie.
- Vertrauen in der Philosophie: Dieser Abschnitt beleuchtet die historische Entwicklung des Vertrauensbegriffs in der Philosophie, beginnend mit Aristoteles und Thomas von Aquin bis hin zu Thomas Hobbes. Der Fokus liegt auf der Frage, warum und unter welchen Bedingungen Menschen vertrauen.
- Vertrauen in der Psychologie: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem tiefenpsychologischen Entwicklungsmodell von Erik H. Erikson und dem Konzept des Urvertrauens. Es wird erläutert, wie das Urvertrauen als Grundlage für andere Formen des Vertrauens und für ein gefestigtes Identitätsgefühl dient.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf den Vertrauensbegriff, seine interdisziplinäre Relevanz und seine verschiedenen Facetten. Zentral sind die Analyse von Vertrauen als einem komplexen Phänomen, die Untersuchung seiner Entstehung und Funktionen sowie die Erörterung verschiedener Formen des Vertrauens. Im Fokus stehen die Perspektiven der Philosophie, Psychologie, Soziologie und Ökonomie. Zu den zentralen Begriffen zählen Urvertrauen, Systemisches Vertrauen, Personales Vertrauen, Gottvertrauen und Selbstvertrauen.
- Quote paper
- Christine Cornelius (Author), 2006, Was ist Vertrauen? Der Vertrauensbegriff im interdisziplinären Diskurs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78640