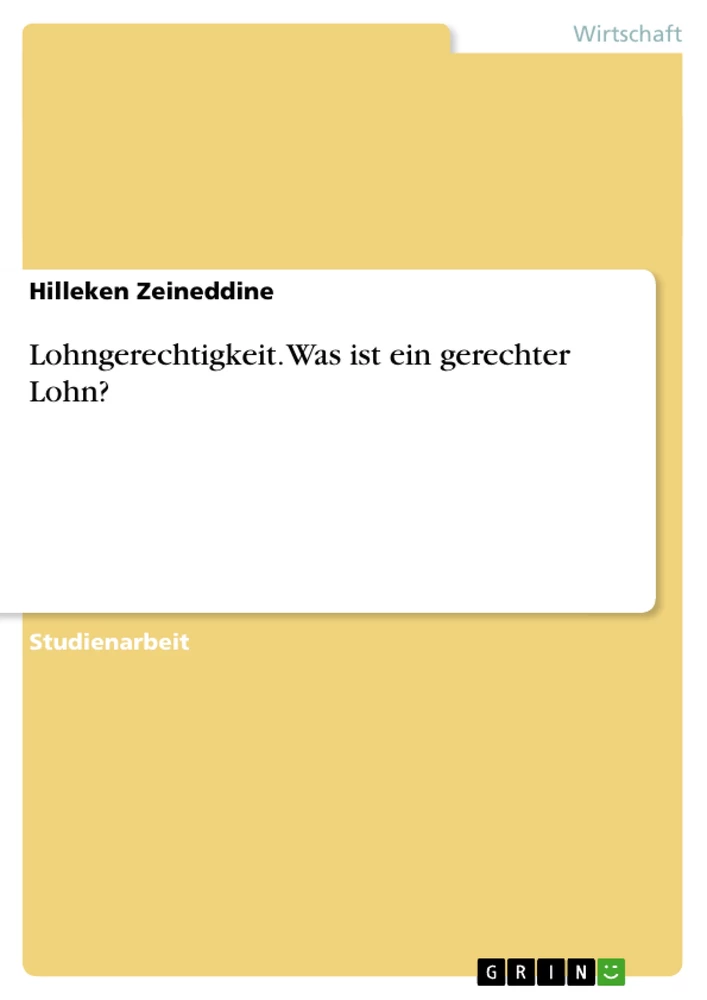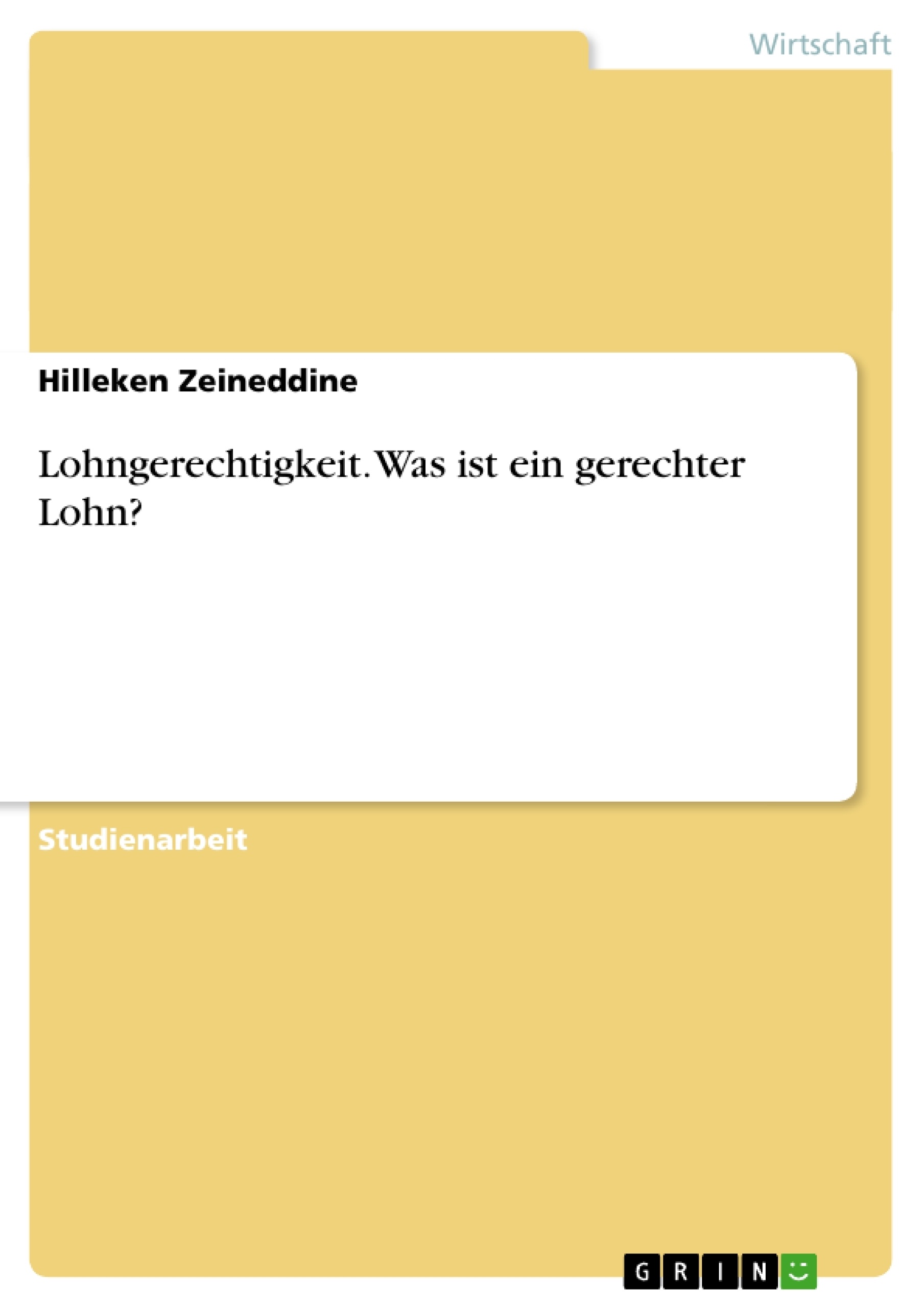Was ist ein gerechter Lohn?
Diese Frage ist keineswegs neu: Die älteste schriftliche Überlieferung, die sich mit der Gerechtigkeit der Entlohnung beschäftigt, ist wohl das Neue Testament. Im Matthäus-Evangelium wird das „Gleichnis vom gleichen Lohn für ungleiche Arbeit“ erzählt. Das Verständnis von Gerechtigkeit scheint sich im Laufe der Zeit ständig zu verändern, hängt es doch „von der in einer historischen Epoche bestehenden Gesellschaftsordnung und ihren sozial-ethischen Grundlagen ab“ (Wöhe: 1996, S. 272). Fast jede Generation steht vor der Aufgabe, neu zu formulieren, was Lohngerechtigkeit eigentlich ausmacht.
Es hat sich immer wieder gezeigt, dass ein 100%ig gerechter Lohn nicht realisierbar ist. Die Wissenschaften, allen voran die Betriebswirtschaftslehre, bieten für die Frage des gerechten Lohns keine Lösung an, es bestehen lediglich Lösungsansätze, die sich dem gerechten Lohn annähern. Sie werden in der vorliegenden Arbeit vorgestellt.
Die Auswirkungen, die die Befolgung der fünf verschiedenen Ansätze der BWL - genannt Ersatzkriterien - nach sich zieht, werden anhand des anschaulichen Beispiels zweier fiktiver, sehr unterschiedlicher Angestellter dargestellt.
Anschließend wird auf die unterschiedlichen Vergütungssysteme eingegangen, und es erfolgt ihre Beleuchtung in Hinblick die verschiedenen Gerechtigkeitskriterien.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lohn
- Ansätze zur Lohngerechtigkeit
- sozial gerecht
- qualifikationsgerecht
- anforderungsgerecht
- leistungsgerecht
- marktgerecht
- Absolute Lohngerechtigkeit
- Traditionelle Vergütungssysteme
- Zeitlohn
- Akkordlohn
- Prämienlohn
- Neue Vergütungssysteme
- Variable Vergütung
- Projektvergütung
- Potentiallohn
- Caféteria-System
- Fazit und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das komplexe Thema Lohngerechtigkeit. Ziel ist es, verschiedene Ansätze zur Bestimmung eines gerechten Lohns vorzustellen und zu analysieren. Dabei werden sowohl traditionelle als auch neue Vergütungssysteme im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit den Gerechtigkeitskriterien beleuchtet.
- Definition und Verständnis von Lohn
- Verschiedene Ansätze zur Lohngerechtigkeit (sozial, qualifikations-, anforderungs-, leistungs- und marktgerecht)
- Analyse traditioneller Vergütungssysteme (Zeitlohn, Akkordlohn, Prämienlohn)
- Vorstellung und Bewertung neuer Vergütungssysteme (Variable Vergütung, Projektvergütung, Potentiallohn, Cafeteria-System)
- Herausforderungen und Kritikpunkte bei der Umsetzung von Lohngerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die historische und gesellschaftliche Entwicklung des Verständnisses von Lohngerechtigkeit, ausgehend vom Gleichnis vom gleichen Lohn für ungleiche Arbeit im Matthäus-Evangelium. Sie betont die Komplexität der Thematik und die fehlende absolute Lösung, fokussiert stattdessen auf Lösungsansätze, die in der Arbeit vorgestellt werden. Die Einleitung legt den Grundstein für die anschließende Auseinandersetzung mit verschiedenen Definitionen und Modellen des gerechten Lohns.
Lohn: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Lohn" umfassend, inklusive monetärer und nicht-monetärer Leistungen. Es differenziert zwischen absoluter und relativer Lohngerechtigkeit und betont die Bedeutung eines als gerecht empfundenen Lohns für die Mitarbeitermotivation und den Unternehmenserfolg. Es wird angedeutet, dass der Markt die absolute Lohnhöhe vorgibt, aber das Unternehmen die Aufgabe hat, diese Summe gerecht auf die Arbeitsplätze zu verteilen. Die Bedeutung der Motivation durch gerechte Entlohnung für Unternehmen wird hervorgehoben.
Ansätze zur Lohngerechtigkeit: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Ansätze zur Bestimmung der relativen Lohngerechtigkeit innerhalb eines Unternehmens. Es kritisiert die oberflächliche Betrachtungsweise, die den ökonomischen Wert der Arbeitsleistung als alleiniges Kriterium für Gerechtigkeit sieht. Stattdessen wird die Notwendigkeit eines Kompromisses aus mehreren Gesichtspunkten betont, wobei das Äquvalenzprinzip von Kosiol als wichtigster Ansatz erwähnt wird. Das Kapitel führt fünf verschiedene Ansätze, die als Ersatzkriterien für Lohngerechtigkeit dienen, ein.
Traditionelle Vergütungssysteme: Dieses Kapitel wird voraussichtlich die traditionellen Vergütungssysteme Zeitlohn, Akkordlohn und Prämienlohn im Detail beschreiben und analysieren, wie gut diese Systeme die in Kapitel 3 vorgestellten Gerechtigkeitskriterien erfüllen. Es wird jeweils auf Vor- und Nachteile der Systeme eingegangen werden und den Bezug zu den zuvor etablierten Gerechtigkeitsprinzipien herstellen.
Neue Vergütungssysteme: Dieses Kapitel wird sich vermutlich mit modernen, flexibleren Vergütungssystemen wie variabler Vergütung, Projektvergütung, Potentiallohn und Cafeteria-Systemen beschäftigen. Es wird die Funktionsweise und die jeweilige Eignung zur Erreichung von Lohngerechtigkeit im Vergleich zu den traditionellen Systemen beleuchtet. Die Analyse wird die Stärken und Schwächen jedes Systems im Bezug auf die zuvor dargestellten Gerechtigkeitsansätze untersuchen.
Schlüsselwörter
Lohngerechtigkeit, Vergütungssysteme, Zeitlohn, Akkordlohn, Prämienlohn, variable Vergütung, Projektvergütung, Potentiallohn, Cafeteria-System, Äquvalenzprinzip, Mitarbeitermotivation, relative Lohnhöhe, Gerechtigkeitskriterien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Lohngerechtigkeit
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das komplexe Thema Lohngerechtigkeit. Sie analysiert verschiedene Ansätze zur Bestimmung eines gerechten Lohns und beleuchtet sowohl traditionelle als auch neue Vergütungssysteme im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit Gerechtigkeitskriterien.
Welche Ziele verfolgt die Hausarbeit?
Ziel der Arbeit ist es, verschiedene Ansätze zur Bestimmung eines gerechten Lohns vorzustellen und zu analysieren. Es werden traditionelle und neue Vergütungssysteme auf ihre Übereinstimmung mit Gerechtigkeitskriterien untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Definition und Verständnis von Lohn; verschiedene Ansätze zur Lohngerechtigkeit (sozial, qualifikations-, anforderungs-, leistungs- und marktgerecht); Analyse traditioneller Vergütungssysteme (Zeitlohn, Akkordlohn, Prämienlohn); Vorstellung und Bewertung neuer Vergütungssysteme (Variable Vergütung, Projektvergütung, Potentiallohn, Cafeteria-System); Herausforderungen und Kritikpunkte bei der Umsetzung von Lohngerechtigkeit.
Welche traditionellen Vergütungssysteme werden betrachtet?
Die Hausarbeit analysiert die traditionellen Vergütungssysteme Zeitlohn, Akkordlohn und Prämienlohn im Detail. Es werden die Vor- und Nachteile dieser Systeme im Hinblick auf die Erfüllung der vorgestellten Gerechtigkeitskriterien untersucht.
Welche neuen Vergütungssysteme werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt moderne, flexible Vergütungssysteme wie variable Vergütung, Projektvergütung, Potentiallohn und Cafeteria-Systeme vor und bewertet deren Eignung zur Erreichung von Lohngerechtigkeit im Vergleich zu den traditionellen Systemen.
Wie wird der Begriff "Lohn" definiert?
Der Begriff "Lohn" wird umfassend definiert, inklusive monetärer und nicht-monetärer Leistungen. Die Unterscheidung zwischen absoluter und relativer Lohngerechtigkeit wird hervorgehoben, ebenso die Bedeutung eines als gerecht empfundenen Lohns für Mitarbeitermotivation und Unternehmenserfolg.
Welche Ansätze zur Lohngerechtigkeit werden diskutiert?
Die Hausarbeit präsentiert verschiedene Ansätze zur Bestimmung der relativen Lohngerechtigkeit, kritisiert eine rein ökonomische Betrachtungsweise und betont die Notwendigkeit eines Kompromisses aus mehreren Gesichtspunkten. Fünf verschiedene Ansätze (sozial, qualifikations-, anforderungs-, leistungs- und marktgerecht) werden detailliert erläutert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Lohngerechtigkeit, Vergütungssysteme, Zeitlohn, Akkordlohn, Prämienlohn, variable Vergütung, Projektvergütung, Potentiallohn, Cafeteria-System, Äquvalenzprinzip, Mitarbeitermotivation, relative Lohnhöhe, Gerechtigkeitskriterien.
Wie wird die Einleitung gestaltet?
Die Einleitung beleuchtet die historische und gesellschaftliche Entwicklung des Verständnisses von Lohngerechtigkeit und betont die Komplexität der Thematik und das Fehlen einer absoluten Lösung. Sie fokussiert auf Lösungsansätze, die in der Arbeit vorgestellt werden.
Wie werden die Kapitel zusammengefasst?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels, inklusive der zentralen Argumente und der behandelten Themen. Es wird jeweils ein kurzer Überblick über den Inhalt und die Zielsetzung des jeweiligen Kapitels gegeben.
- Quote paper
- Diplom-Betriebswirtin, M.A. Hilleken Zeineddine (Author), 2003, Lohngerechtigkeit. Was ist ein gerechter Lohn?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78607