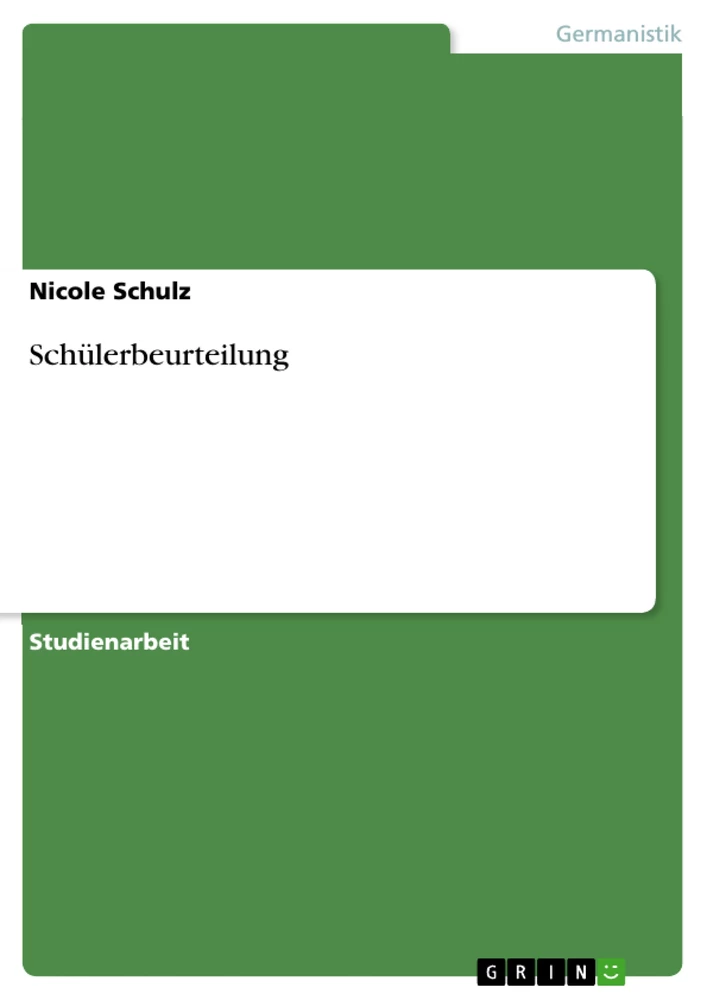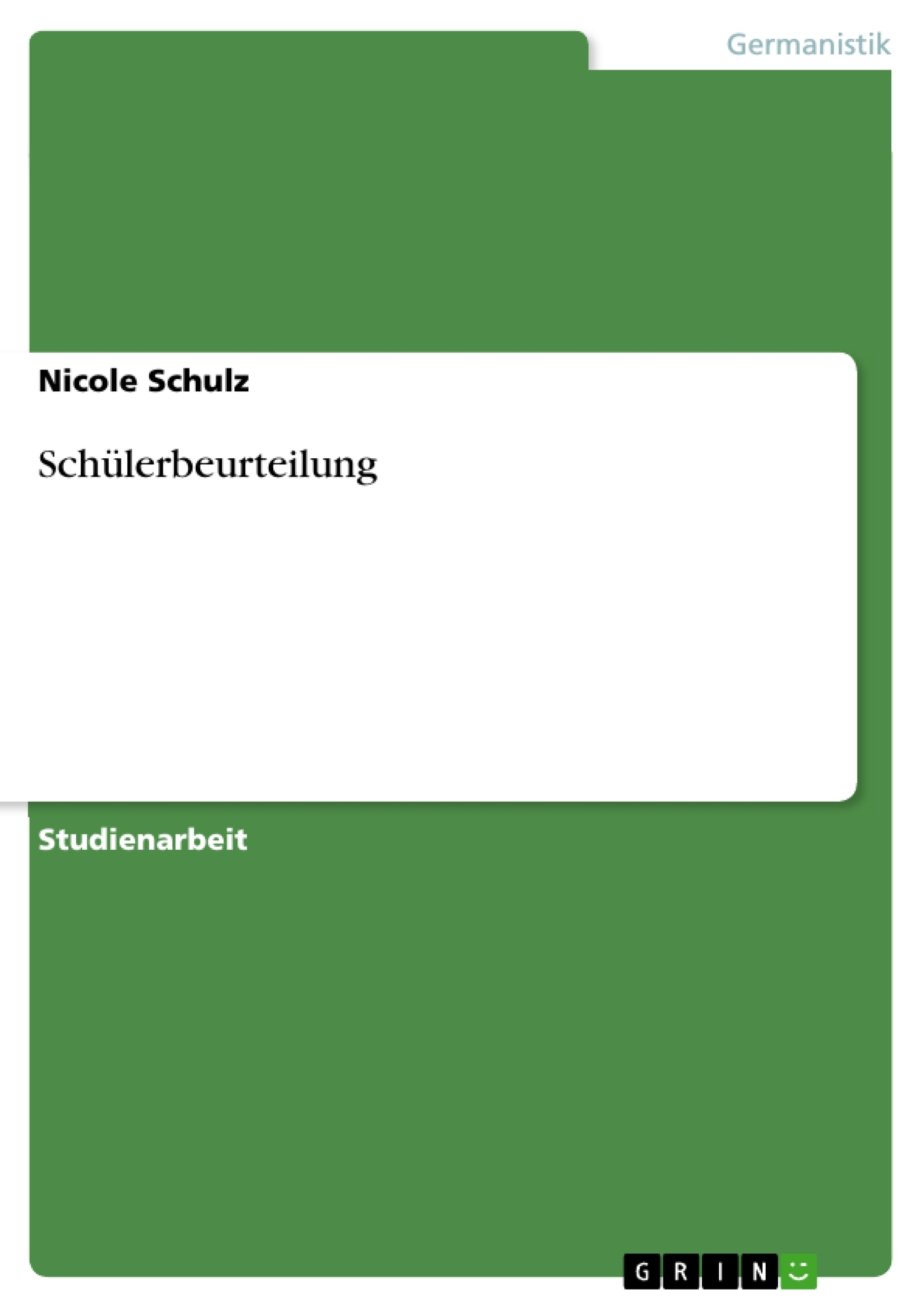"Lehrerdeutsch: Eltern verstehen die Zeugnisse nicht" lautete im Juli 2000 eine Schlagzeile in der Berliner Zeitung. In dem Artikel ging es darum, dass viele Eltern Probleme haben, die Formulierungen in den Schülerbeurteilungen zu interpretieren. "Der Grund dafür sind nicht zuletzt Erfahrungen mit ähnlichen doppeldeutigen Formulierungen in Beurteilungen durch Arbeitgeber" (Dressler 2000). Der Satz "Er bemüht sich" bedeutet, der Betroffene habe die Erwartungen nicht erfüllt. Eine Sprecherin der Verwaltung versicherte in dem Artikel jedoch, dass in der Schule nicht mit "doppeltem Boden" gearbeitet werde (vgl. ebd.). Allerdings gebe es keine Formulierungsvorgaben für Lehrer (vgl. ebd.).
Seit August 2000 gibt es für Brandenburgs Schulen Vorgaben zur Einschätzung des Arbeits- und Sozialverhaltens in den Klassen 3 bis 10. Dazu gibt es vorformulierte Kriterien, die fachbezogen und fächerübergreifend "Aussagen zum Stand des Kompetenzerwerbs" treffen und die Eltern informieren sollen (vgl. VVArbSoz 2000, Abs. 1). Weiter geben die Verwaltungsvorschriften dem Lehrer Hinweise zur Vorgehensweise: "Die im Formular aufgeführten Kategorien sind an Hand der jeweils zugehörigen Beurteilungskriterien auszufüllen. Jeweils ein Beurteilungskriterium wird ausgewählt und in das Formular [...] übertragen [...]" (ebd., Abs. 2).
Für mich stellt sich die Frage, wie aussagekräftig die Formulierungen sind, was Schüler und Eltern dieser hochstandardisierten Einschätzung entnehmen können und ob solch ein Verfahren eine Erleichterung für den Lehrer darstellt. In dem Zeitungsartikel wird deutlich, wie problembehaftet das Beurteilen ist. Deshalb möchte ich in der vorliegenden Arbeit versuchen, die Fragen zu beantworten und die "Informationen über das Arbeits- und Sozialverhalten" hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeit und Nützlichkeit im Schulbetrieb prüfen.
Anregung gibt Elisabeth Gülichs Aufsatz zu "Routineformeln und Formulierungsroutinen", der die Charakteristika "formelhafter Texte" darstellt und nach der Funktion solcher Texte in der Interaktion fragt (Gülich 1997). Gunter Presch hat sich mit den Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben von Arbeitszeugnissen auseinandergesetzt (Presch, o.J.) und Christine Keßler hat sich mit Mustern personenbeurteilender Texte in der DDR beschäftigt (Keßler 1997).
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Beschreibung des Sprechaktes „Beurteilen“
- 3. Beschreibung der Textsorte „Beurteilung“
- 4. Beschreibung des empirischen Datenmaterials
- 5. Zur semantischen Analyse der Beurteilungskriterien
- 5.1. Die Bedeutung der Beurteilungskategorien
- 5.2. Das Konzept formelhafter Texte nach Elisabeth Gülich
- 5.3. Untersuchungen zur Aussagefähigkeit von Arbeitszeugnissen nach Gunter Presch
- 6. Diskussion zur Aussagefähigkeit der „Informationen über das Arbeits- und Sozialverhalten“
- 6.1. Eine Lehrerbefragung zur praktischen Umsetzung der Beurteilungsvorschriften
- 6.2. Objektivität versus Individualität
- 6.3. Alternativen
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Aussagefähigkeit der „Informationen über das Arbeits- und Sozialverhalten“ in brandenburgischen Schülerzeugnissen. Die Hauptziele sind die Beantwortung der Frage nach der Aussagekraft der Formulierungen, was Schüler und Eltern daraus ableiten können und ob das Verfahren eine Erleichterung für Lehrer darstellt. Die Arbeit analysiert den Sprechakt des Beurteilens und die Textsorte Schülerbeurteilung im Kontext der brandenburgischen Verwaltungsvorschriften.
- Semantische Analyse der Beurteilungskriterien
- Bewertung der Objektivität und Vergleichbarkeit des Systems
- Auswirkungen auf Lehrer, Schüler und Eltern
- Diskussion möglicher Alternativen zur Beurteilung
- Kontextualisierung im Bezug auf bestehende Literatur zu Schüler- und Arbeitszeugnissen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Schülerbeurteilung ein und thematisiert die Schwierigkeiten bei der Interpretation von Formulierungen in Zeugnissen, wie sie in einem Artikel der Berliner Zeitung beschrieben wurden. Die Arbeit untersucht die Aussagefähigkeit der standardisierten Beurteilungskriterien in Brandenburg, basierend auf Verwaltungsvorschriften aus dem Jahr 2000.
2. Beschreibung des Sprechaktes „Beurteilen“: Dieses Kapitel beschreibt den Sprechakt des Beurteilens, indem es Definitionen aus dem Grimm'schen Wörterbuch und dem Duden heranzieht. Es wird der Zweck der Schülerbeurteilung erläutert: Schülern und Eltern Informationen über die Entwicklung ihres Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens zu geben.
3. Beschreibung der Textsorte „Beurteilung“: Das Kapitel beschreibt die schriftliche Schülerbeurteilung als Textsorte im Kontext der Institution Schule. Es werden verschiedene linguistische Ansätze zur Textsortenklassifizierung erläutert, und die „Informationen über das Arbeits- und Sozialverhalten“ werden als ein Textexemplar der Textsorte „Beurteilung“ eingeordnet.
4. Beschreibung des empirischen Datenmaterials: Dieses Kapitel beschreibt das empirische Datenmaterial, welches die „Informationen über das Arbeits- und Sozialverhalten“ umfasst. Es werden die Kategorien (Lerneinstellung, Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Urteilsfähigkeit) und ihre Unterpunkte detailliert erläutert. Zusätzlich werden Vergleichsdaten aus anderen Bundesländern und der ehemaligen DDR hinzugezogen.
5. Zur semantischen Analyse der Beurteilungskriterien: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung der Beurteilungskategorien mithilfe des Dudens und untersucht den Begriff der „Routineformeln“ nach Elisabeth Gülich im Kontext der standardisierten Formulierungen. Die Arbeit bezieht außerdem Gunter Preschs Untersuchungen zur Aussagefähigkeit von Arbeitszeugnissen mit ein.
6. Diskussion zur Aussagefähigkeit der „Informationen über das Arbeits- und Sozialverhalten“: Dieses Kapitel präsentiert Ergebnisse einer Lehrerbefragung zur praktischen Umsetzung der Beurteilungsvorschriften. Es diskutiert die Objektivität versus Individualität der Beurteilung und mögliche Alternativen. Die Diskussion beleuchtet die Herausforderungen hinsichtlich der Messbarkeit der Kriterien und der Berücksichtigung individueller Schülermerkmale.
Schlüsselwörter
Schülerbeurteilung, Semantische Analyse, Aussagefähigkeit, Objektivität, Individualität, Routineformeln, Standardisierung, Lehrerbefragung, Brandenburg, Arbeitszeugnisse, Kompetenzen, Lerneinstellung, Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Urteilsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Aussagefähigkeit von Schülerbeurteilungen in Brandenburg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Aussagefähigkeit der „Informationen über das Arbeits- und Sozialverhalten“ in brandenburgischen Schülerzeugnissen. Sie untersucht, wie aussagekräftig die verwendeten Formulierungen sind, was Schüler und Eltern daraus ableiten können und ob das System für Lehrer eine Erleichterung darstellt. Die Analyse betrachtet den Sprechakt des Beurteilens und die Textsorte Schülerbeurteilung im Kontext der brandenburgischen Verwaltungsvorschriften.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Hauptziele sind die Beantwortung der Frage nach der Aussagekraft der Formulierungen in den Zeugnissen, die Interpretation durch Schüler und Eltern und die Bewertung des Systems aus der Perspektive der Lehrer. Die Arbeit analysiert die semantische Bedeutung der Beurteilungskriterien, die Objektivität und Vergleichbarkeit des Systems, die Auswirkungen auf Lehrer, Schüler und Eltern und diskutiert mögliche Alternativen zur aktuellen Beurteilungspraxis.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein. Kapitel 2 beschreibt den Sprechakt „Beurteilen“. Kapitel 3 beschreibt die Textsorte „Schülerbeurteilung“. Kapitel 4 beschreibt das empirische Datenmaterial (die „Informationen über das Arbeits- und Sozialverhalten“). Kapitel 5 analysiert semantisch die Beurteilungskriterien. Kapitel 6 diskutiert die Aussagefähigkeit der Beurteilung, beinhaltet eine Lehrerbefragung und Alternativen. Kapitel 7 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine semantische Analyse der Beurteilungskriterien, zieht Definitionen aus dem Grimm'schen Wörterbuch und dem Duden heran, berücksichtigt linguistische Ansätze zur Textsortenklassifizierung und berichtet über eine durchgeführte Lehrerbefragung. Die Arbeit bezieht Untersuchungen zur Aussagefähigkeit von Arbeitszeugnissen (Gunter Presch) und das Konzept formelhafter Texte nach Elisabeth Gülich mit ein.
Welche Beurteilungskriterien werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Kategorien Lerneinstellung, Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Urteilsfähigkeit, die in den „Informationen über das Arbeits- und Sozialverhalten“ der brandenburgischen Schülerzeugnisse verwendet werden. Die Analyse betrachtet sowohl die einzelnen Kategorien als auch deren Unterpunkte.
Welche Ergebnisse liefert die Lehrerbefragung?
Die Ergebnisse der Lehrerbefragung sind im Kapitel 6 dargestellt und beleuchten die praktische Umsetzung der Beurteilungsvorschriften. Die Diskussion konzentriert sich auf die Objektivität versus Individualität der Beurteilung und mögliche Alternativen. Die Herausforderungen hinsichtlich der Messbarkeit der Kriterien und der Berücksichtigung individueller Schülermerkmale werden beleuchtet.
Welche Alternativen zur aktuellen Beurteilungspraxis werden diskutiert?
Kapitel 6 diskutiert mögliche Alternativen zur aktuellen Beurteilungspraxis, um die Herausforderungen hinsichtlich der Messbarkeit und der Berücksichtigung individueller Schülermerkmale zu adressieren. Konkrete Alternativen werden im Detail beschrieben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schülerbeurteilung, Semantische Analyse, Aussagefähigkeit, Objektivität, Individualität, Routineformeln, Standardisierung, Lehrerbefragung, Brandenburg, Arbeitszeugnisse, Kompetenzen, Lerneinstellung, Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Urteilsfähigkeit.
- Citar trabajo
- Nicole Schulz (Autor), 2002, Schülerbeurteilung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7858