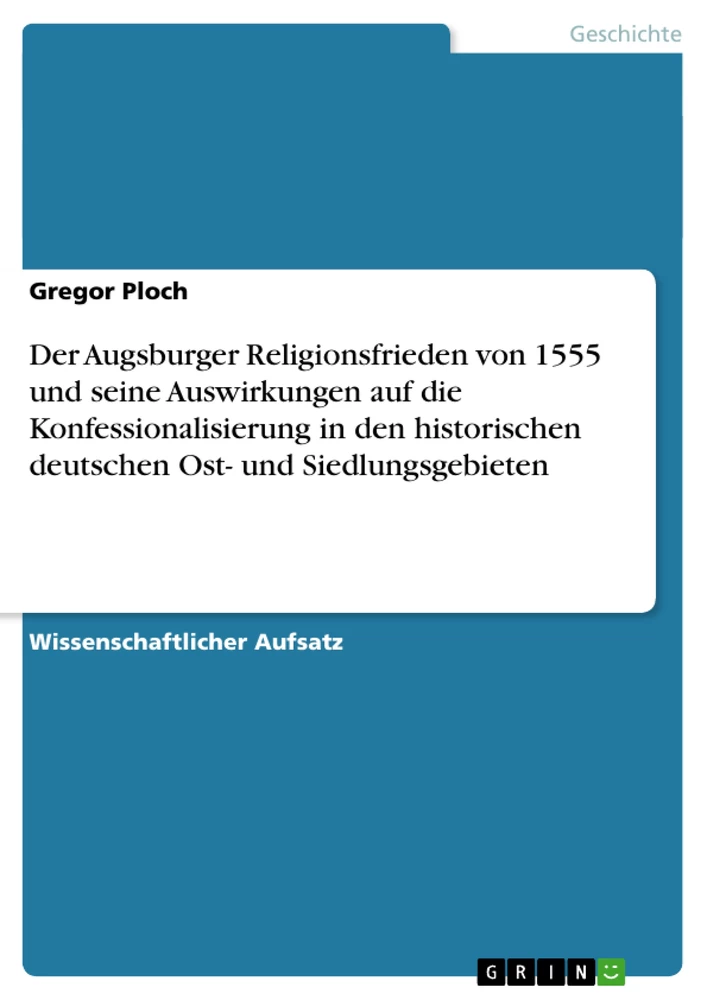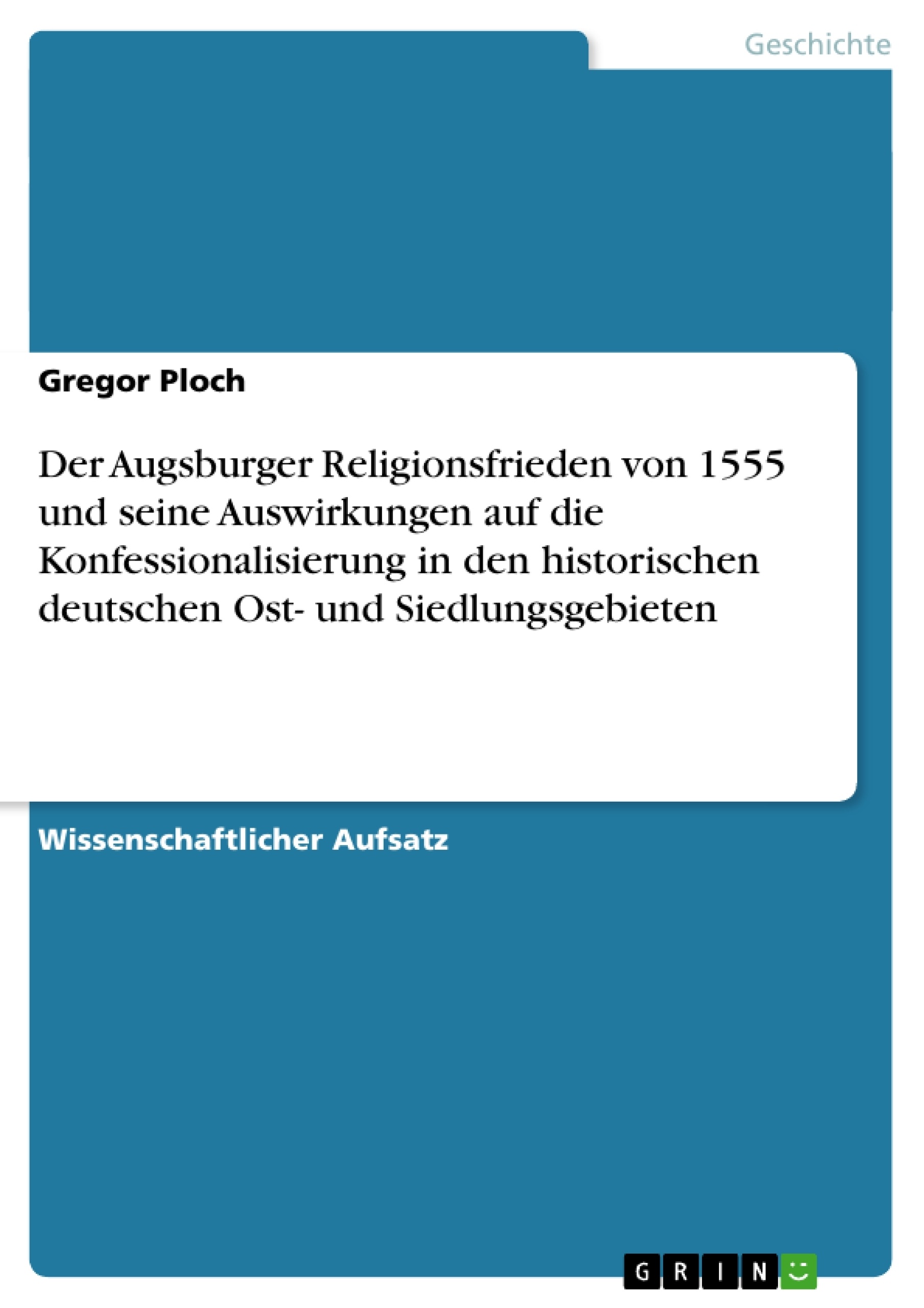Lange Zeit galt der Augsburger Religionsfrieden, insbesondere für die Protestanten, als ein historischer Wendepunkt, der für die weitere Entfaltung des lutherischen Bekenntnisses von einschneidender Bedeutung gewesen ist. Heute bewerten die Historiker das Ereignis von 1555 nicht nur als eine Etappe auf dem langen Weg der konfessionellen Bildung, sondern auch der Entstehung des modernen Staates. Man spricht häufig von der Vorsattelzeit der Moderne und dem langen 16. Jahrhundert, das mit den Reformationen begann und dem Frieden von Münster und Osnabrück 1648 endete.
Der Historiker Ernst Walter Zeeden prägte den Begriff Konfessionsbildung, der 20 Jahre später im Zuge des konfessionellen Zeitalters (1555-1648) aufgegriffen wurde. Die zuerst gebrauchten Bezeichnungen Zweite Reformation (Übergang von lutherischen Gegenden zum Calvinismus), katholische Reform und insbesondere Gegenreformation schienen die historische Entwicklung nicht genügend wiederzugeben. Dabei ist vor allem der letzte Begriff vor allem im deutschsprachigen Raum sehr umstritten. Gegenreformationen kannte man schon im 18. Jahrhundert, die Form im Singular als Epochenbezeichnung prägte zuerst der große protestantische Historiker des 19. Jh. Leopold von Ranke. Populär wurde die Gegenreformation jedoch erst durch den Historiker Moritz Ritter, was auch von anderen Sprachen aufgenommen wurde (so z.B. Counter-Reformation oder contre-réforme). Große Kontroversen um diesen Begriff entbrannten schon im 19. Jahrhundert, da er für zu einseitig erachtet wurde. Die Kritiker wandten ein, man berücksichtige gar nicht die Kirchenreform innerhalb des Katholizismus, denn die Gegenreformation habe nur einen Abwehrcharakter. Der Vorschlag, die Epoche mit katholische Reformation und Restauration zu bezeichnen, wurde von den Protestanten vehement abgelehnt, da die Reformation nur mit dem Luthertum in Verbindung gebracht werden sollte. Erst die Begriffswahl katholische Reform und Gegenreformation des Historikers Hubert Jedin fand für mehrere Jahrzehnte Eingang in die deutschsprachige Geschichtsschreibung.
Der heute verwendete Begriff Konfessionalisierung kennzeichnet nicht nur die Herausbildung einer Konfessionskirche, sondern sie bezieht sich auf einen gesamtgesellschaftlichen Prozess, innerhalb dessen diese bekenntnismäßige und organisatorische Verfestigung der Kirche als Leitvorgang für eine weiter greifende politische und gesellschaftliche Formierung wirkte und zur Heranbildung des modernen Staates führte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Weg zum Augsburger Religionsfrieden und die Beschlüsse von 1555
- Die Konfessionalisierung in den historischen deutschen Ost- und Siedlungsgebieten
- Der Nordosten: Pommern, Cammin, Königlich-Preußen, Ermland, Herzogtum Preußen
- Der Osten: Böhmen, Mähren und Schlesien
- Der Südosten: Ungarn
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text analysiert den Augsburger Religionsfrieden von 1555 und dessen Auswirkungen auf die Konfessionalisierung in den historischen deutschen Ost- und Siedlungsgebieten. Ziel ist es, die Bedeutung dieses Ereignisses als Etappe sowohl auf dem Weg der konfessionellen Bildung als auch der Entstehung des modernen Staates zu beleuchten.
- Der Weg zum Augsburger Religionsfrieden und die Hintergründe des Beschlusses von 1555
- Die Auswirkungen des Religionsfriedens auf die Konfessionalisierung in den Ost- und Siedlungsgebieten
- Die Rolle des Ius reformandi und die Bedeutung des „Cuius regio, eius religio“-Prinzips
- Die Konfessionalisierung als gesamtgesellschaftlicher Prozess und seine Auswirkungen auf die politische und gesellschaftliche Struktur
- Die Debatte um die Begrifflichkeit der Konfessionalisierung und die verschiedenen Ansätze zur Interpretation des Zeitalters zwischen 1555 und 1648
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die lange Zeitspanne zwischen 1555 und dem Dreißigjährigen Krieg und die Entwicklung der historischen Forschung zu diesem Thema. Es wird die Debatte um den Begriff der Gegenreformation und die Entstehung des Konzepts der Konfessionalisierung vorgestellt.
Kapitel 1 widmet sich dem Weg zum Augsburger Religionsfrieden und beschreibt die wichtigsten Ereignisse und Beschlüsse des Augsburger Reichstags von 1555. Hier wird unter anderem die Bedeutung des Wormser Edikts, die Entstehung des Schmalkaldischen Bundes und der Passauer Vertrag erläutert.
Kapitel 2 analysiert die Auswirkungen der Konfessionalisierung auf die historischen deutschen Ost- und Siedlungsgebiete. Hier wird auf die Entwicklungen in Pommern, Königlich-Preußen, Ermland, Herzogtum Preußen, Böhmen, Mähren, Schlesien und Ungarn eingegangen.
Schlüsselwörter
Augsburger Religionsfrieden, Konfessionalisierung, Ius reformandi, Cuius regio, eius religio, Reformation, Gegenreformation, katholische Reform, Konfessionsabgrenzung, politische und gesellschaftliche Strukturen, Ost- und Siedlungsgebiete, Historiografie
- Quote paper
- Dr. Gregor Ploch (Author), 2006, Der Augsburger Religionsfrieden von 1555 und seine Auswirkungen auf die Konfessionalisierung in den historischen deutschen Ost- und Siedlungsgebieten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78583