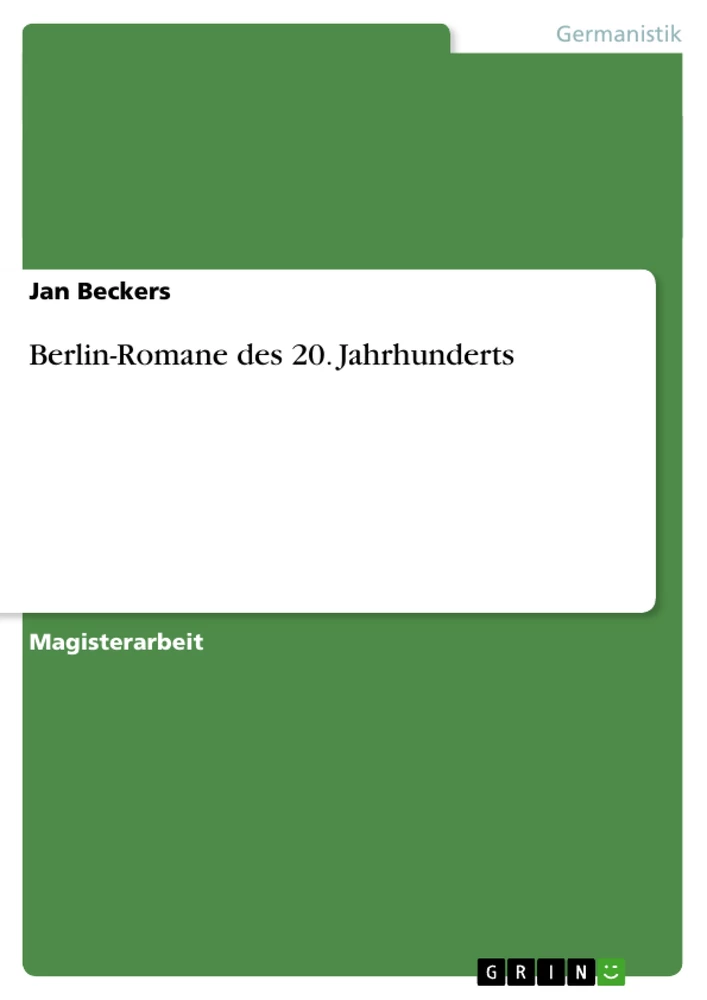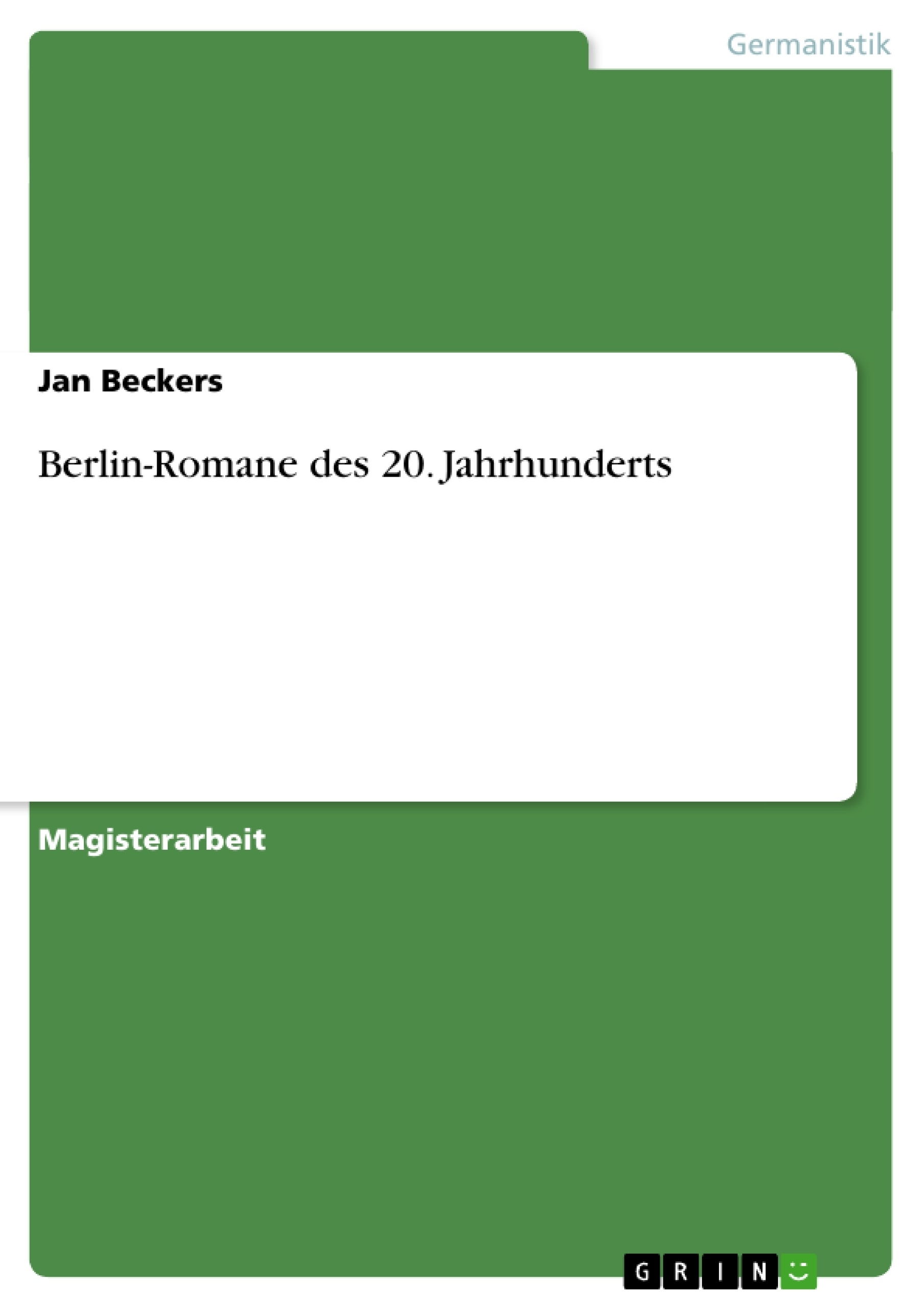Einleitung
Die Großstadt ist der genuine Lebensraum des 20. Jahrhunderts.(3) Vorbei sind die Zeiten des „Zurück zur Natur“, bereits in den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts entdecken die Naturalisten das Stadtmilieu als Stoff für ihre Literatur und spätestens mit dem Expressionismus wird Urbanität zum Schlagwort für eine ganze Dichtergeneration.(4) Die Inspiration durch rauschende Verkehrsströme, durch die Kakophonie der Großstadt und durch die Vermischung verschiedenster Schichten, Milieus und Nationalitäten hat bis heute nicht an Wirkung verloren. Auch wenn immer wieder die Provinz als einziger Raum der Kontemplation und der wahren Erkenntnismöglichkeit ins Feld geführt wird und so eine Stadt – Land Dichotomie immer wieder aufscheint, ohne die tausendfachen
Reize von Metropolis ist moderne Literatur nicht denk- und schreibbar.
[...]
________
(3) Vgl.: Rolf Grimminger: Aufstand der Dinge und der Schreibweisen. Über Literatur und Kultur der Moderne. In: Rolf Grimminger, u.A. (Hrsg.): Literarische Moderne. Europäische Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. Reinbeck bei Hamburg 1985, S. 12-40. Hier: S. 18f.
(4) Vgl.: Walter Fähnders: Avantgarde und Moderne 1890-1933. S. 147f.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Berlin Alexanderplatz – Agon Stadt
- 1.1 „Das ist die Berliner Luft“
- 1.1.2 Berlin: Das Paris des 20. Jahrhunderts
- 1.1.3 Berlin: Das Dublin Deutschlands
- 1.1.4 Die Ankunft der Weltliteratur auf dem Alex
- 1.2 Leben im Rhythmus der Dampframme
- 1.3 Das Personal der Großstadt
- 1.3.1 Masse Mensch/ Massenmensch: Bewältigungsformen zwischen den Weltkriegen
- 1.3.2 Ausweg Wahnsinn: Biberkopf kommt unter die Räder
- 1.4 Veränderte Wahrnehmung = Verändertes Schreiben
- 1.4.1 Die Stadt als Organismus (Döblin und der Expressionismus)
- 1.4.2 Döblins „steinerner Stil“ (Döblin als Kronzeuge der Neuen Sachlichkeit)
- 1.4.3 Erzähltechnik: Montagestil
- 1.1 „Das ist die Berliner Luft“
- 2. Herr Lehmann - Soziotop Stadt
- 2.1 „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen“
- 2.1.1 Kreuzberger Nächte sind lang
- 2.1.2 Frank Lehmann: Von der Provinz in die Enklave
- 2.2 Von Strategen und Kudamm-Idioten. Oder: Frank Lehmann fährt Bus und Bahn
- 2.3 Protagonist oder Heiliger? Zur Personenkonstellation in „Herr Lehmann“
- 2.3.1 Provinzialität in der Großstadt: „Das ist doch in 61!“
- 2.3.2 Geteilte Stadt, Gebrochenes Herz: Ausgerechnet Fanta-Rainer
- 2.3.3 Die Kunst des Insiderseins ohne Insider zu sein: Zur Freundschaft von Frank und Karl
- 2.4 Erzähltechnik: Die Rückkehr des Erzählers?
- 2.4.1 Ennui versus Ostalgie
- 2.4.2 Schreibender Sänger oder singender Schreiber?
- 2.4.3 Montagestil revisited, wie erzählt die Postmoderne?
- 2.1 „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Darstellung Berlins in Romanen des 20. Jahrhunderts. Im Fokus stehen die Entwicklung der Stadtbilder und die jeweiligen literarischen Techniken, die zur Charakterisierung der Metropole verwendet werden. Die Arbeit analysiert, wie sich die Wahrnehmung Berlins in der Literatur verändert und wie diese Veränderungen die Schreibweisen beeinflussen.
- Die Entwicklung des Berlin-Bildes in der Literatur des 20. Jahrhunderts
- Der Einfluss der sozialen und politischen Gegebenheiten auf die Darstellung Berlins
- Die Rolle der Erzähltechnik in der Konstruktion des Stadtraums
- Der Vergleich verschiedener literarischer Ansätze zur Darstellung der Großstadt
- Die Gegenüberstellung von „Berlin Alexanderplatz“ und „Herr Lehmann“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Großstadtliteratur ein und skizziert die historische Entwicklung des Stadtmotivs in der Literatur, beginnend vom antiken Babylon bis hin zum Expressionismus und der Literatur der goldenen Zwanzigerjahre. Sie betont die Vielfältigkeit der Großstadtliteratur und begrenzt den Fokus der Arbeit auf Berlinromane des 20. Jahrhunderts. Die Zielsetzung der Arbeit wird klar definiert: die Analyse von zwei ausgewählten Romanen anhand ihrer Themen und Motive sowie deren Personenkonstellationen und Erzähltechniken.
1. Berlin Alexanderplatz – Agon Stadt: Dieses Kapitel analysiert Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ und seine Darstellung Berlins als einen Ort des Kampfes und des Überlebens. Es untersucht die verschiedenen Facetten der Stadt, von ihrer rauen Atmosphäre bis hin zu ihrer kulturellen Vielfalt. Die Analyse der Charaktere, insbesondere Franz Biberkopfs, und der Erzähltechnik, insbesondere des Montagestils, steht im Mittelpunkt. Die Bedeutung der Stadt als Organismus im Kontext des Expressionismus wird ebenso beleuchtet wie Döblins „steinerner Stil“ im Zusammenhang mit der Neuen Sachlichkeit.
2. Herr Lehmann - Soziotop Stadt: Das Kapitel widmet sich Sven Regens „Herr Lehmann“ und betrachtet Berlin als einen soziotopen Raum, der durch die geteilte Stadt und die verschiedenen sozialen Milieus geprägt ist. Es analysiert die Rolle des Protagonisten Frank Lehmann, seine Beziehung zu seiner Umwelt und die Darstellung der Kreuzberger Szene. Die Erzähltechnik, insbesondere die Frage nach der Rückkehr des Erzählers und der Verbindung zwischen Postmoderne und Montagestil, wird ebenfalls im Detail untersucht. Die Auseinandersetzung mit Themen wie Ostalgie und die Konstruktion der Identität im Kontext der geteilten Stadt bilden weitere Schwerpunkte.
Schlüsselwörter
Berlinromane, 20. Jahrhundert, Großstadtliteratur, Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, Sven Regener, Herr Lehmann, Erzähltechnik, Montagestil, Stadtbild, Soziotop, Expressionismus, Neue Sachlichkeit, Postmoderne, Identität, Provinz, Großstadt, Soziales Milieu, geteilte Stadt.
Häufig gestellte Fragen zu "Darstellung Berlins in Romanen des 20. Jahrhunderts"
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Diese Magisterarbeit untersucht die Darstellung Berlins in Romanen des 20. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Stadtbilder und den literarischen Techniken, die zur Charakterisierung der Metropole verwendet werden. Analysiert wird, wie sich die Wahrnehmung Berlins in der Literatur verändert und wie diese Veränderungen die Schreibweisen beeinflussen.
Welche Romane werden im Detail untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf zwei Romane: Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz" und Sven Regens "Herr Lehmann". Diese Romane werden verglichen und hinsichtlich ihrer Darstellung Berlins, ihrer Charaktere, ihrer Erzähltechniken und ihrer jeweiligen literarischen Stilmittel analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die eine Einleitung, die Analyse von "Berlin Alexanderplatz", die Analyse von "Herr Lehmann" und ein Fazit beinhalten. Jedes Kapitel untersucht spezifische Aspekte der Romane, wie z.B. die Darstellung der Stadt, die Charaktere, die Erzähltechnik und den jeweiligen literarischen Kontext (Expressionismus, Neue Sachlichkeit, Postmoderne).
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Zentrale Themen sind die Entwicklung des Berlin-Bildes in der Literatur des 20. Jahrhunderts, der Einfluss sozialer und politischer Gegebenheiten auf die Darstellung Berlins, die Rolle der Erzähltechnik in der Konstruktion des Stadtraums, der Vergleich verschiedener literarischer Ansätze zur Darstellung der Großstadt und die Gegenüberstellung von "Berlin Alexanderplatz" und "Herr Lehmann".
Welche Erzähltechniken werden analysiert?
Die Arbeit analysiert den Montagestil, insbesondere in Bezug auf "Berlin Alexanderplatz", und untersucht dessen Weiterentwicklung und Adaption in der postmodernen Erzählweise von "Herr Lehmann". Die Rolle des Erzählers und die Frage nach der Rückkehr des Erzählers in der Postmoderne werden ebenfalls thematisiert.
Wie werden die beiden Romane im Kontext ihrer jeweiligen Epochen betrachtet?
"Berlin Alexanderplatz" wird im Kontext des Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit betrachtet, während "Herr Lehmann" im Kontext der Postmoderne analysiert wird. Die Arbeit untersucht, wie die jeweiligen Epochen die Darstellung Berlins und die gewählte Erzählweise beeinflussen.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Berlinromane, 20. Jahrhundert, Großstadtliteratur, Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, Sven Regener, Herr Lehmann, Erzähltechnik, Montagestil, Stadtbild, Soziotop, Expressionismus, Neue Sachlichkeit, Postmoderne, Identität, Provinz, Großstadt, Soziales Milieu, geteilte Stadt.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die die jeweiligen Schwerpunkte jedes Kapitels (Einleitung, "Berlin Alexanderplatz", "Herr Lehmann") und die darin behandelten Themen und Analysen kurz und prägnant zusammenfassen. Die Einleitung skizziert die historische Entwicklung des Stadtmotivs in der Literatur und definiert die Zielsetzung der Arbeit. Die Kapitel zu den Romanen analysieren die jeweilige Darstellung Berlins und die verwendeten literarischen Techniken im Detail.
- Quote paper
- Jan Beckers (Author), 2007, Berlin-Romane des 20. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78525