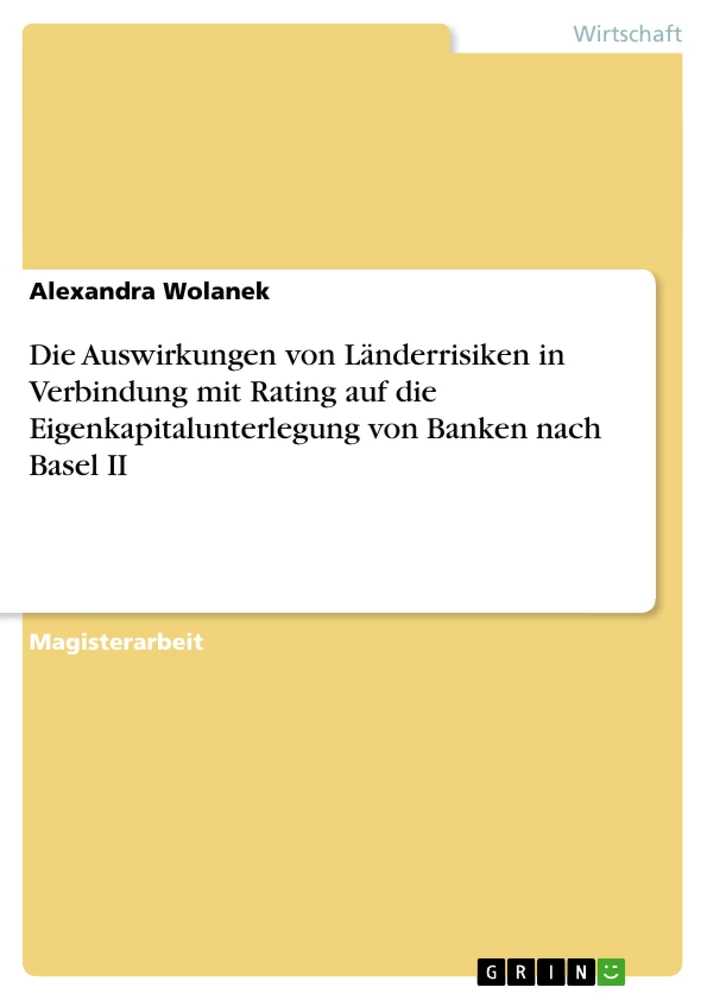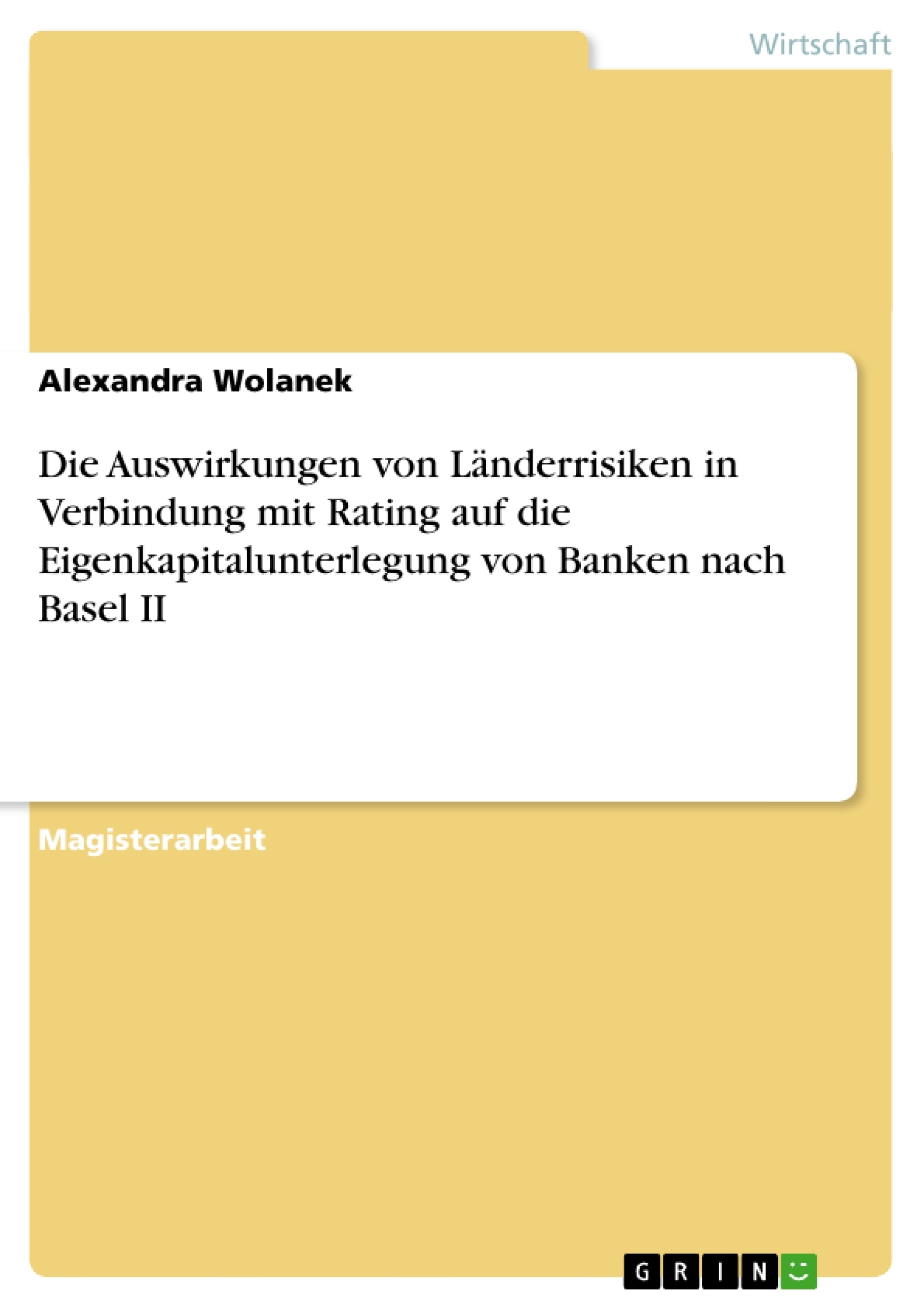"Wenn ich eine Million Dollar schulde, dann bin ich verloren. Wenn man jedoch fünfzig Milliarden Dollar schuldet, dann sind die Banken verloren." (Celso Ming, ein brasilianischer Ökonom, betreffend die Auslandsverschuldung Brasiliens, 1980)1
Dieser Ausspruch ist auch heute noch zutreffend, wenn man die verschiedensten Finanzkrisen im Laufe der Zeit betrachtet. Auch in den 90er Jahren wurde der Weltfinanzmarkt durch eine Reihe von Krisen erschüttert. Rückblickend war die Mexiko-Krise in den Jahren 1994-95 eher eine kleine Erschütterung im Gegensatz zur Asienkrise in den späten 90er Jahren. Um den Finanzmarkt wieder zu stabilisieren gab es massive IWF-Unterstützungen für die Krisenländer. Doch dauerhaft sind diese "IWF-Rettungsaktionen" keine geeignete Lösung um den Finanzmarkt stabil zu halten, sondern es sollte vielmehr versucht werden solche Krisen von Grund auf zu verhindern.
Daher sollten Banken bei der internationalen Kreditvergabe auch die zugrundeliegenden Länderrisiken berücksichtigen. Aufgabe des Länderrisikomanagements der Banken ist es, dafür zu sorgen, dass die von der Bank eingegangenen Verlustrisiken durch geeignete Diversifikation über Länder und Produktklassen eng begrenzt bleiben. In der Praxis finden verschiedenste Länderisikoanalysesysteme Anwendung; in dieser Arbeit sollen die wichtigsten davon vorgestellt werden.
Ein wichtiges Instrument zur Risikobegrenzung bei Banken sind die bankaufsichtsrechtlichen Eigenkapitalvorschriften. Die internationale Koordinierung dieser nationalen Vorschriften erfolgt im Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, in dem einheitliche internationale Standards vereinbart werden. Die derzeit gültigen Gesetze zur Eigenkapitalunterlegung von Banken beruhen auf den Basler Eigenmittelempfehlungen aus dem Jahre 1988. Diese sehen folgende Eigenkapitalunterlegungen für Kredite an souveräne Staaten vor: Kredite an OECD-Mitgliedstaaten werden mit 0 % gewichtet, Kredite an sonstige Staaten mit 100 %. An dieser Regelung ist vielfach Kritik geäußert worden, da sie nur unzureichend das tatsächliche Ausfallrisiko der Bank widerspiegelt und Finanzkrisen dadurch nicht verhindert werden konnten.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Länderrisiko
- 2.1 Risiken im Bankgeschäft
- 2.2 Definitionen des Länderrisikos
- 2.2.1 Abgrenzung zwischen Länder- und Hoheitsrisiko
- 2.2.2 Wirtschaftliches Risiko
- 2.2.3 Politisches Risiko
- 2.2.4 Sovereign default
- 2.2.5 Transferrisiko
- 2.2.6 Counterparty versus Sovereign Risk
- 2.3 Das Problem der Immunität souveräner Regierungen
- 2.4 Indikatoren des Länderrisikos
- 2.4.1 Indikatoren des wirtschaftlichen Länderrisikos
- 2.4.1.1 Binnenwirtschaftliche Indikatoren
- 2.4.1.2 Außenwirtschaftliche Indikatoren
- 2.4.2 Indikatoren des politischen Risikos
- 2.4.2.1 Innenpolitische Ursachen
- 2.4.2.2 Außenpolitische Ursachen
- 2.4.1 Indikatoren des wirtschaftlichen Länderrisikos
- 2.5 Methoden der Beurteilung von Länderrisiken
- 2.6 Länderlimite
- 2.7 Bedeutung und Probleme der Länderrisikoanalyse
- 2.8 Institutionen und Instrumente zur Überwindung eines "sovereign defaults"
- 2.8.5 Internationale Institutionen
- 2.8.5.1 Internationaler Währungsfonds
- 2.8.5.2 Die Weltbankgruppe
- 2.8.5.3 Londoner und Pariser Club
- 2.8.5 Internationale Institutionen
- 2.9 Die Asienkrise als Beispiel für "sovereign defaults"
- 3 Rating
- 3.1 Rating Definition
- 3.2 Der Ratingprozess
- 3.3 Länderrating
- 3.4 Ratingagenturen
- 3.5 Ratingskalierung
- 3.6 Bedeutung des Ratings
- 3.7 Kritik am Rating
- 4 Bankaufsichtsrechtliche Eigenkapital-Vorschriften
- 5 Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen von Länderrisiken, im Zusammenhang mit Ratings, auf die Eigenkapitalunterlegung von Banken nach Basel II. Die Arbeit analysiert die Definition und Beurteilung von Länderrisiken, die Rolle von Ratingagenturen und die Regulierung durch Basel II. Ziel ist es, die Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren und deren Einfluss auf die Kapitalausstattung von Banken zu verstehen.
- Definition und Messung von Länderrisiken
- Die Rolle von Ratingagenturen bei der Einschätzung von Länderrisiken
- Die Eigenkapitalanforderungen nach Basel II und deren Berücksichtigung von Länderrisiken
- Auswirkungen von Länderrisiken auf die Finanzstabilität von Banken
- Analyse der Asienkrise als Beispiel für "sovereign defaults"
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und beschreibt die Relevanz der Untersuchung der Auswirkungen von Länderrisiken auf die Eigenkapitalunterlegung von Banken im Kontext von Basel II. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die Forschungsfrage.
2 Länderrisiko: Dieses Kapitel definiert und analysiert das Konzept des Länderrisikos. Es unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Länderrisiken (wirtschaftlich, politisch, Transferrisiko etc.) und diskutiert Methoden zu deren Messung und Beurteilung (qualitative, quantitative und kombinierte Verfahren). Es werden verschiedene Indikatoren und Modelle vorgestellt und die Bedeutung der Länderrisikoanalyse für Banken herausgestellt. Die Asienkrise dient als Fallbeispiel, um die praktische Relevanz und die möglichen Folgen eines "sovereign defaults" zu veranschaulichen. Die Kapitel beleuchtet auch Institutionen und Instrumente zur Bewältigung von Staatspleiten ("sovereign defaults").
3 Rating: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Thema Rating. Es erklärt den Ratingprozess, die Rolle der Ratingagenturen (Moody's, S&P, Fitch), die verschiedenen Ratingskalen und die Bedeutung von Ratings für Banken und Staaten. Es werden sowohl die Vorteile als auch die Kritikpunkte des Rating-Systems diskutiert. Der Fokus liegt auf der Rolle von Ratings in der Einschätzung von Länderrisiken und deren Auswirkungen auf die Eigenkapitalanforderungen.
4 Bankaufsichtsrechtliche Eigenkapital-Vorschriften: Dieses Kapitel befasst sich mit den bankaufsichtsrechtlichen Eigenkapitalvorschriften, insbesondere mit Basel II. Es beschreibt die Ziele der Vorschriften, die Unterschiede zwischen den Regulierungen in den USA und Europa und die Zusammenarbeit in der Bankenaufsicht innerhalb der Europäischen Union. Es erläutert die Eigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken nach Basel II und deren Berücksichtigung von Länderrisiken. Das Kapitel analysiert die Kritik an Basel II und dessen Auswirkungen auf die Banken.
Schlüsselwörter
Länderrisiko, Rating, Basel II, Eigenkapitalunterlegung, Banken, Sovereign Default, Ratingagenturen, Asienkrise, Finanzstabilität, Risikomanagement, Internationale Institutionen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Auswirkungen von Länderrisiken auf die Eigenkapitalunterlegung von Banken nach Basel II
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen von Länderrisiken, im Zusammenhang mit Ratings, auf die Eigenkapitalunterlegung von Banken nach Basel II. Sie analysiert die Definition und Beurteilung von Länderrisiken, die Rolle von Ratingagenturen und die Regulierung durch Basel II. Ziel ist es, die Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren und deren Einfluss auf die Kapitalausstattung von Banken zu verstehen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Messung von Länderrisiken, die Rolle von Ratingagenturen bei der Einschätzung von Länderrisiken, die Eigenkapitalanforderungen nach Basel II und deren Berücksichtigung von Länderrisiken, Auswirkungen von Länderrisiken auf die Finanzstabilität von Banken und eine Analyse der Asienkrise als Beispiel für "sovereign defaults".
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Länderrisiko, Rating, Bankaufsichtsrechtliche Eigenkapital-Vorschriften und Schlussbemerkung. Das Kapitel „Länderrisiko“ unterscheidet verschiedene Arten von Länderrisiken (wirtschaftlich, politisch, Transferrisiko etc.) und diskutiert Methoden zu deren Messung und Beurteilung. Das Kapitel „Rating“ befasst sich mit dem Ratingprozess, der Rolle der Ratingagenturen, verschiedenen Ratingskalen und der Bedeutung von Ratings für Banken und Staaten. Das Kapitel „Bankaufsichtsrechtliche Eigenkapital-Vorschriften“ behandelt Basel II, dessen Ziele und die Berücksichtigung von Länderrisiken.
Was wird unter Länderrisiko verstanden?
Die Arbeit definiert und analysiert das Konzept des Länderrisikos, unterscheidet zwischen verschiedenen Arten (wirtschaftlich, politisch, Transferrisiko, Sovereign Default) und diskutiert Methoden zur Messung und Beurteilung (qualitative, quantitative und kombinierte Verfahren). Es werden verschiedene Indikatoren und Modelle vorgestellt.
Welche Rolle spielen Ratingagenturen?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Ratingagenturen (Moody's, S&P, Fitch) bei der Einschätzung von Länderrisiken und deren Auswirkungen auf die Eigenkapitalanforderungen. Sowohl die Vorteile als auch die Kritikpunkte des Rating-Systems werden diskutiert.
Wie werden Länderrisiken in Basel II berücksichtigt?
Die Arbeit beschreibt die Eigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken nach Basel II und deren Berücksichtigung von Länderrisiken. Sie analysiert die Kritik an Basel II und dessen Auswirkungen auf die Banken.
Welche Bedeutung hat die Asienkrise in dieser Arbeit?
Die Asienkrise dient als Fallbeispiel, um die praktische Relevanz und die möglichen Folgen eines "sovereign defaults" zu veranschaulichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Länderrisiko, Rating, Basel II, Eigenkapitalunterlegung, Banken, Sovereign Default, Ratingagenturen, Asienkrise, Finanzstabilität, Risikomanagement, Internationale Institutionen.
- Quote paper
- Alexandra Wolanek (Author), 2002, Die Auswirkungen von Länderrisiken in Verbindung mit Rating auf die Eigenkapitalunterlegung von Banken nach Basel II, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7851