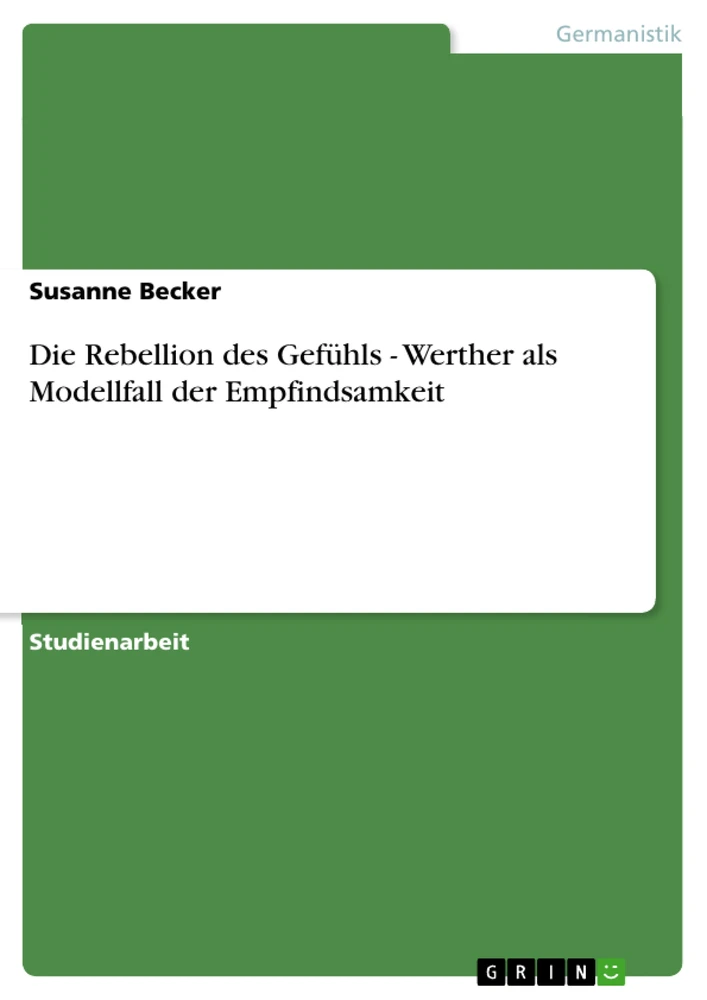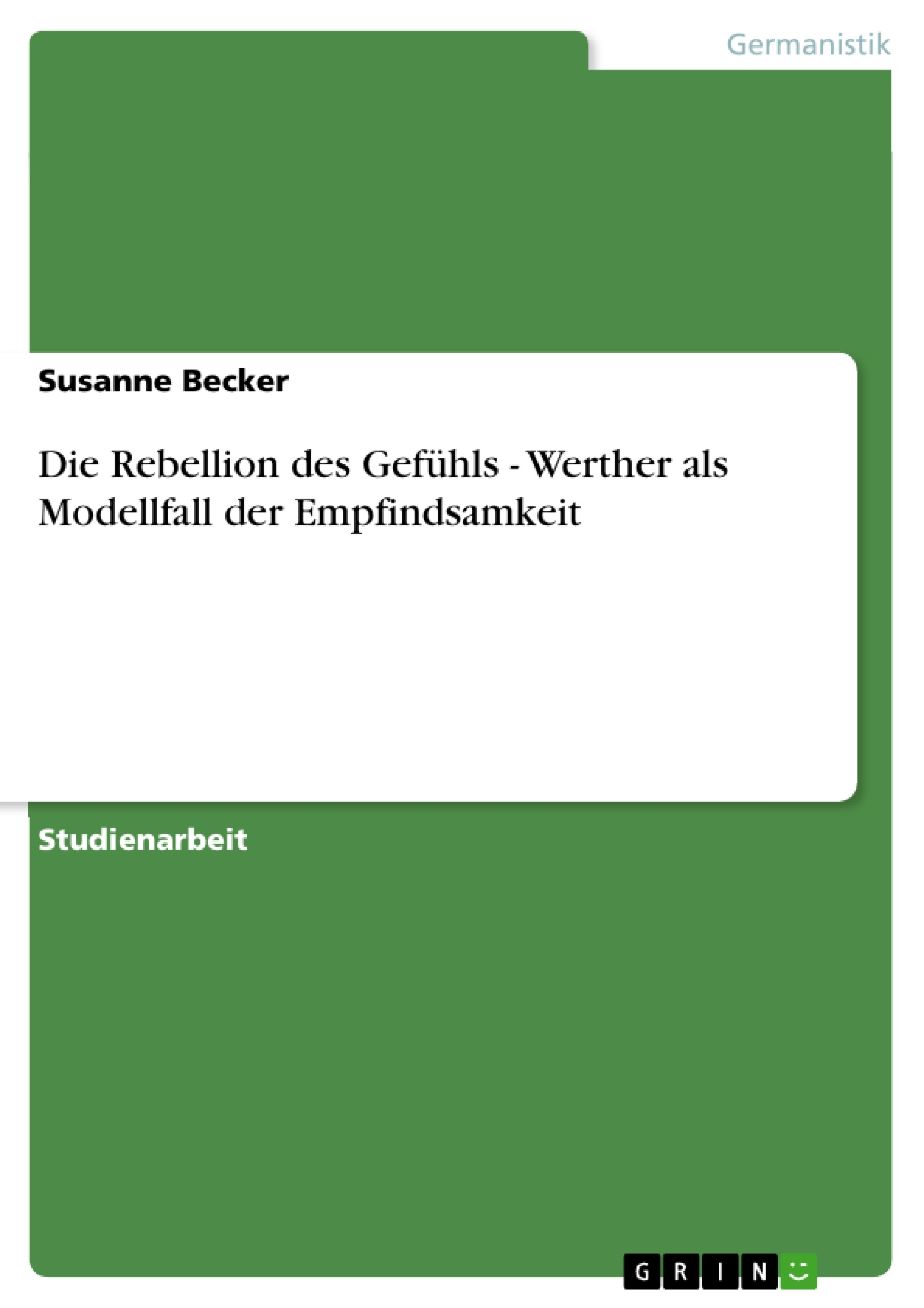Johann Wolfgang von Goethe verfasste mit dem „Werther“1 1774 nicht nur seinen
ersten Roman, der ihm zu jähem literarischen Erfolg und Ruhm verhalf, sondern
den Briefroman schlechthin und damit das populärste Zeugnis der Gattung des
Briefromans, darüber hinaus ein exemplarisches Beispiel der durch
Empfindsamkeit gekennzeichneten literarischen Strömung in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts.
Das Ziel dieser Arbeit soll es sein, die Empfindsamkeit als literarische Strömung
innerhalb der Aufklärung zwischen 1730 und 1800 mittels Goethes „Werther“ zu
charakterisieren und aufzuzeigen, wie Goethe exemplarisch das Zeitgefühl der
Empfindsamkeit in seinem Briefroman umsetzte.
Inhaltsverzeichnis
- Die Rebellion des Gefühls. Werther als Modellfall der Empfindsamkeit
- Empfindsamkeit als literarische Strömung
- Werther: Leidenschaft und Gefühlsbetontheit
- Natur, Landleben und Bürgerlichkeit
- Liebe und Naturverbundenheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die literarische Strömung der Empfindsamkeit im 18. Jahrhundert anhand Goethes „Werther“. Ziel ist es, die Charakteristika der Empfindsamkeit zu beschreiben und deren Umsetzung in Goethes Roman aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert, wie Goethe das Zeitgefühl der Empfindsamkeit in seinem Werk einfängt.
- Charakterisierung der Empfindsamkeit als literarische Strömung
- Analyse der Umsetzung der Empfindsamkeit in Goethes „Werther“
- Die Rolle von Gefühlen und Leidenschaften in „Werther“
- Das Motiv der Natur und des Landlebens im Vergleich zur städtischen Bürgerlichkeit
- Die Bedeutung des Liebesmotivs und seine Verbindung zur Natur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Rebellion des Gefühls. Werther als Modellfall der Empfindsamkeit: Diese Einleitung präsentiert Goethes „Werther“ als ein Schlüsselwerk der Empfindsamkeit und definiert das Ziel der Arbeit: die Charakterisierung der Empfindsamkeit als literarische Strömung und ihre Umsetzung in Goethes Roman. Der Begriff der Empfindsamkeit wird erläutert, seine Bedeutungsebenen im literarischen, ästhetischen und moralischen Kontext beleuchtet und seine Stellung innerhalb der Aufklärung erörtert. Die Arbeit betont die Empfindsamkeit nicht als Gegenposition zur Vernunft, sondern als deren Ergänzung, eine „nach innen gewendete Aufklärung“. Die Verknüpfung mit Sturm und Drang und den bürgerlichen Emanzipationsbestrebungen wird hervorgehoben, die Empfindsamkeit als „Rebellion des Gefühls“ interpretiert.
Empfindsamkeit als literarische Strömung: Dieses Kapitel vertieft die Definition und die Merkmale der Empfindsamkeit. Es untersucht den Fokus auf Emotionen und Empfindungen, die Betonung von Freundschaft und Liebe und die literarische Darstellung von starken, oft überhöhten Gefühlsregungen. Der Briefroman als bevorzugte Form wird erläutert. Die Arbeit hebt die Bedeutung der Subjektivität, Innerlichkeit und die Neubewertung des Gefühlslebens hervor, die für die Empfindsamkeit charakteristisch sind.
Werther: Leidenschaft und Gefühlsbetontheit: Dieses Kapitel analysiert Werthers Charakter und sein Bekenntnis zur Leidenschaft. Die Briefform des Romans wird als Mittel zur direkten Darstellung seiner Gedanken und Gefühle hervorgehoben, wodurch eine hohe Authentizität und Identifikation beim Leser geschaffen wird. Werthers emotionaler, sensibler und labil-selbstkritischer Charakter wird analysiert und seine Abgrenzung von der „vernünftigen“ Gesellschaft beschrieben. Seine leidenschaftliche Natur wird als zentrales Merkmal seiner empfindsamkeit interpretiert.
Natur, Landleben und Bürgerlichkeit: Dieses Kapitel untersucht die Gegenüberstellung von Natur und Bürgerlichkeit in „Werther“. Werthers Hang zur Idylle und seine Naturverbundenheit werden im Kontrast zu Alberts gesellschaftlicher Einbindung analysiert. Werthers Flucht in die Natur wird als Ausdruck seiner Rebellion gegen die Enge und Begrenzung des bürgerlichen Lebens interpretiert, seine Isolation als Folge seines ausschließlich gefühlsgeleiteten Handelns beschrieben. Der Suizid wird als Konsequenz seiner Unfähigkeit dargestellt, in der bürgerlichen Welt oder in einer idealisierten Naturwelt seinen Platz zu finden.
Liebe und Naturverbundenheit: Dieses Kapitel analysiert die Verflechtung der Motive Liebe und Natur in „Werther“. Es zeigt, wie Werthers subjektive Wahrnehmung der Natur sich mit seiner Gemütslage und dem Verlauf seiner Liebe zu Lotte verändert. Der Wandel der Jahreszeiten und Werthers Lektüre spiegeln die Entwicklung seiner Melancholie und Todesgedanken wider.
Schlüsselwörter
Empfindsamkeit, Aufklärung, Sturm und Drang, Goethe, Werther, Briefroman, Gefühl, Leidenschaft, Natur, Bürgerlichkeit, Liebe, Suizid, Individuum, Innerlichkeit.
Goethes Werther: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die literarische Strömung der Empfindsamkeit im 18. Jahrhundert anhand Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werthers“. Sie beschreibt die Charakteristika der Empfindsamkeit und deren Umsetzung in Goethes Werk. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung des Zeitgeistes der Empfindsamkeit in „Werther“.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Charakterisierung der Empfindsamkeit als literarische Strömung; die Analyse der Umsetzung der Empfindsamkeit in „Werther“; die Rolle von Gefühlen und Leidenschaften in „Werther“; das Motiv der Natur und des Landlebens im Vergleich zur städtischen Bürgerlichkeit; und die Bedeutung des Liebesmotivs und seine Verbindung zur Natur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1: Einführung in die Empfindsamkeit und „Werther“ als Schlüsselwerk; Kapitel 2: Detaillierte Erläuterung der Empfindsamkeit als literarische Strömung; Kapitel 3: Analyse von Werthers Charakter und seiner leidenschaftlichen Natur; Kapitel 4: Untersuchung des Kontrasts zwischen Natur und Bürgerlichkeit in „Werther“; und Kapitel 5: Analyse der Verbindung von Liebe und Natur in „Werther“ und deren Einfluss auf Werthers Gemütslage.
Wie wird die Empfindsamkeit in der Arbeit definiert?
Die Empfindsamkeit wird nicht als Gegenposition zur Vernunft, sondern als deren Ergänzung dargestellt – eine „nach innen gewendete Aufklärung“. Die Arbeit betont die Betonung von Emotionen, Empfindungen, Freundschaft, Liebe und die literarische Darstellung intensiver Gefühlsregungen als zentrale Merkmale der Empfindsamkeit. Die Verknüpfung mit Sturm und Drang und den bürgerlichen Emanzipationsbestrebungen wird ebenfalls hervorgehoben.
Welche Rolle spielt die Natur in Goethes „Werther“?
Die Natur spielt eine zentrale Rolle in „Werther“. Werthers Naturverbundenheit wird im Kontrast zu Alberts gesellschaftlicher Einbindung analysiert. Werthers Flucht in die Natur wird als Ausdruck seiner Rebellion gegen die Enge des bürgerlichen Lebens interpretiert. Die Natur spiegelt auch Werthers Gemütslage und den Verlauf seiner Liebe wider.
Welche Bedeutung hat das Liebesmotiv in „Werther“?
Das Liebesmotiv ist untrennbar mit dem Naturmotiv verknüpft. Werthers subjektive Wahrnehmung der Natur verändert sich mit seiner Gemütslage und dem Verlauf seiner Liebe zu Lotte. Der Wandel der Jahreszeiten und Werthers Lektüre spiegeln die Entwicklung seiner Melancholie und Todesgedanken wider.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Empfindsamkeit, Aufklärung, Sturm und Drang, Goethe, Werther, Briefroman, Gefühl, Leidenschaft, Natur, Bürgerlichkeit, Liebe, Suizid, Individuum, Innerlichkeit.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich für die deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts, insbesondere für die Epoche der Empfindsamkeit und Goethes „Werther“, interessiert. Sie eignet sich für Studierende der Germanistik und Literaturwissenschaft.
- Quote paper
- Susanne Becker (Author), 2005, Die Rebellion des Gefühls - Werther als Modellfall der Empfindsamkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78506