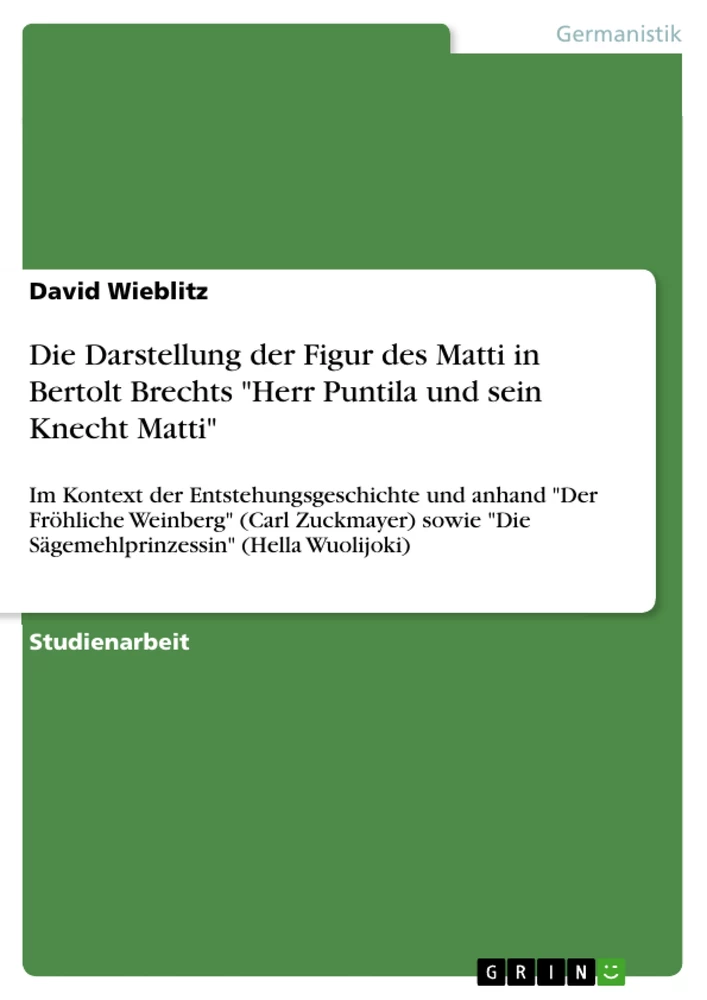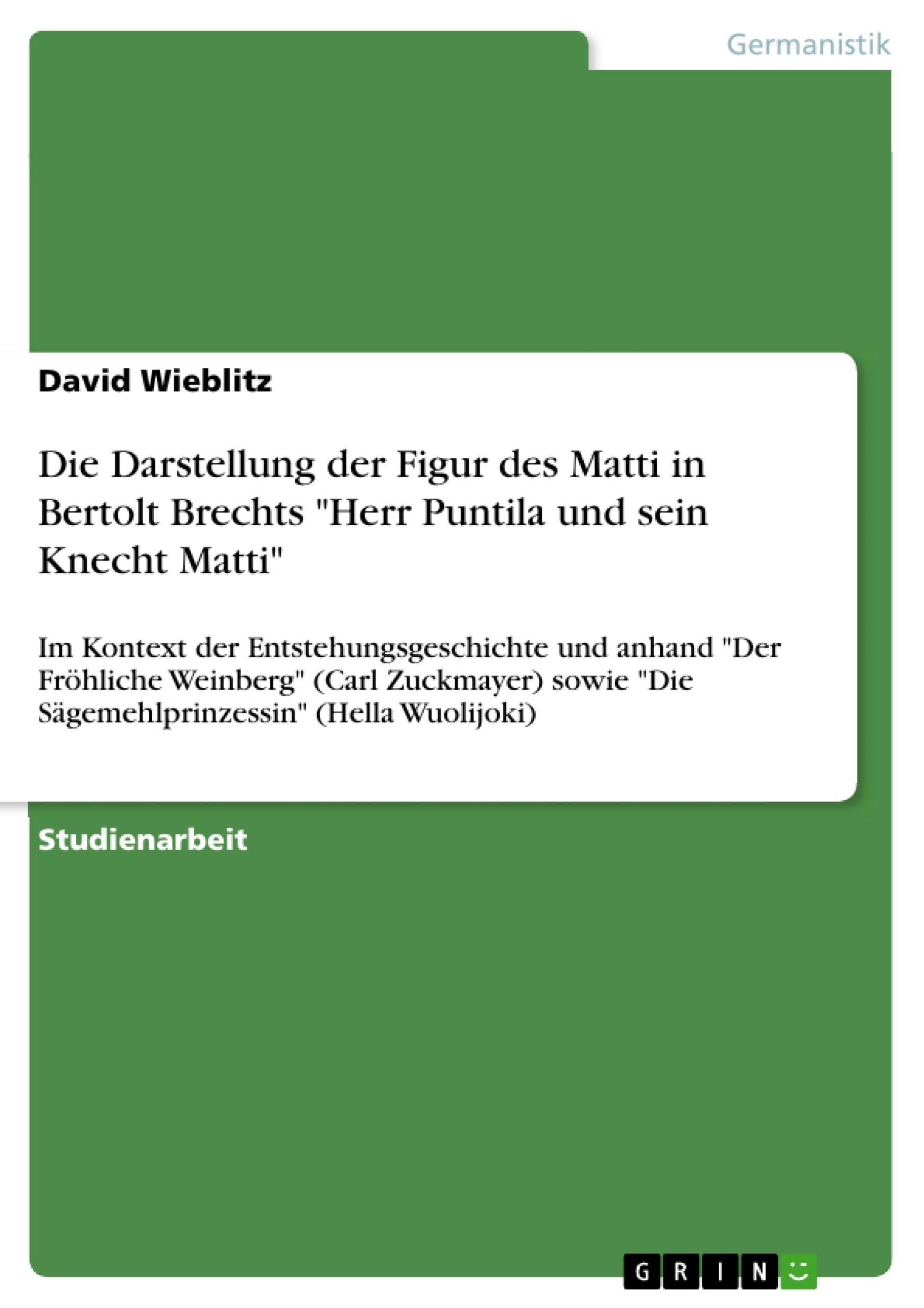In Brecht einzigem „Volksstück“ werden hinter Schwank und burlesker Leichtigkeit der starke Gegensatz zwischen einem finnischen Gutsbesitzer und seinem Chauffeur und Knecht kritisch dargestellt.
Nach einer Darstellung der komplexen Enstehungsumstände wird ein Vergleich zwischen der Titelfigur des Brecht’schen Dramas, dem „Knecht Matti“ und zwei vermeintlichen Vorlagenfiguren in früheren Volksstücken gezogen. Inwiefern waren diese Figuren Wegweiser, Vorbilder oder Gegenbilder zu Brechts Konzept der Knechtfigur Matti?
Als Grundlage für die weiteren Darstellungen soll zunächst die Figur Matti untersucht werden. Dabei soll mit der zentralen Herr-Knecht-Beziehung begonnen werden. Inwieweit stehen Puntila und Matti in Abhängigkeit zueinander? Wie wird dieses Verhältnis gezeichnet?
Daraufhin sollen Mattis Charakterzüge gesondert betrachtet und schließlich sein Verhältnis zu Puntilas Tochter Eva untersucht werden.
Auf Grundlage der Darstellung Mattis soll in Zuckmayers Volksstück „Der fröhliche Weinberg“ das vermeintliche Pendant zu Matti, der Rheinschiffer Jochen, innerhalb der entsprechenden Figurenkonstellation betrachtet werden. Dass die Figur Jochen wirklich als Vorlage diente, ist genauso umstritten wie auch, ob es sich bei diesem Stück um die wirkliche Vorlage für Brechts Puntila handelte und soll anschließend anhand des Forschungsdiskurses dargestellt werden.
Das zweite zu untersuchende Volksstück, die „Sahanpuruprinsessa“, (auf Deutsch: „Die Sägemehlprinzessin“) von Hella Wuolijoki, die Brecht als Vorlage für seinen „Puntila“ diente, liegt für diese Arbeit in einer deutsch übersetzten Filmfassung vor. Interessant ist in diesem Stück die mögliche Vorlagenfigur für Matti, der Anwalt Dr. Sellmann.
Abschließend wird eine vergleichende Betrachtung der beiden Volksstücke vorgenommen und das Brecht’sche Volksstückskonzept heraus- und vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Entwicklung von „Herr Puntila und sein Knecht Matti“
- Matti in „Herr Puntila und sein Knecht Matti“
- Matti in dem Verhältnis zu seinem Herrn
- Wesensmerkmale Mattis
- Matti in dem Verhältnis zu Eva
- Mattis Niederlage
- Matti in der Theaterpraxis
- Mattis Gegenfiguren in den Brechtschen Vorlagen
- Jochen Most in „Der fröhliche Weinberg“
- „Der fröhliche Weinberg“ – Eine umstrittene Vorlage für Brecht?
- Kalle in „Die Sägemehlprinzessin“
- Jochen Most in „Der fröhliche Weinberg“
- Das Volksstück bei Brecht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Figur des Matti in Bertolt Brechts „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ im Kontext der Entstehungsgeschichte und anhand der Vorlagen „Der fröhliche Weinberg“ (Carl Zuckmayer) und „Die Sägemehlprinzessin“ (Hella Wuolijoki). Die zentrale Fragestellung ist, inwiefern die Vorlagenfiguren als Wegweiser, Vorbilder oder Gegenbilder für Brechts Konzept der Knechtfigur Matti dienen.
- Analyse der Figur Matti in seiner Beziehung zu Puntila und Eva.
- Vergleich Mattis mit den Gegenfiguren Jochen Most (aus „Der fröhliche Weinberg“) und Kalle (aus „Die Sägemehlprinzessin“).
- Untersuchung der Entstehungsgeschichte von „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ und der Rolle der Vorlagen.
- Betrachtung des Volksstückkonzepts bei Brecht.
- Bewertung der theaterpraktischen Umsetzung der Figur Matti.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Bedeutung und Rezeption von Brechts „Herr Puntila und sein Knecht Matti“. Sie skizziert die komplexe Entstehungsgeschichte und kündigt den Vergleich der Figur Matti mit vermeintlichen Vorlagenfiguren in anderen Volksstücken an. Der Fokus liegt auf der Analyse der Herr-Knecht-Beziehung, Mattis Charakterzügen, seinem Verhältnis zu Eva und seiner Niederlage am Ende des Stücks. Die Bedeutung der theaterpraktischen Umsetzung der komplexen Figur wird ebenfalls hervorgehoben.
Zur Entwicklung von „Herr Puntila und sein Knecht Matti“: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Stücks während Brechts Exil in Finnland und seine Zusammenarbeit mit Hella Wuolijoki. Es beschreibt Wuolijokis Einfluss, die Nutzung finnischer Volkserzählungen und den Bezug zu Brechts eigenem Werk „Der Gute Mensch von Sezuan“. Der finnische Dramatikerwettbewerb und die damit verbundene finanzielle Motivation werden ebenfalls thematisiert. Die intensive Zusammenarbeit mit Wuolijoki und die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem „Problem des Gutseins“ werden detailliert dargestellt. Die Entstehung des Stückes aus einem Wettbewerbsbeitrag heraus wird mit Quellenangaben belegt.
Matti in „Herr Puntila und sein Knecht Matti“: Dieser Abschnitt bietet eine umfassende Analyse der Figur Matti. Die Beziehung zwischen Puntila und Matti wird im Detail untersucht, wobei das komplexe, von Abhängigkeit und Machtgefällen geprägte Verhältnis beleuchtet wird. Die Analyse der Wesensmerkmale Mattis konzentriert sich auf seinen Charakter, seine Handlungen und seine Rolle im Stück. Sein Verhältnis zu Eva wird unter verschiedenen Aspekten betrachtet – als Gegenpol zu Puntila und als Spiegelbild von Mattis eigenem Wesen. Die Interpretation der „Niederlage“ Mattis am Ende des Stücks wird diskutiert, ebenso die Herausforderungen bei der theatralischen Darstellung dieser vielschichtigen Figur.
Mattis Gegenfiguren in den Brechtschen Vorlagen: Hier werden die vermeintlichen Vorlagenfiguren Jochen Most aus Zuckmayers „Der fröhliche Weinberg“ und Kalle aus Wuolijokis „Die Sägemehlprinzessin“ im Vergleich zu Matti untersucht. Die Diskussion beinhaltet die umstrittene Frage, inwiefern „Der fröhliche Weinberg“ tatsächlich als Vorlage für Brechts „Puntila“ diente. Die Analyse von Kalle konzentriert sich auf den fehlenden Klassengegensatz zwischen Herr und Knecht und dessen Bedeutung im Kontext des Brechtschen Volksstücks.
Das Volksstück bei Brecht: Dieser Abschnitt liefert einen Überblick über Brechts Konzept des Volksstücks und seine Neuentwicklung im Vergleich zu traditionellen Formen. Die „Ausdifferenzierung“ des Charakters Matti wird in den Kontext der Volksstücksentwicklung eingeordnet und bewertet.
Schlüsselwörter
Herr Puntila und sein Knecht Matti, Bertolt Brecht, Hella Wuolijoki, Carl Zuckmayer, Volksstück, Herr-Knecht-Verhältnis, Klassenkampf, Exil, episches Theater, Figurenanalyse, Matti, Puntila, Jochen Most, Kalle, Dramenanalyse, Literaturvergleich.
Häufig gestellte Fragen zu „Herr Puntila und sein Knecht Matti“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Figur des Matti in Bertolt Brechts Stück „Herr Puntila und sein Knecht Matti“. Sie untersucht Mattis Beziehung zu Puntila und Eva, vergleicht ihn mit ähnlichen Figuren aus den Vorlagen „Der fröhliche Weinberg“ (Zuckmayer) und „Die Sägemehlprinzessin“ (Wuolijoki) und betrachtet Brechts Volksstückkonzept.
Welche zentralen Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Frage ist, inwieweit die Vorlagenfiguren als Inspiration oder Gegenbilder für Brechts Figur Matti dienten. Weitere Fragen betreffen die Analyse von Mattis Charakter, seiner Beziehung zu Puntila und Eva, sowie die Einordnung des Stücks in Brechts Volksstückkonzept und die Herausforderungen seiner theatralischen Umsetzung.
Welche Quellen werden herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf Bertolt Brechts „Herr Puntila und sein Knecht Matti“, Carl Zuckmayers „Der fröhliche Weinberg“ und Hella Wuolijokis „Die Sägemehlprinzessin“. Sie berücksichtigt auch die Entstehungsgeschichte des Stücks, Brechts Exil in Finnland und die Zusammenarbeit mit Wuolijoki.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, der Entstehungsgeschichte von „Herr Puntila und sein Knecht Matti“, einer detaillierten Analyse der Figur Matti, einem Vergleich Mattis mit Gegenfiguren aus den Vorlagen, einer Betrachtung des Brechtschen Volksstücks und einem Fazit.
Wie wird die Figur Matti analysiert?
Die Analyse von Matti umfasst seine Beziehung zu Puntila (Herr-Knecht-Verhältnis), seine Beziehung zu Eva, seine Wesensmerkmale und seine „Niederlage“ am Ende des Stücks. Die Herausforderungen der theatralischen Darstellung dieser komplexen Figur werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Rolle spielen die Vorlagen „Der fröhliche Weinberg“ und „Die Sägemehlprinzessin“?
Die Vorlagen dienen dem Vergleich mit Mattis Figur. Es wird untersucht, ob und inwieweit die Figuren Jochen Most („Der fröhliche Weinberg“) und Kalle („Die Sägemehlprinzessin“) als Vorbilder oder Gegenbilder für Brechts Konzept der Knechtfigur Matti fungieren. Die umstrittene Frage nach der tatsächlichen Vorlage wird ebenfalls diskutiert.
Wie wird Brechts Volksstückkonzept behandelt?
Die Arbeit erläutert Brechts Volksstückkonzept und dessen Neuentwicklung im Vergleich zu traditionellen Formen. Die „Ausdifferenzierung“ des Charakters Matti wird in diesem Kontext eingeordnet und bewertet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Herr Puntila und sein Knecht Matti, Bertolt Brecht, Hella Wuolijoki, Carl Zuckmayer, Volksstück, Herr-Knecht-Verhältnis, Klassenkampf, Exil, episches Theater, Figurenanalyse, Matti, Puntila, Jochen Most, Kalle, Dramenanalyse, Literaturvergleich.
- Quote paper
- David Wieblitz (Author), 2006, Die Darstellung der Figur des Matti in Bertolt Brechts "Herr Puntila und sein Knecht Matti", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78429