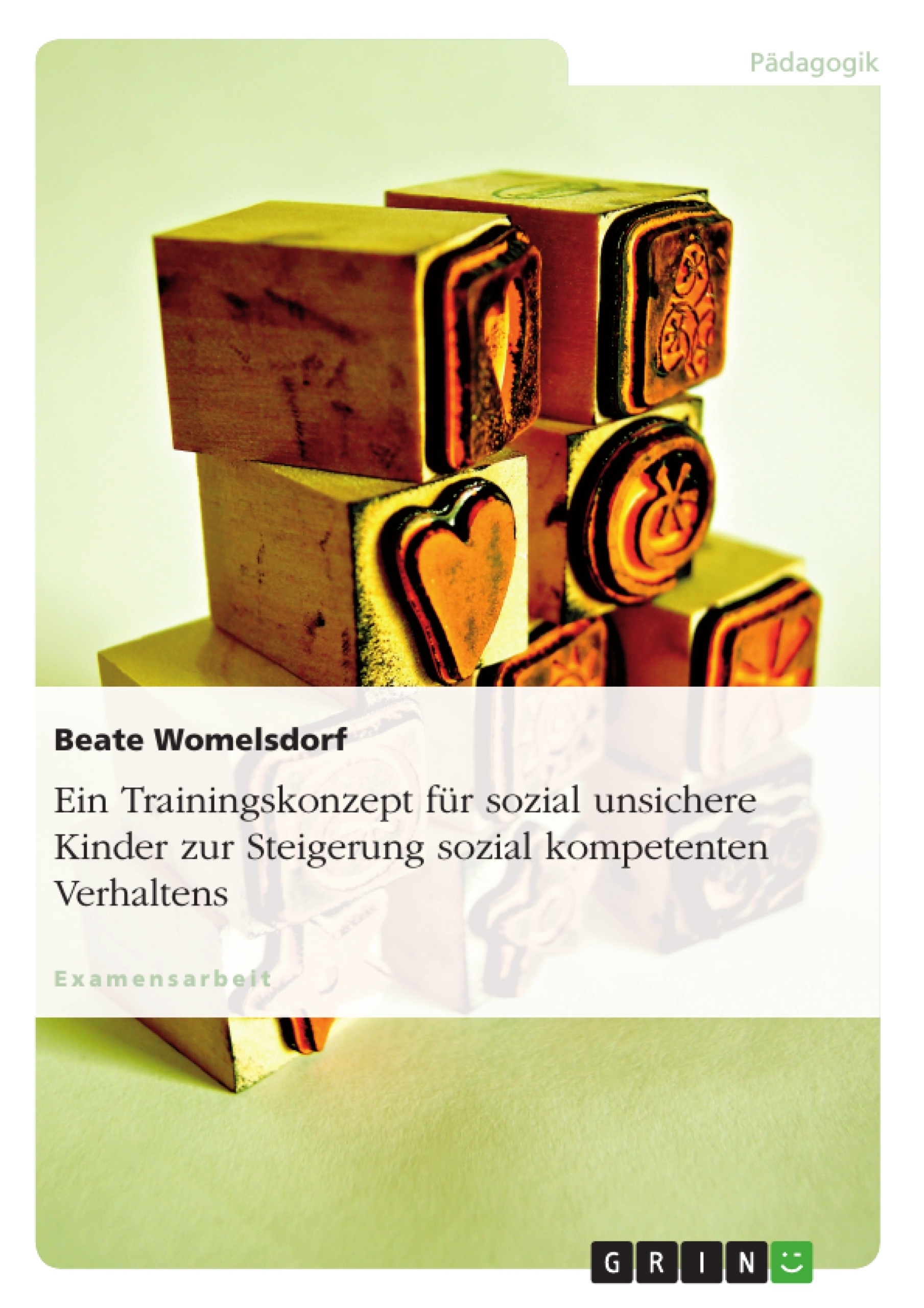Lehrer gehen oftmals davon aus, dass ein Kind mit einem bestimmten Verhaltensrepertoire ausgestattet in die Schule kommt und dieses dort anwendet oder dass diese Fähigkeiten und Fertigkeiten einfach „nebenbei“ erworben werden. Warten, teilen, am Unterricht teilnehmen, Gesprächsregeln beachten, Kontakt zu Mitschülern aufnehmen, sachbezogen diskutieren usw., all das sollte ein Grundschulkind beherrschen. Bei vielen Schülern kann man jedoch erleben, dass genau diese Verhaltensgrundlagen noch nicht oder nur unzureichend vorhanden sind. Was tun?
Wie der Titel schon sagt, beschäftigt sich diese Arbeit mit der Konzeption eines Trainings für sozial unsichere Kinder.
Das große Problem dieser Kinder ist paradoxerweise, dass sie im Unterricht nicht auffallen. Indem sie sich scheinbar gut benehmen und für andere weder störend noch gefährlich sind, wie es bei hyperaktiven und aggressiven Kindern der Fall sein kann, bringen sie Lehrer und Eltern nicht unter Handlungsdruck und werden somit oftmals einfach übersehen. So wird ihr Problem, das sie sozusagen intern mit sich selbst austragen, nur selten bedacht und noch seltener darauf eingegangen.
Nicht zuletzt versucht daher diese Arbeit die Leser auf den zumeist großen Leidensdruck solcher Kinder aufmerksam zu machen und ihnen mögliche Interventionsmaßnahmen an die Hand zu geben, damit sie für dieses Thema sensibilisiert werden und sie künftig ein bloßes Übergehen dieser Kinder als unangemessen und unbefriedigend erachten.
Zu diesem Zweck sind mittlerweile mehrere, theoretisch fundierte und empirisch überprüfte Trainingskonzepte für sozial unsichere Kinder auf dem Markt erschienen, bei denen der Präventionsgedanke im Vordergrund steht. Dreien dieser Konzepte („Training mit sozial unsicheren Kindern“ von PETERMANN und PETERMANN; „Gruppentraining für ängstliche und sozial unsichere Kinder und ihre Eltern“ von MAUER-LAMBERT, LANDGRAF und OEHLER; „Mutig werden mit Til Tiger“ von AHRENS-EIPPER und LEPLOW) wurden einzelne Bestandteile entnommen und aus diesen und eigenen Ideen ein, auf die im Titel genannten Kinder, individuell zugeschnittenes Konzept erstellt.
Die Zielsetzung besteht darin, den beiden eine Möglichkeit zu eröffnen, aus ihrer Passivität herauszutreten und ihrem Umfeld sozial aktiv und weitgehend kompetent zu begegnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Bestandsaufnahme als Anlass für die Zielsetzung „Steigerung sozial kompetenten Verhaltens“
- 3 Hintergrundinformationen zu „Sozialer Unsicherheit“
- 3.1 Definition und Erscheinungsbild
- 3.2 Begleiterscheinungen und Folgen
- 3.3 Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit als Erklärungsgrundlage
- 3.4 Verlauf und Stabilität
- 3.5 Aufrechterhaltung durch soziale Angst
- 4 Ziele des Trainings und Evaluationskriterien
- 5 Darstellung des Konzepts „Training für sozial unsichere Kinder“
- 5.1 Entwicklung des Konzepts
- 5.2 Äußerer Rahmen des Trainings
- 5.3 Ablauf der Trainingssitzungen
- 6 Verlauf des Trainings
- 7 Evaluation
- 8 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschreibt die Konzeption eines Trainings für sozial unsichere Kinder der zweiten Klasse, um deren sozial kompetentes Verhalten zu steigern. Die Autorin identifiziert einen Bedarf an Interventionen für schüchterne und zurückgezogene Kinder, die im Unterricht oft übersehen werden. Das Training soll den Kindern helfen, aus ihrer Passivität auszubrechen und sozial aktiver zu werden. Die Arbeit beleuchtet zudem die Bedeutung der Elternberatung im Zusammenhang mit dem Kindertraining.
- Entwicklung und Implementierung eines Trainingskonzepts für sozial unsichere Kinder
- Analyse der sozialen Unsicherheit und deren Auswirkungen auf betroffene Kinder
- Beschreibung und Evaluation des Trainingsverlaufs
- Bedeutung der Elternarbeit zur Stabilisierung der Fortschritte
- Reflexion der Lehrerrolle im Kontext der Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Problematik sozial unsicherer Kinder in der Grundschule, die oftmals übersehen werden, da sie nicht auffällig im negativen Sinne sind. Die Autorin erläutert ihre Motivation für die Arbeit, die aus persönlichen Erfahrungen und der Beobachtung zweier Kinder (Jan und Julia) resultiert. Sie betont die Notwendigkeit von Interventionen und die Integration von bestehenden Trainingskonzepten in ein individuelles Programm.
2 Bestandsaufnahme als Anlass für die Zielsetzung „Steigerung sozial kompetenten Verhaltens“: Dieses Kapitel beschreibt die Ausgangssituation und die Notwendigkeit eines Trainings für sozial unsichere Kinder. Es legt dar, welche Defizite bei Jan und Julia beobachtet wurden und warum ein gezieltes Training notwendig ist, um ihr sozial kompetentes Verhalten zu verbessern. Es wird vermutlich ein Fragebogen oder eine andere Methode der Bestandsaufnahme vorgestellt.
3 Hintergrundinformationen zu „Sozialer Unsicherheit“: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Darstellung des Phänomens "Soziale Unsicherheit". Es definiert den Begriff, beschreibt das Erscheinungsbild, die Begleiterscheinungen und Folgen. Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit wird als mögliche Erklärungsgrundlage diskutiert, ebenso wie der Verlauf, die Stabilität und die Aufrechterhaltung der sozialen Angst. Dieses Kapitel legt die theoretische Grundlage für das Verständnis der Problematik.
4 Ziele des Trainings und Evaluationskriterien: In diesem Kapitel werden die konkreten Ziele des Trainings für sozial unsichere Kinder formuliert und die Kriterien für die Evaluation des Trainings festgelegt. Es wird dargelegt, welche messbaren Erfolge erwartet werden und wie der Erfolg des Trainings gemessen wird. Hier wird der Rahmen für die spätere Evaluation geschaffen.
5 Darstellung des Konzepts „Training für sozial unsichere Kinder“: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das entwickelte Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder. Es umfasst die Entwicklung des Konzepts, den äußeren Rahmen des Trainings (z.B. Ort, Zeit, Gruppengröße) und den Ablauf der einzelnen Trainingssitzungen. Die Autorin erklärt hier, wie sie aus verschiedenen bestehenden Konzepten Elemente ausgewählt und diese zu einem individuellen Training zusammengefügt hat. Das Kapitel beschreibt den Aufbau und die Inhalte der Trainingseinheiten.
6 Verlauf des Trainings: Dieses Kapitel dokumentiert den tatsächlichen Ablauf des Trainings. Es beschreibt, wie die einzelnen Trainingseinheiten durchgeführt wurden und welche Beobachtungen während des Trainings gemacht wurden. Es beinhaltet wahrscheinlich eine detaillierte Aufzeichnung der Fortschritte und Herausforderungen während der Durchführung des Trainings.
7 Evaluation: In diesem Kapitel wird das Training evaluiert und die Ergebnisse werden interpretiert. Es wird ausgewertet, inwieweit die gesteckten Ziele erreicht wurden und welche Schlussfolgerungen sich aus der Evaluation ziehen lassen. Hier wird der Erfolg des Trainings im Hinblick auf die vorher definierten Kriterien beurteilt.
Schlüsselwörter
Soziale Unsicherheit, sozial kompetentes Verhalten, Training, Grundschule, Kinder, Evaluation, Intervention, Elternarbeit, Angst, Schüchternheit, Prävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Training für sozial unsichere Kinder
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit beschreibt die Konzeption, Durchführung und Evaluation eines Trainings für sozial unsichere Kinder der zweiten Klasse. Ziel ist die Steigerung ihres sozial kompetenten Verhaltens.
Welche Probleme werden adressiert?
Die Arbeit fokussiert auf die Problematik sozial unsicherer Kinder in der Grundschule, die oft übersehen werden, da sie nicht auffällig im negativen Sinne sind. Konkret geht es um Schüchternheit, Zurückgezogenheit und die daraus resultierenden Schwierigkeiten im sozialen Umgang.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Bestandsaufnahme, Hintergrundinformationen zu sozialer Unsicherheit (inkl. Definition, Erscheinungsbild, Folgen und der Theorie der erlernten Hilflosigkeit), Zielsetzung und Evaluationskriterien, Darstellung des Trainingskonzepts (Entwicklung, Rahmen, Ablauf), Verlauf des Trainings, Evaluation und Ausblick.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung eines individuellen Trainingsprogramms, welches auf bestehenden Konzepten basiert. Es wird eine Bestandsaufnahme der Ausgangssituation durchgeführt (wahrscheinlich mittels Fragebogen). Der Trainingsverlauf wird dokumentiert und die Ergebnisse werden evaluiert, um den Erfolg des Trainings zu messen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorie der erlernten Hilflosigkeit als Erklärungsgrundlage für soziale Unsicherheit. Es werden Definitionen und Erscheinungsbilder sozialer Unsicherheit erläutert, sowie deren Folgen und Aufrechterhaltung durch soziale Angst.
Welche Ziele verfolgt das Training?
Das Training zielt darauf ab, das sozial kompetente Verhalten sozial unsicherer Kinder zu steigern, indem es ihnen hilft, aus ihrer Passivität auszubrechen und sozial aktiver zu werden.
Wie wurde das Training evaluiert?
Die Evaluation des Trainings wird anhand vorher festgelegter Kriterien durchgeführt und bewertet, inwieweit die gesteckten Ziele erreicht wurden. Die Ergebnisse werden interpretiert und Schlussfolgerungen gezogen.
Welche Rolle spielen die Eltern?
Die Arbeit betont die Bedeutung der Elternberatung im Zusammenhang mit dem Kindertraining zur Stabilisierung der Fortschritte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Soziale Unsicherheit, sozial kompetentes Verhalten, Training, Grundschule, Kinder, Evaluation, Intervention, Elternarbeit, Angst, Schüchternheit, Prävention.
Gibt es einen Ausblick?
Die Arbeit enthält ein Kapitel mit einem Ausblick, der wahrscheinlich weitere Forschungsschwerpunkte und mögliche Verbesserungen des Trainingskonzepts benennt.
- Quote paper
- Beate Womelsdorf (Author), 2006, Ein Trainingskonzept für sozial unsichere Kinder zur Steigerung sozial kompetenten Verhaltens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78371