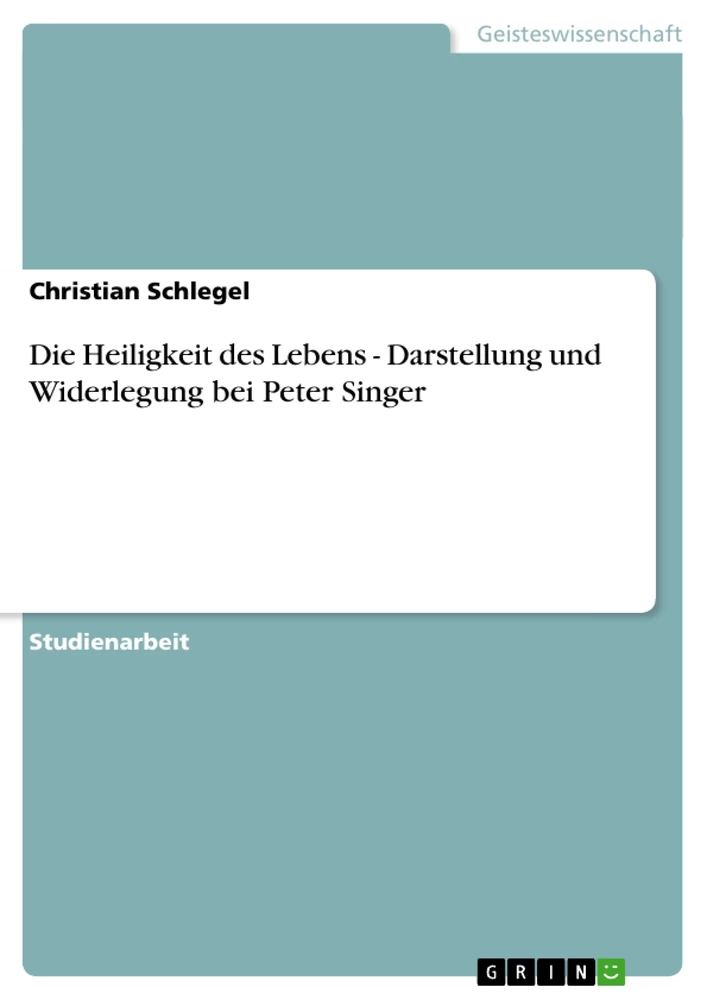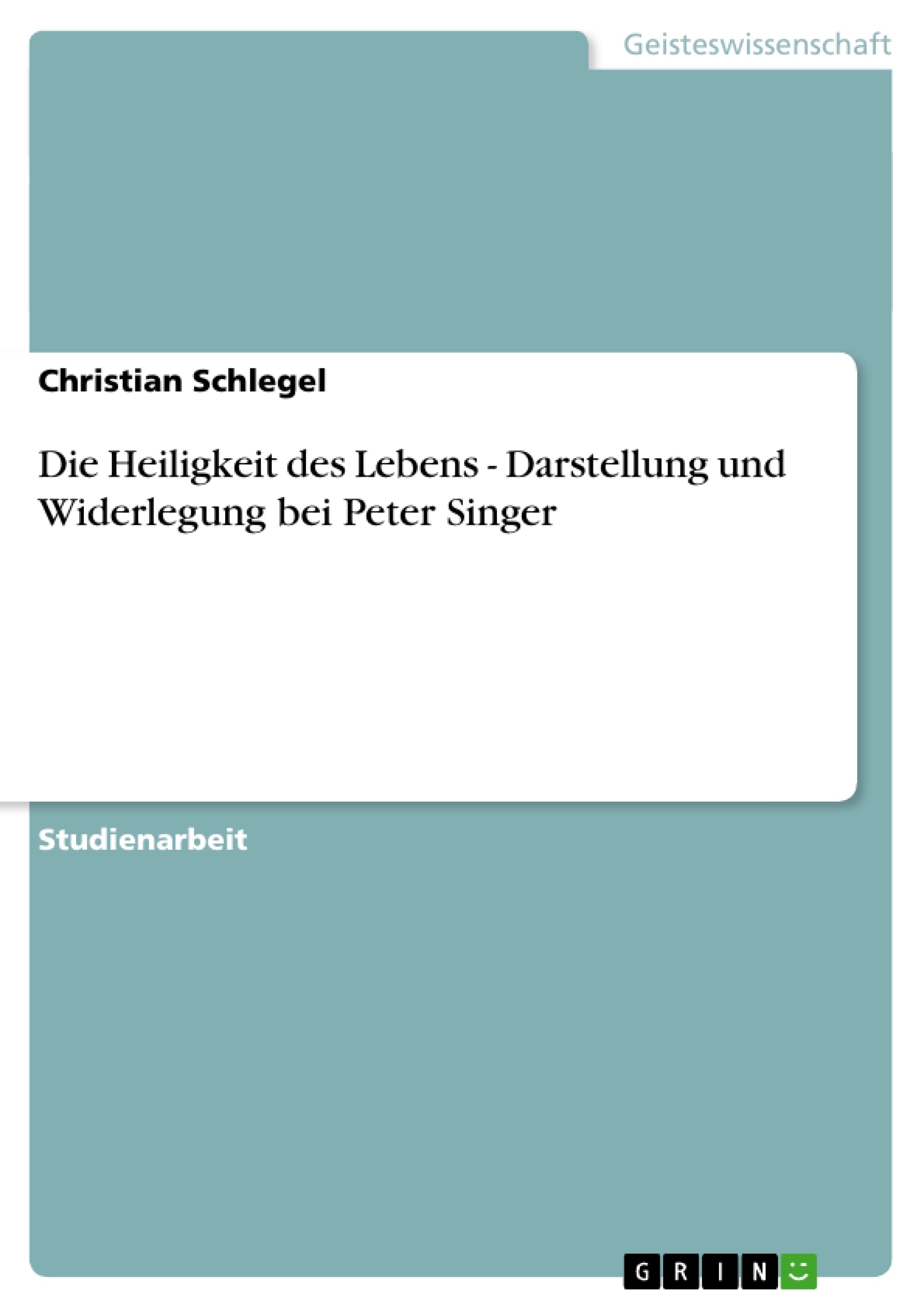„Ich bin Leben unter Leben, das leben will.“1 Diese Einfache Sicht des Wertes von Leben formulierte einmal Albert Schweitzer und drückte damit seinen tiefen Respekt vor allem Leben aus. Dieser Respekt geht über den Bereich menschlichen Lebens weit hinaus und schließt jegliche Form von Leben, sei es tierisch oder gar pflanzlich, mit ein. Er spricht jedem den gleichen Wert zu. Demnach bestünde – überspitzt formuliert – kein moralisch relevanter Unterschied darin, eine Pflanze zu zerstören, ein Tier zu schlachten oder einen Menschen zu töten; jede dieser Taten wäre gleich verwerflich. Das Prinzip der Heiligkeit des Lebens dagegen, besagt jedoch, dass alles menschliche Leben wertvoller ist als alles nicht-menschliche Leben und dass es kein menschliches Leben von unterschiedlichem Wert gibt.2
Ist also doch nicht alles Leben, egal welcher Art, gleich wertvoll? Wodurch unterscheidet sich menschliches Leben von anderem Leben, dass es wertvoller ist? Gibt es elementare Kriterien, durch die sich der Mensch von Tieren und Pflanzen abgrenzt, die nicht von jedem Menschen erfüllt werden können? Wären solche Menschen dann trotzdem von gleichem Wert, wie alle anderen?
Peter Singer und Helga Kuhse vertreten die Meinung, dass diese Position der Gleichheit allen menschlichen Lebens und dessen Mehrwert gegenüber allem anderen Leben unhaltbar sei. Die vorliegende Arbeit wird die wesentlichen Punkte des Prinzips der „Heiligkeit des Lebens“ aufzeigen, und im Anschluss dessen Widerlegung durch Singer und Kuhse nachvollziehen. Abschließend wird noch eine Wertung und Diskussion der Widerlegung folgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Prinzip der Heiligkeit des Lebens
- Allgemein
- Positionen
- Was ist falsch an der „Heiligkeit“ des Lebens?
- Problematik der „Menschlichkeit“
- Zur Christlichen Theologie
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Prinzip der Heiligkeit des Lebens und analysiert dessen Widerlegung durch Peter Singer und Helga Kuhse. Ziel ist es, die zentralen Argumente des Prinzips aufzuzeigen und die Kritik von Singer und Kuhse in Bezug auf die Gleichwertigkeit menschlichen Lebens im Vergleich zu anderen Lebensformen zu beleuchten.
- Der Wert menschlichen Lebens im Vergleich zu anderen Lebensformen
- Die Bedeutung des Prinzips der Heiligkeit des Lebens in der jüdisch-christlichen Tradition und in nicht-religiösen Ethiken
- Die Kritik an der Unhaltbarkeit der Gleichheit aller menschlichen Lebens
- Die Rolle von Kriterien wie Bewusstsein, Rationalität und Autonomie im Hinblick auf den Wert menschlichen Lebens
- Die Diskussion um Euthanasie und die Frage nach der Gleichheit aller Menschen in Bezug auf ihr Recht auf Leben
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf den Wert von Leben, die sich von Albert Schweitzer bis hin zum Prinzip der Heiligkeit des Lebens erstrecken. Die Debatte um den Wert von Leben wird im Kontext der moralischen Verantwortung gegenüber verschiedenen Lebensformen, insbesondere dem menschlichen Leben, betrachtet.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Prinzip der Heiligkeit des Lebens. Es beschreibt die Ursprünge dieses Prinzips in der jüdisch-christlichen Tradition und seine weitreichende Akzeptanz in nicht-religiösen Ethiken. Weiterhin werden verschiedene Positionen zum Wert menschlichen Lebens, die von Sanford Kadish, Reinhard Löw und Immanuel Jakobobits vertreten werden, vorgestellt und diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen wie Heiligkeit des Lebens, Menschlichkeit, Wert des Lebens, Euthanasie, bewusstes Leben, Lebensform, Gleichheit, Rationalität, Autonomie und der jüdisch-christlichen Tradition. Es wird die Kritik an der „Heiligkeit des Lebens“ aus der Sicht von Peter Singer und Helga Kuhse untersucht, die die Unhaltbarkeit der Gleichwertigkeit allen menschlichen Lebens und dessen Mehrwert gegenüber allem anderen Leben hervorheben.
- Quote paper
- Christian Schlegel (Author), 2002, Die Heiligkeit des Lebens - Darstellung und Widerlegung bei Peter Singer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78189