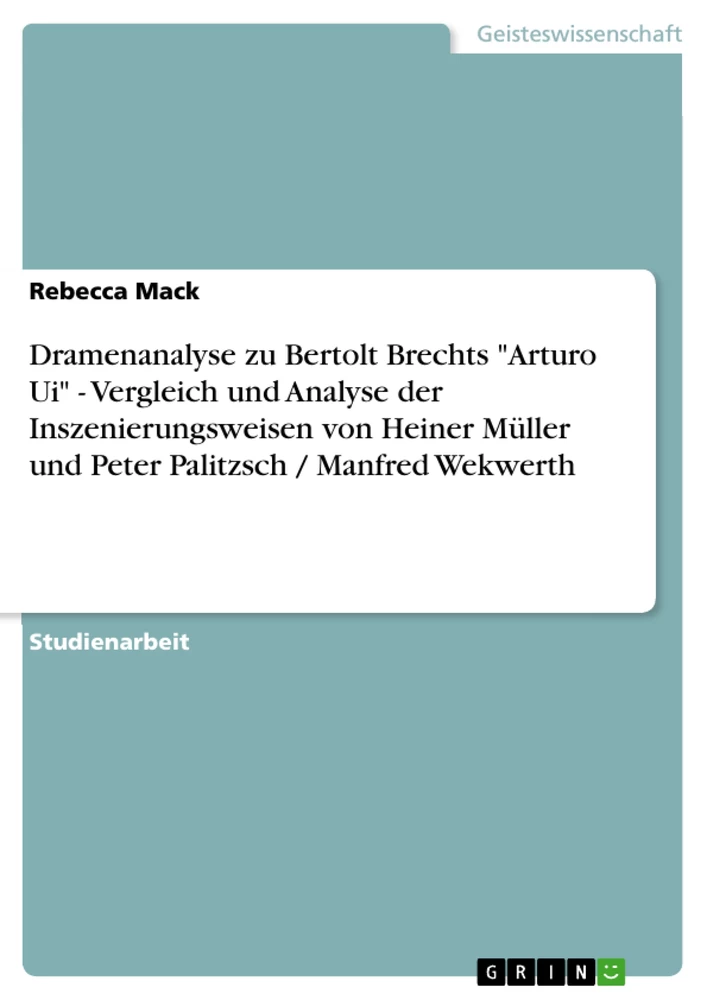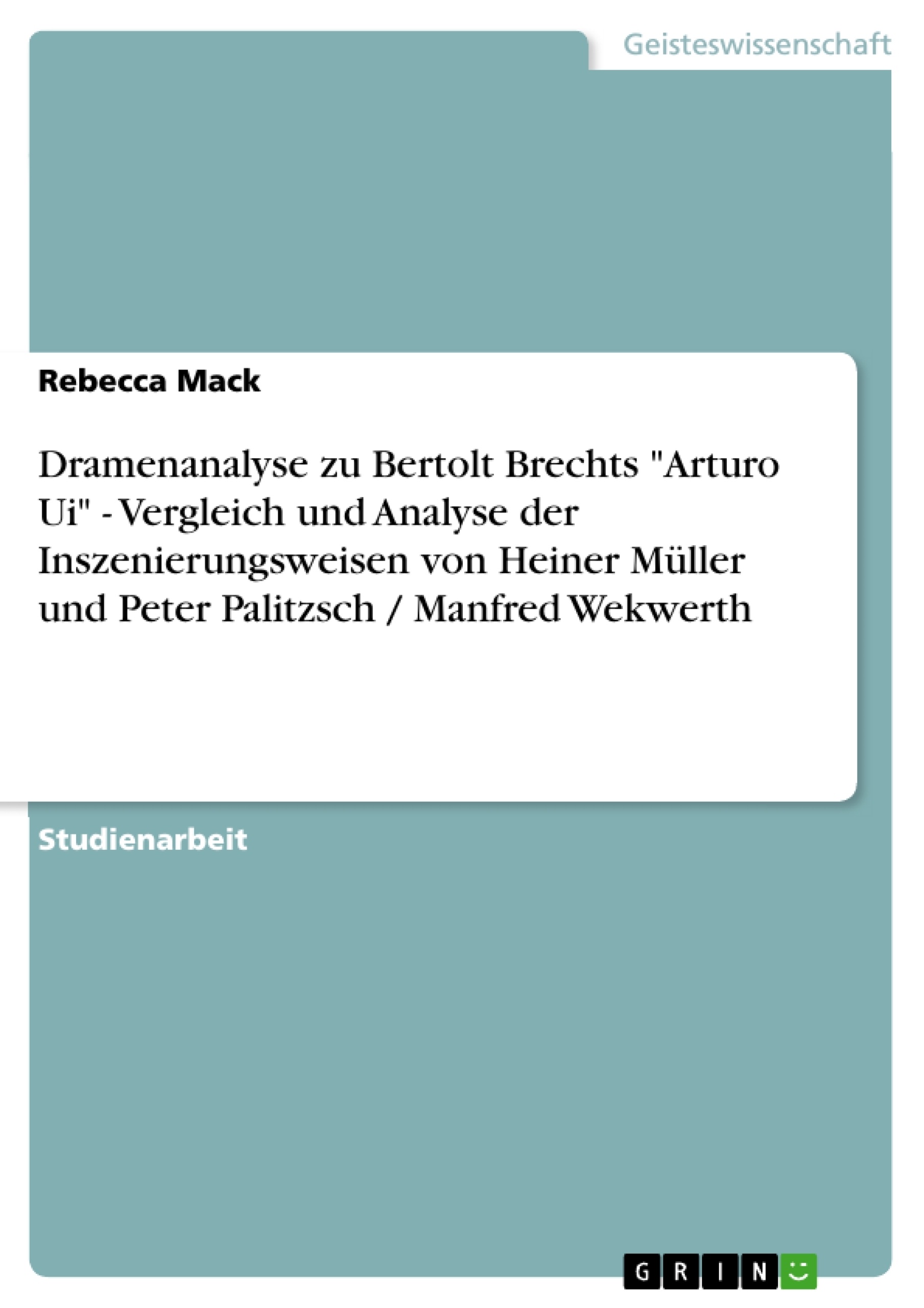Im Jahre 1941 verfasste Bertolt Brecht in seinem finnischen Exil das Drama „Der Aufstieg des Arturo Ui“, in welchem er anhand von leicht durchschaubarer Verfremdung Adolf Hitlers Machtergreifung und die Entstehung des Dritten Reichs für die normale Welt veranschaulicht. Das Drama ist im Chicago der 30er Jahre angesiedelt, in welchem Arturo Ui und sein Gefolge als Gangster im Stile Al Capones ihr Unwesen treiben. Durch die Verfremdung soll dem Publikum der Zusammenhang zwischen Politik, Wirtschaft und dem Faschismus näher gebracht werden. „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ gilt als Paradebeispiel für Brechts Episches Theater, da es nicht in Akte unterteilt ist, sondern aus der Montage mehrerer Szenen und Songs besteht. Damit die Zuschauer selbst auf die Lösung des Problems kommen und ihre politischen Konsequenzen ziehen können, entbehrt das Stück einen eindeutigen Schluss. „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ gilt als „Historienfarce, lehrstückhafte Parabel, oder Gangsterhistorie“ .
Peter Palitzsch, seinerseits einer der wichtigsten Schüler Brechts, inszenierte das genannte Stück gemeinsam mit Manfred Wekwerth 1958 nach Brechts Manier in Stuttgart. In dieser Uraufführung spielte Ekkehard Schall die Rolle des Arturo Ui und stand ganze 600 Mal in dieser Rolle auf der Bühne. 20 Jahre später folgte die berühmte und auch letzte Inszenierung Heiner Müllers, ebenfalls ehemaliges Mitglied in Brechts Gefolge, mit Martin Wuttke in der Titelrolle. Die Aufnahmen des Berliner Ensembles, nach welcher die Szenen analysiert und verglichen werden sollen, stammen aus den Jahren 1974 und 1995. Die berühmteste Szene in „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ ist der Moment, in welchem Ui der alte Schauspieler Mahonney in seine Suite im Mamouthhotel vorgeführt wird. Dieser soll ihm beibringen, eindrucksvoll vor den Leuten zu reden und sich dem entsprechend zu bewegen. Givola steht dieser Angelegenheit sehr kritisch gegenüber. Was die historische Überlieferung angeht, so hat sich Hitler eben zu diesem Zweck einen Provinzschauspieler, namens Basil, zu Hilfe geholt, der ihm das Reden, Gehen und Sitzen beibrachte.
Im Folgenden soll die Schauspielerszene beider Inszenierungen in Bezugnahme auf die „Tätigkeit und Erscheinung der Schauspieler als Zeichen, die Zeichen des Raumes, sowie nonverbale akustische Zeichen“ analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse der Schauspielerszene in der Inszenierung von Palitzsch/Wekwerth
- Die Zeichen des Raumes und nonverbale akustische Zeichen
- Die Tätigkeit des Schauspielers als Zeichen
- Sprachliche Zeichen
- Kinesische Zeichen
- Die Erscheinung der Schauspieler als Zeichen
- Analyse der Szene 6 in der Heiner Müller – Inszenierung
- Die Zeichen des Raumes und nonverbale akustische Zeichen
- Die Tätigkeit der Schauspieler als Zeichen
- Sprachliche Zeichen
- Kinesische Zeichen
- Die Erscheinung des Schauspielers als Zeichen
- Vergleich der beiden Inszenierungen
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Analyse untersucht die Inszenierungsweisen von Peter Palitzsch/Manfred Wekwerth und Heiner Müller der Szene 6 aus Bertolt Brechts "Der Aufstieg des Arturo Ui" am Berliner Ensemble. Das Ziel ist es, die beiden Inszenierungen mithilfe der Semiotik des Theaters zu vergleichen und zu analysieren.
- Analyse der nonverbalen und verbalen Zeichen in der Szene 6
- Vergleich der Darstellungsformen der Schauspieler in beiden Inszenierungen
- Untersuchung der Inszenierungselemente und ihrer Wirkung auf den Zuschauer
- Beziehung zwischen der Inszenierung und der ursprünglichen Intention Brechts
- Rezeption der beiden Inszenierungen im Kontext der historischen und politischen Situation
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Stück "Der Aufstieg des Arturo Ui" vor und erläutert den historischen und politischen Kontext. Sie beschreibt die beiden Inszenierungen und die Besonderheiten der Szene 6.
- Die Analyse der Schauspielerszene in der Inszenierung von Palitzsch/Wekwerth betrachtet die Bedeutung der Zeichen des Raumes, der nonverbalen akustischen Zeichen sowie der sprachlichen und kinesischen Zeichen der Schauspieler.
- Die Analyse der Szene 6 in der Heiner Müller-Inszenierung verfolgt die gleichen Analysemethoden wie zuvor, mit Fokus auf die Unterschiede zu Palitzschs Inszenierung.
- Im Vergleich der beiden Inszenierungen werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der jeweiligen Inszenierungsansätze herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Die Analyse beschäftigt sich mit den wichtigsten Aspekten der theatralischen Zeichen, wie sie von Erika Fischer-Lichte in ihrem Werk "Semiotik des Theaters" definiert werden. Die Untersuchung konzentriert sich auf "Der Aufstieg des Arturo Ui" von Bertolt Brecht, sowie die Inszenierungsformen von Peter Palitzsch, Manfred Wekwerth und Heiner Müller. Die Analyse legt besonderen Wert auf die Untersuchung der sprachlichen und nonverbalen Kommunikation der Schauspieler, sowie die Beziehung zwischen Raum, Zeit und Inszenierungsformen.
- Arbeit zitieren
- Rebecca Mack (Autor:in), 2006, Dramenanalyse zu Bertolt Brechts "Arturo Ui" - Vergleich und Analyse der Inszenierungsweisen von Heiner Müller und Peter Palitzsch / Manfred Wekwerth, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78082