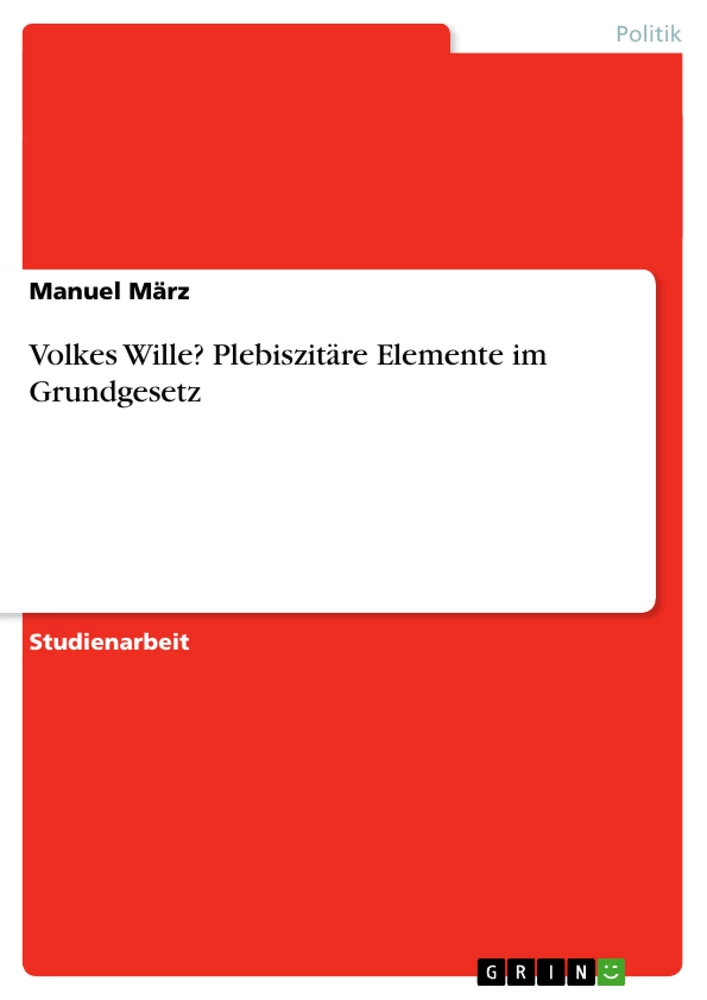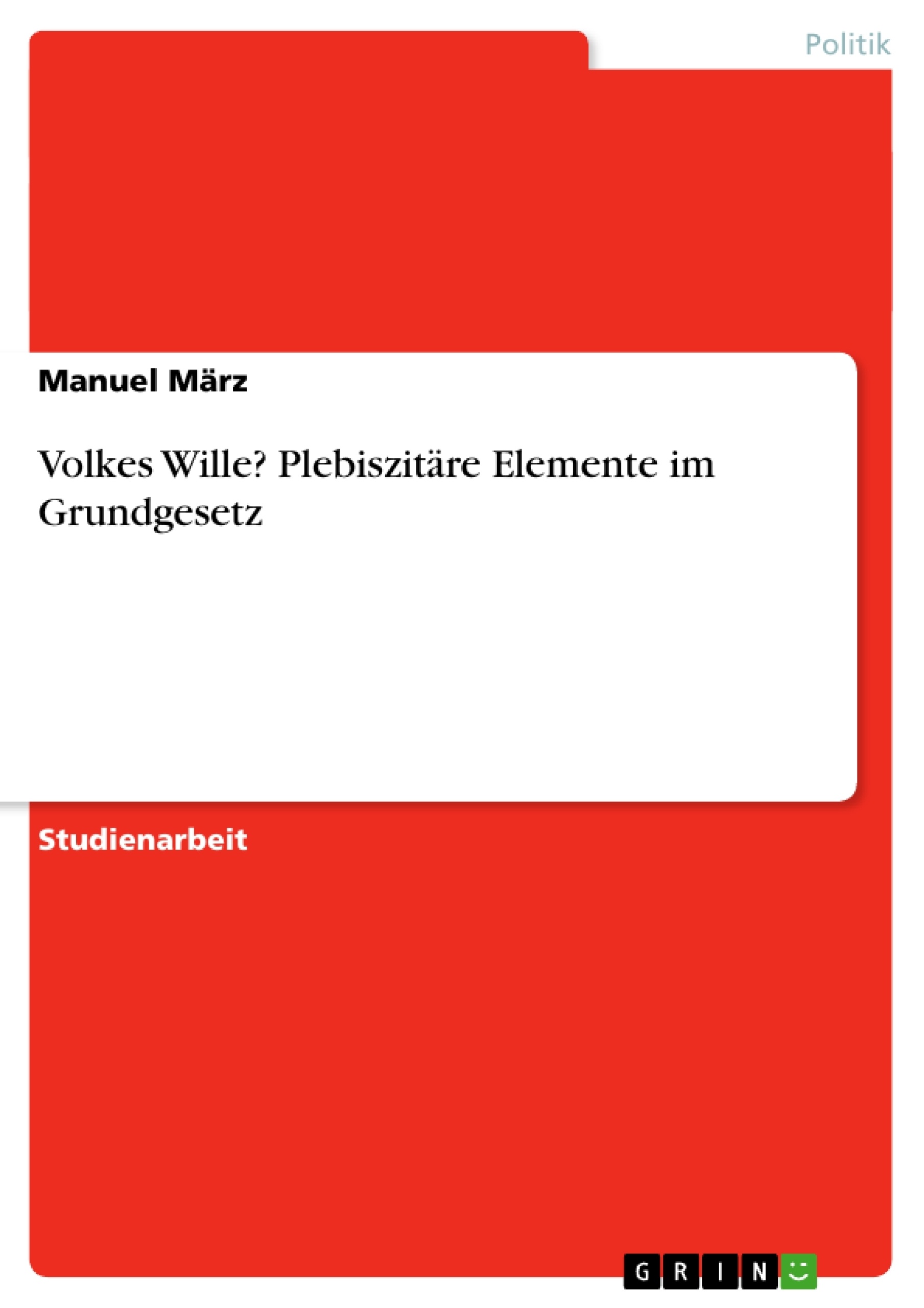Mit der Übernahme des Vorsitzes im Europäischen Rat durch die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, zu Beginn des Jahres 2007 sind hohe Erwartungen von allen Seiten verbunden. Unter anderem hoffen die europäischen Mitgliedsstaaten, dass unter deutscher Führung die Europäische Verfassung weiterentwickelt und wieder auf den Weg gebracht werden kann. Der „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ wurde am 29. Oktober 2004 in Rom unterzeichnet und soll die Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und Europäischen Union ersetzen. Dieser Vertrag wurde von den (damals noch) 25 Mitgliedstaaten zwar unterzeichnet, jedoch trat er damit noch nicht in Kraft. Zuvor bedarf es noch der Ratifizierung der einzelnen Mitgliedsstaaten. Diese Ratifizierung erfolgte in Deutschland durch die Bestimmungen des Art. 59 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG) und Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG und wurde am 12. Mai 2005 vorgenommen. In anderen Staaten war der Vorgang der Ratifikation allerdings wesentlich komplexer, denn hier war ein Volksentscheid vorgesehen. Problematisch war dies vor allem, weil die französische Bevölkerung am 29. Mai 2005 mit 55,6% gegen die Verfassung stimmte und Frankreich den Vertrag somit nicht ratifizierte. Drei Tage später gab es auch in den Niederlanden ein „Nee“ zu den Plänen der Europäischen Union. Hier stimmten sogar 61,8% gegen die Verfassung. Diese Abstimmung war eigentlich nur als eine unverbindliche betrachtet worden, doch auf Grund der hohen Wahlbeteiligung und der deutlichen Ablehnung durch das Volk sah sich die Regierung gezwungen, die Ratifizierung ebenfalls zu versagen. So wurde die mühsam ausgearbeitete Verfassung schon frühzeitig aus den Angeln gehoben, denn viele Staaten legten die Pläne auf Grund der Misserfolge in Frankreich und den Niederlanden vorerst auf Eis. Nicht nur das: Auch in Deutschland wurde Stimmen laut, die kritisierten, dass die Bundesregierung die Verfassung einfach so abgesegnet hatte, ohne, wie in den Nachbarländern geschehen, das Volk zu befragen. Die Frage ist also: Warum wurde dies in Deutschland unterlassen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Volkssouveränität als urdemokratisches Element
- 3. Die Verankerung des Plebiszits im Grundgesetz
- 3.1. Art. 29 GG - Der letzte Rest unmittelbarer Demokratie
- 3.2. Art. 146 GG - Der Artikel ohne Funktion
- 4. Gründe für die spärliche Ausgestaltung
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die plebiszitären Elemente im deutschen Grundgesetz. Sie beleuchtet die historische Entwicklung und die tatsächliche Wirksamkeit dieser Elemente. Die Arbeit beginnt mit einer Erörterung der Volkssouveränität als Grundlage der Demokratie und analysiert anschließend die konkreten Artikel des Grundgesetzes, die sich mit Volksabstimmungen befassen. Abschließend wird der Grund für die geringe Anzahl plebiszitärer Elemente im Grundgesetz untersucht.
- Volkssouveränität und ihre Ausprägung im Grundgesetz
- Analyse der Artikel 29 und 146 des Grundgesetzes
- Historische Entwicklung plebiszitärer Elemente in Deutschland
- Vergleich verschiedener Formen der direkten Demokratie
- Gründe für die spärliche Ausgestaltung plebiszitärer Elemente im Grundgesetz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit der Diskussion um die Ratifizierung der Europäischen Verfassung und den unterschiedlichen Vorgehensweisen in verschiedenen europäischen Ländern. Sie hebt die Debatte um die Notwendigkeit einer Volksbefragung in Deutschland hervor und führt in die Thematik der direkten Demokratie und der verschiedenen Formen der Volksbeteiligung (Volksbefragung, Volksentscheid, Volksbegehren) ein. Der Unterschied zwischen diesen Instrumenten wird präzise definiert, und die geringe Anzahl der plebiszitären Elemente im Grundgesetz wird als Forschungsfrage etabliert. Die Arbeit kündigt an, die Artikel 29 und 146 GG zu untersuchen und die Gründe für deren spärliche Ausgestaltung zu beleuchten.
2. Volkssouveränität als urdemokratisches Element: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Grundsatz der Volkssouveränität (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG). Es hinterfragt die Aussage, dass „alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht“ und diskutiert, ob dies eine Aufforderung zu stärkerer direkter Demokratie darstellt. Der Abschnitt analysiert die verschiedenen Auslegungen des Prinzips und bezieht sich auf die politischen Philosophien von Aristoteles und Jean-Jacques Rousseau, wobei ihre unterschiedlichen Ansichten zur direkten Demokratie und Repräsentation beleuchtet werden. Das Kapitel differenziert zwischen verschiedenen Auffassungen von Volkssouveränität und deren Implikationen für die Gestaltung der politischen Systeme.
3. Die Verankerung des Plebiszits im Grundgesetz: Dieses Kapitel analysiert die relevanten Artikel des Grundgesetzes, die sich mit der direkten Demokratie befassen. Es untersucht detailliert Art. 29 GG (Änderung des Bundesgebietes) und Art. 146 GG (Vorbereitung eines zukünftigen vereinigten Deutschlands), wobei es deren historische Entwicklung, ihre Rolle und ihre Bedeutung im Kontext des gesamten Grundgesetzes detailliert beschreibt. Die Analyse konzentriert sich auf die praktische Anwendung und die Grenzen dieser Artikel und ihre Relevanz für die gegenwärtige politische Praxis. Es wird eingehend auf den Status Quo und die praktische Relevanz beider Artikel eingegangen.
Schlüsselwörter
Volkssouveränität, Plebiszit, Volksentscheid, Volksbefragung, Grundgesetz, Art. 29 GG, Art. 146 GG, direkte Demokratie, repräsentative Demokratie, Aristoteles, Rousseau, Europäische Verfassung, Ratifizierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Plebiszitäre Elemente im deutschen Grundgesetz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die plebiszitären Elemente im deutschen Grundgesetz, analysiert deren historische Entwicklung und tatsächliche Wirksamkeit. Der Fokus liegt auf der Analyse von Artikel 29 und 146 GG und den Gründen für die spärliche Ausgestaltung plebiszitärer Elemente im Grundgesetz insgesamt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Volkssouveränität als Grundlage der Demokratie, die konkrete Ausgestaltung von Volksabstimmungen im Grundgesetz (insbesondere Art. 29 und 146 GG), die historische Entwicklung plebiszitärer Elemente in Deutschland, den Vergleich verschiedener Formen der direkten Demokratie (Volksbefragung, Volksentscheid, Volksbegehren) und die Gründe für die geringe Anzahl plebiszitärer Elemente im Grundgesetz.
Welche Artikel des Grundgesetzes werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die detaillierte Analyse von Artikel 29 GG (Änderung des Bundesgebietes) und Artikel 146 GG (Vorbereitung eines zukünftigen vereinigten Deutschlands). Es wird deren historische Entwicklung, Rolle und Bedeutung im Kontext des gesamten Grundgesetzes untersucht, inklusive praktischer Anwendung und Grenzen.
Wie wird die Volkssouveränität behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Grundsatz der Volkssouveränität (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG) und diskutiert, ob die Aussage „alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht“ eine Aufforderung zu stärkerer direkter Demokratie darstellt. Es werden verschiedene Auslegungen des Prinzips analysiert und die politischen Philosophien von Aristoteles und Jean-Jacques Rousseau mit ihren unterschiedlichen Ansichten zu direkter Demokratie und Repräsentation herangezogen.
Welche Formen der direkten Demokratie werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet präzise zwischen verschiedenen Formen der direkten Demokratie wie Volksbefragung, Volksentscheid und Volksbegehren. Diese Unterscheidung ist wichtig für das Verständnis der unterschiedlichen Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung an politischen Entscheidungen.
Warum ist die Anzahl plebiszitärer Elemente im Grundgesetz so gering?
Die Arbeit untersucht eingehend die Gründe für die spärliche Ausgestaltung plebiszitärer Elemente im Grundgesetz. Diese Fragestellung bildet einen zentralen Aspekt der Analyse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Volkssouveränität, Plebiszit, Volksentscheid, Volksbefragung, Grundgesetz, Art. 29 GG, Art. 146 GG, direkte Demokratie, repräsentative Demokratie, Aristoteles, Rousseau, Europäische Verfassung, Ratifizierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, die die Thematik einführt und die Forschungsfrage formuliert. Es folgen Kapitel zur Volkssouveränität, zur Analyse der relevanten Artikel im Grundgesetz, und abschließend ein Kapitel mit Schlussfolgerungen. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
- Quote paper
- Manuel März (Author), 2007, Volkes Wille? Plebiszitäre Elemente im Grundgesetz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78005