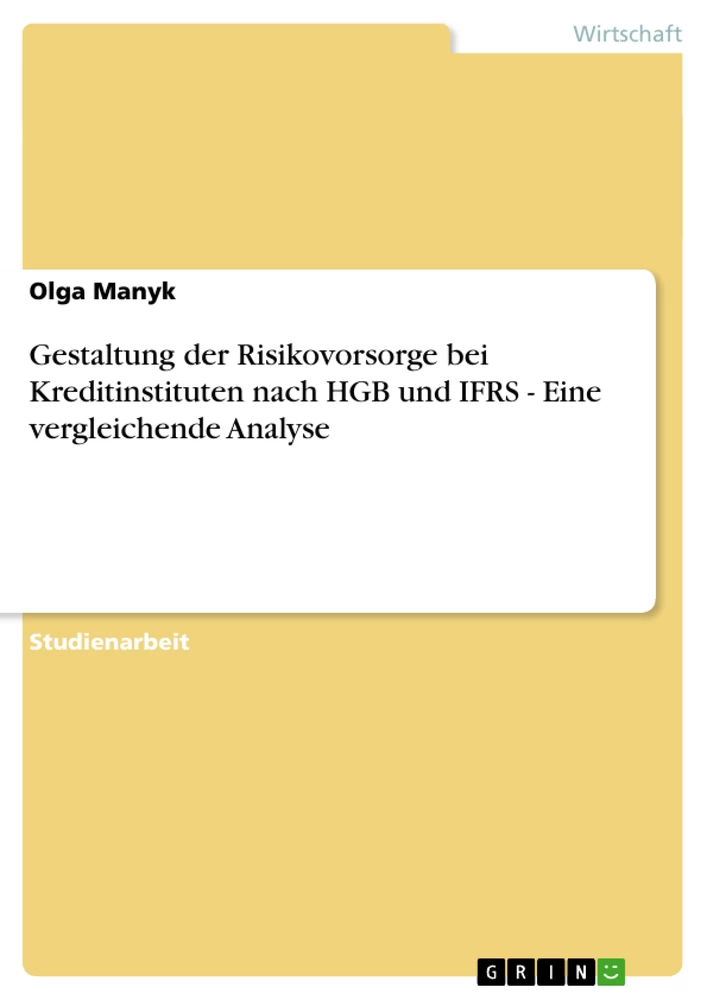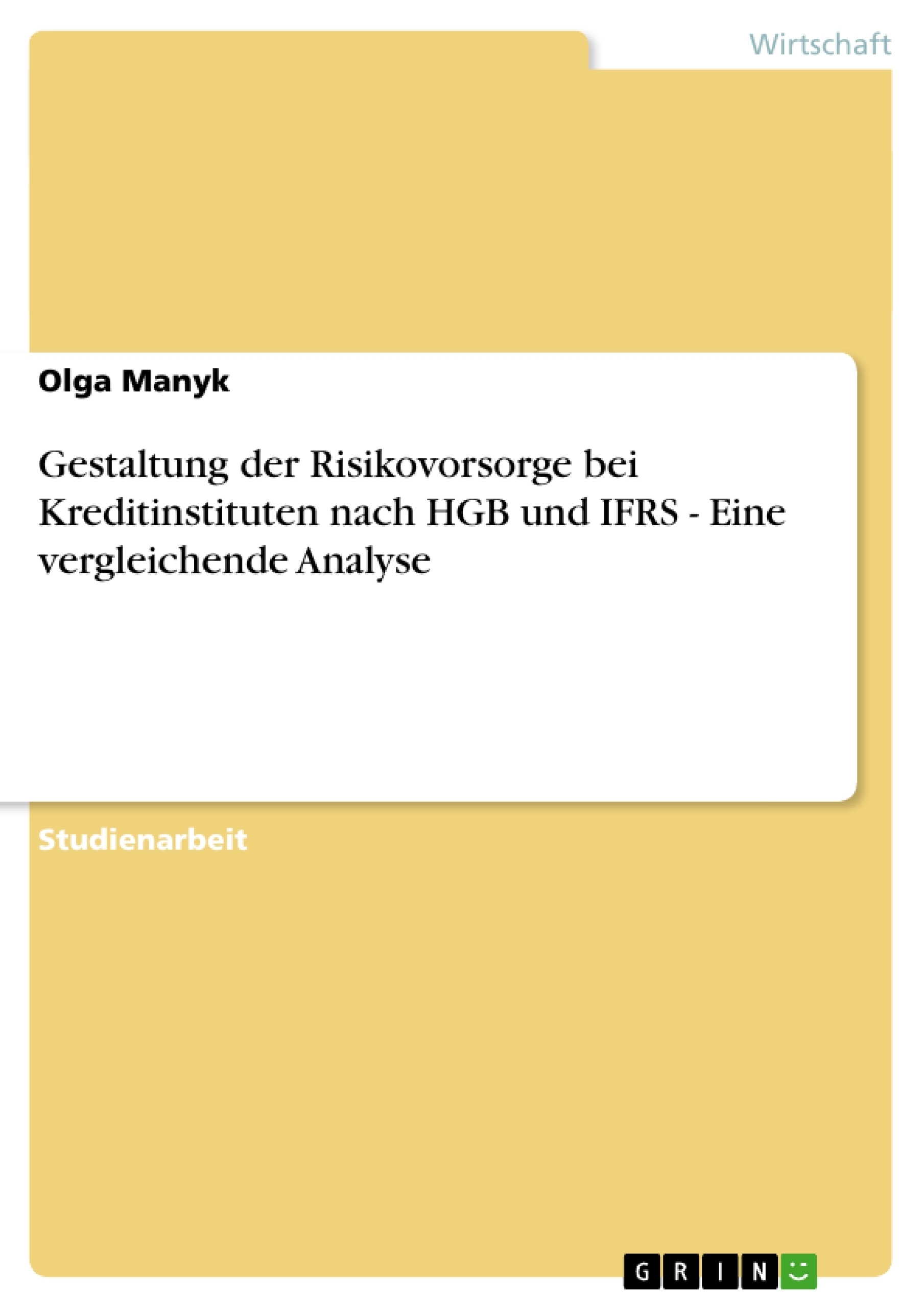Kreditinstitute sind verschiedenen Risiken aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit ausgesetzt. Den Risiken, die nicht primär mit einer Risikopolitik aufgefangen werden, sind durch Risikovorsorge im Jahresabschluss zu begegnen.
Risikovorsorgemaßnahmen von Kreditinstituten sollen verhindern, dass vorhersehbare, aber auch unvorhersehbare Risiken bei ihrem Eintritt das Jahresergebnis negativ beein-flussen und in letzter Konsequenz die Existenz des Kreditinstitutes gefährden. Eine solche Risikovorsorge besitzt für Kreditinstitute eine erhebliche Bedeutung, da sie vor allem auf die Stabilität im Zeitablauf sowie auf die Vergleichbarkeit mit Konkurrenten in ihrem Ergebnisausweis angewiesen sind, um das Vertrauen der Einleger nicht zu verlieren.
Die Aufgabenstellung der Arbeit legt den Fokus explizit auf die Gestaltungsmöglichkeiten der Risikovorsorge bei Kreditinstituten nach HGB (nichtkapitalmarktorientierte kleinere Kreditinstitute) und IFRS (börsennotierte Kreditinstitute) , so dass Aspekte der Rechnungslegung im Mittelpunkt stehen. Dies bedeutet, dass die Arbeit primär die Aufgabe besitzt, die für Kreditinstitute zur bilanziellen Gestaltung der Risikovorsorge relevanten Vorschriften vergleichend und kritisch zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Gestaltung der Risikovorsorge bei Kreditinstituten nach HGB
- 1.1 Begriffliche Abgrenzung und Möglichkeiten der Gestaltung der Risikovorsorge bei Kreditinstituten nach HGB
- 1.2 Bildung und Ausweis der stillen Risikovorsorge nach § 340f HGB
- 1.3 Bildung und Ausweis der offenen Risikovorsorge nach § 340g HGB
- 2 Bildung der Risikovorsorge bei Kreditinstituten nach IFRS
- 2.1 Aktuelle Gestaltung und Ausweis der Risikovorsorge bei Kreditinstituten nach IAS 30
- 2.2 Gestaltung der Risikovorsorge bei Kreditinstituten nach IAS 39
- 2.3 Zukünftiger Ausweis der Risikovorsorge bei Kreditinstituten nach IFRS 7
- 3 Vergleichende Analyse der Regelungen zur Risikovorsorge bei Kreditinstituten nach HGB und IFRS
- 3.1 Konträre Bedeutung der stillen Risikovorsorge bei Kreditinstituten nach HGB und IFRS
- 3.2 Vergleichende Analyse der Regelungen bezüglich der offenen Risikovorsorge nach HGB und IFRS
- 3.3 Vergleichende Analyse der Regelungen bezüglich der Sicherungsgeschäfte nach HGB und IFRS
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert vergleichend die Gestaltung der Risikovorsorge bei Kreditinstituten nach HGB und IFRS. Die Zielsetzung besteht in der kritischen Betrachtung der relevanten Vorschriften und deren Auswirkungen auf die Bilanzierung. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten beider Rechnungslegungsstandards.
- Begriffliche Abgrenzung und Möglichkeiten der Risikovorsorge
- Stille und offene Risikovorsorge nach HGB
- Risikovorsorge nach IAS 30, IAS 39 und IFRS 7
- Vergleichende Analyse der Regelungen nach HGB und IFRS
- Auswirkungen auf die Bilanzierung und die Stabilität von Kreditinstituten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Risikovorsorge bei Kreditinstituten ein. Sie betont die Bedeutung der Risikovorsorge für die Stabilität und das Vertrauen in Kreditinstitute und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf einen Vergleich der Regelungen nach HGB und IFRS konzentriert. Die Arbeit analysiert die bilanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Risikovorsorge und deren Relevanz für die Kreditwirtschaft.
1 Gestaltung der Risikovorsorge bei Kreditinstituten nach HGB: Dieses Kapitel befasst sich mit den grundlegenden Aspekten der Risikovorsorge nach HGB für Kreditinstitute. Es werden zunächst begriffliche Grundlagen geklärt und die bankenspezifischen Besonderheiten der Risikovorsorge erläutert. Anschließend werden die Regelungen zu stiller und offener Risikovorsorge detailliert dargestellt und analysiert. Der Fokus liegt auf den Möglichkeiten der Risikovorsorgebildung und deren Ausweis im Jahresabschluss nach HGB. Die Kapitel analysiert unterschiedliche Methoden wie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen im Rahmen des HGB.
2 Bildung der Risikovorsorge bei Kreditinstituten nach IFRS: Dieses Kapitel untersucht die Regelungen zur Risikovorsorge nach IFRS. Es analysiert die aktuellen Regelungen nach IAS 30, die Ansatz- und Bewertungsmethoden von Sicherungsgeschäften nach IAS 39 und die ab 2007 geltenden Vorschriften nach IFRS 7. Der Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der IFRS-Regelungen mit den HGB-Vorschriften, wobei besonders die Unterschiede in der Gestaltung und dem Ausweis der Risikovorsorge hervorgehoben werden. Der Vergleich umfasst die Behandlung von Sicherungsgeschäften als Absicherungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf den Jahresabschluss.
3 Vergleichende Analyse der Regelungen zur Risikovorsorge bei Kreditinstituten nach HGB und IFRS: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Gegenüberstellung der Risikovorsorge-Regelungen nach HGB und IFRS. Es vergleicht die Behandlung der stillen und offenen Risikovorsorge, sowie die Regelungen zu Sicherungsgeschäften. Die Analyse umfasst eine kritische Bewertung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Systeme und deren Auswirkungen auf die Praxis der Risikovorsorge bei Kreditinstituten. Der Vergleich beleuchtet die konträren Bedeutungen der stillen Risikovorsorge in beiden Systemen und analysiert die Unterschiede in der Behandlung der offenen Risikovorsorge.
Schlüsselwörter
Risikovorsorge, Kreditinstitute, HGB, IFRS, IAS 30, IAS 39, IFRS 7, stille Risikovorsorge, offene Risikovorsorge, Sicherungsgeschäfte, Bilanzierung, Jahresabschluss, Rechnungslegung, Vergleichende Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Gestaltung der Risikovorsorge bei Kreditinstituten nach HGB und IFRS
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert vergleichend die Gestaltung der Risikovorsorge bei Kreditinstituten nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten beider Rechnungslegungsstandards und deren Auswirkungen auf die Bilanzierung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt begriffliche Abgrenzungen der Risikovorsorge, stille und offene Risikovorsorge nach HGB, die Risikovorsorge nach IAS 30, IAS 39 und IFRS 7, einen detaillierten Vergleich der Regelungen nach HGB und IFRS sowie die Auswirkungen auf die Bilanzierung und die Stabilität von Kreditinstituten. Besondere Aufmerksamkeit wird der Behandlung von Sicherungsgeschäften gewidmet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und ein Fazit. Kapitel 1 behandelt die Gestaltung der Risikovorsorge nach HGB, Kapitel 2 die Risikovorsorge nach IFRS und Kapitel 3 einen umfassenden Vergleich beider Systeme. Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert den Aufbau. Jedes Kapitel enthält eine detaillierte Analyse der relevanten Vorschriften.
Welche Aspekte der Risikovorsorge nach HGB werden behandelt?
Kapitel 1 erläutert begriffliche Grundlagen der Risikovorsorge nach HGB, bankenspezifische Besonderheiten und detailliert die Regelungen zur stillen und offenen Risikovorsorge. Die Möglichkeiten der Risikovorsorgebildung und deren Ausweis im Jahresabschluss werden analysiert, einschließlich der Betrachtung verschiedener Methoden wie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.
Welche Aspekte der Risikovorsorge nach IFRS werden behandelt?
Kapitel 2 untersucht die Regelungen zur Risikovorsorge nach IFRS, analysiert die aktuellen Regelungen nach IAS 30, die Ansatz- und Bewertungsmethoden von Sicherungsgeschäften nach IAS 39 und die Vorschriften nach IFRS 7. Der Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich mit den HGB-Vorschriften und der Hervorhebung von Unterschieden in der Gestaltung und dem Ausweis der Risikovorsorge, insbesondere im Hinblick auf die Behandlung von Sicherungsgeschäften.
Wie wird der Vergleich zwischen HGB und IFRS durchgeführt?
Kapitel 3 bietet eine umfassende Gegenüberstellung der Risikovorsorge-Regelungen nach HGB und IFRS. Es vergleicht die Behandlung der stillen und offenen Risikovorsorge und die Regelungen zu Sicherungsgeschäften. Die Analyse beinhaltet eine kritische Bewertung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Systeme und deren Auswirkungen auf die Praxis der Risikovorsorge bei Kreditinstituten, insbesondere die konträren Bedeutungen der stillen Risikovorsorge und die Unterschiede in der Behandlung der offenen Risikovorsorge.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Risikovorsorge, Kreditinstitute, HGB, IFRS, IAS 30, IAS 39, IFRS 7, stille Risikovorsorge, offene Risikovorsorge, Sicherungsgeschäfte, Bilanzierung, Jahresabschluss, Rechnungslegung, Vergleichende Analyse.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt auf eine kritische Betrachtung der relevanten Vorschriften zur Risikovorsorge nach HGB und IFRS und deren Auswirkungen auf die Bilanzierung ab. Sie soll die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Rechnungslegungsstandards aufzeigen und ein besseres Verständnis für die bilanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Risikovorsorge ermöglichen.
- Quote paper
- Olga Manyk (Author), 2006, Gestaltung der Risikovorsorge bei Kreditinstituten nach HGB und IFRS - Eine vergleichende Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77970