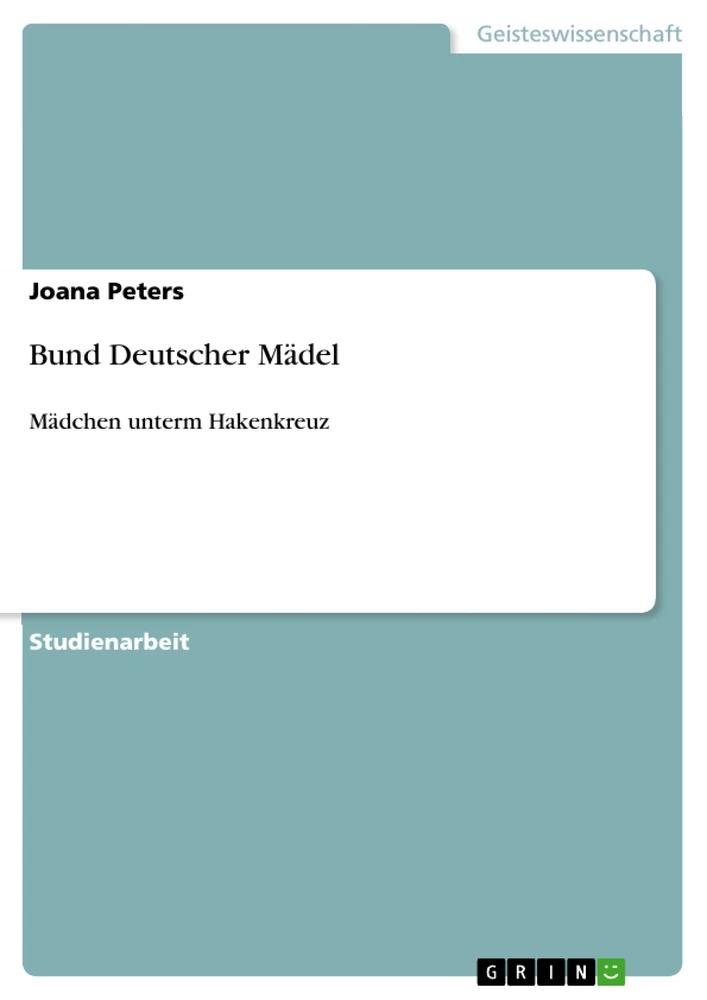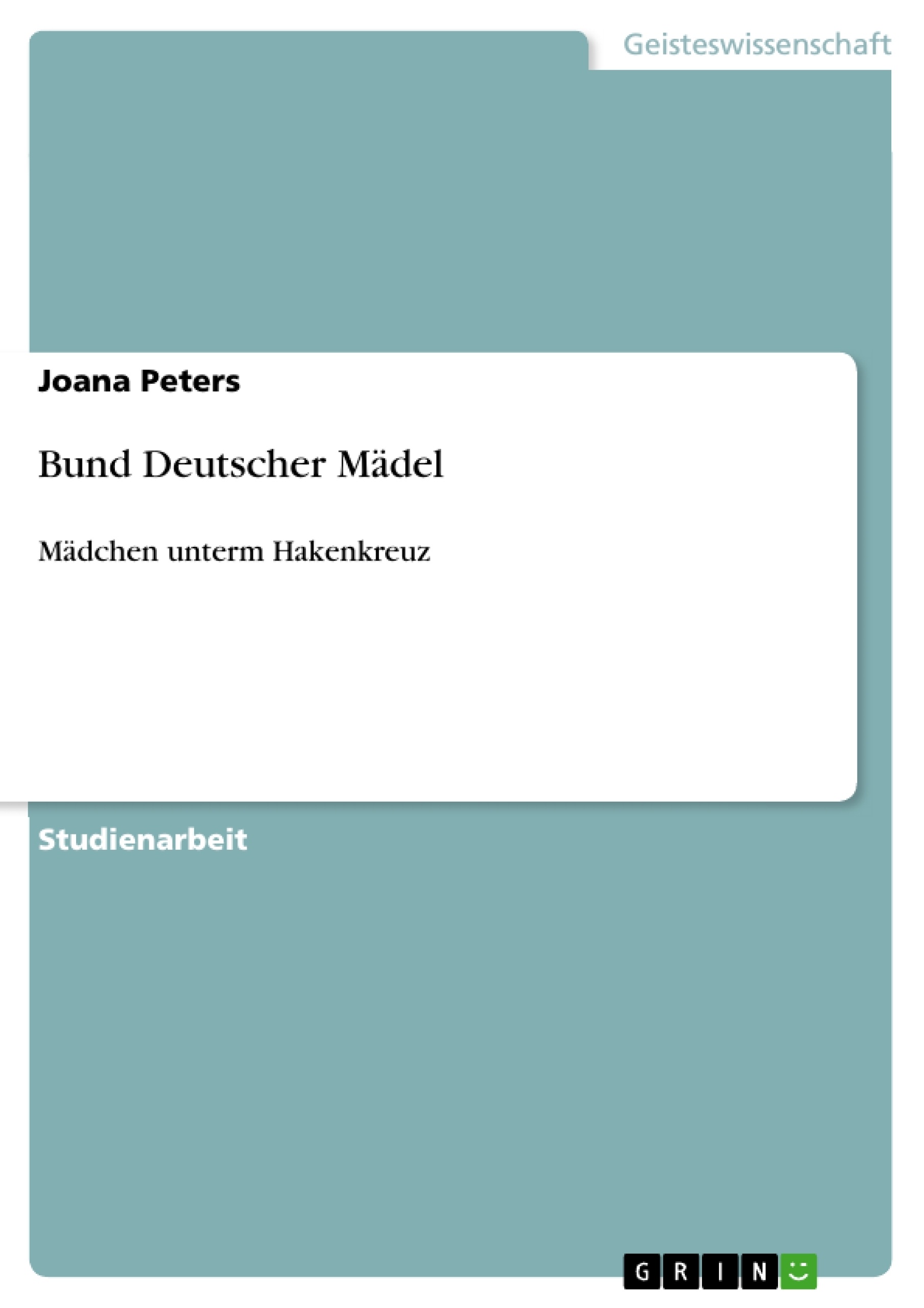Würde man heutzutage eine Umfrage zur weiblichen Emanzipation unter jungen Mädchen durchführen, so würde man über alle sozialen Unterschiede hinweg mit wenigen Ausnahmen ein einheitliches Bild, bezüglich der Vorstellungen und Assoziationen, erhalten, wobei ich behaupte, dass ein Großteil sich als emanzipiert bezeichnen würde.
„Sich von Männern nichts sagen lassen“, „selbstständig sein in Arbeits- und Privatleben“, „wissen was man will und sich das auch nehmen“, könnten geäußerte Gedanken sein, die die Mädchen mit Emanzipation in Verbindung bringen. Jene Aussagen bedingen aber das Wissen um andere soziale Verhältnisse.
Sei es den Mädchen auch nicht stets bewusst, aber das Bewusstsein um ein anderes Rollenbild der Frau wird meist schon von Kind auf an sie herangetragen.
Ob es in diesem Zusammenhang die Mutter oder große Schwester gewesen ist, die ihnen die Wichtigkeit einer eigenständigen Persönlichkeitsentfaltung, besonders unabhängig vom männlichen Einfluss, aufgezeigt hat, sei in diesem Zusammenhang dahingestellt.
Wichtig ist nur, dass von einigen Ausnahmen abgesehen, die patriarchalisierte Weltstruktur zusehends aufgebrochen wird.
Dass dieses Verständnis und Weltbild noch vor rund 60 Jahren undenkbar gewesen wäre, möchte ich im Verlauf meiner Arbeit über den Bund Deutscher Mädel im 3. Reich eingehender beleuchten.
Im Rahmen meiner Arbeit habe ich mich drei Thesen aus meiner Sekundärliteratur verschrieben, die ich anhand ausgewählter Bereiche belegen möchte.
Es gilt darzulegen:
• „Mädchen wurden durch den BDM repressiv eingeengt, ,ausgerichtet`, im ,Volksinteresse` instrumentalisiert, für den Krieg funktionalisiert.
• Mädchen hatten im NS ihr Ich vollkommen aufzugeben; Subjektäußerungen hatten in den Erziehungsvorstellungen des BDM keinen Platz.
• Mädchen wurden vom BDM eingesetzt, von oben und durch Männer bevormundet sowie unselbstständig gehalten.“
Folglich möchte ich die in den Reihen des NS- Staates vor Kriegsbeginn vorherrschende männliche Dominanz und den damit einhergehenden Antifeminismus aufweisen, indem ich deskriptiv vom Internen, sprich der Struktur, zum interpretativen Allgemeinen, dem Leben der Mädchen, überleite. Dabei wird das Ziel der Ausrichtung der Mädchen, mit Hilfe von zugesicherter „Scheinemanzipation“, die Hausfrauen und Mutterrolle zu übernehmen, sichtbar.
Von der typischen Art der Gliederung und meiner persönlichen Schwerpunktsetzung auf ausgewählte, wichtige Bereiche des Lebens der Mädchen, erhoffe ich mir einen klaren aber umfassenden Überblick über die damaligen Verhältnisse vermitteln zu können.
Im selben Zuge ist es mir ein Anliegen mit eventuell bisher bestehenden falschen Eindrücken aufzuräumen.
Während der Beschäftigung mit dem Thema und der Recherchearbeit bin ich auf neue Erkenntnisse gestoßen, die mir zuvor nicht in dem Umfang geläufig waren. Obwohl ich der Annahme war, einen umfassenden Überblick über das Themenfeld aufgrund schulischer Vermittlung und privater Lektüre zu haben, waren mir gewisse Widersprüche von Ideologie zum BDM Selbstverständnis nicht bewusst.
Im Folgenden möchte ich u.a. auf jene verweisen, um das künftige Bild des „deutschen Mädel“ abzurunden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Aufbau des BDM
- Organisationsaufbau
- Die „geschlechterspezifische“ Aufgabenteilung
- Das BDM Selbstverständnis und die Aktivitäten des Bundes
- Die Erziehung und das Mädelbild im NS-Regime
- Das „ganze und gesunde Mädel“
- Der Einsatz für Volk und Staat
- Herausbildung der Gemeinschaft und der „Mädelhaltung“
- Der weibliche Körper
- Sport, Spiel und Tanz
- Kleidung und Körperpflege
- Sexualität
- Schulungsarbeit
- Die Erziehung und das Mädelbild im NS-Regime
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Bund Deutscher Mädel (BDM) im Dritten Reich und beleuchtet die Rolle der Mädchen im NS-Regime. Die Arbeit widerlegt drei Thesen aus der Sekundärliteratur, die eine repressive Einengung, Instrumentalisierung und Bevormundung der Mädchen durch den BDM behaupten. Die Analyse konzentriert sich auf die Organisationsstruktur des BDM, die geschlechterspezifische Aufgabenteilung und die ideologischen Vorstellungen von weiblicher Erziehung im Nationalsozialismus.
- Organisationsstruktur des BDM und das Führerprinzip
- Geschlechterspezifische Rollenverteilung im NS-Staat und im BDM
- Erziehungsziele und -methoden des BDM
- Das Bild des „deutschen Mädchens“ im NS-Regime
- Scheinemanzipation und die Vorbereitung auf die Hausfrauen- und Mutterrolle
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar, indem sie den heutigen emanzipatorischen Selbstverständnis junger Frauen mit der Situation der Mädchen im Dritten Reich kontrastiert. Sie formuliert drei zentrale Thesen, die im Laufe der Arbeit anhand des BDM untersucht und widerlegt werden sollen: die repressive Einengung, Instrumentalisierung und Bevormundung der Mädchen. Die Autorin kündigt einen deskriptiven und interpretativen Ansatz an, der vom internen Aufbau des BDM zum Leben der Mädchen überleitet, um ein umfassendes Bild der damaligen Verhältnisse zu vermitteln.
Der Aufbau des BDM: Dieses Kapitel beschreibt den Organisationsaufbau des BDM, der sich nach Alter (Jungmädelbund und BDM) und Region gliedert. Es wird die hierarchische Struktur, das Führerprinzip und die starre, unbewegliche Gesamtstruktur, im Gegensatz zu den dynamischen Basisgruppen, analysiert. Der Aufbau des BDM spiegelt den der Hitlerjugend wider, mit einer klaren Hierarchie und der Unterordnung der weiblichen Mitglieder unter männliche Führungskräfte. Die Autorin weist auf die soziologische Besonderheit dieser Organisation hin, welche trotz ihrer inneren Widersprüche funktionierte.
Die „geschlechterspezifische“ Aufgabenteilung: Dieses Kapitel beleuchtet die nationalsozialistische Geschlechtsrollenfixierung und die Unterordnung des BDM unter die männliche HJ. Nur ein kleiner Teil der Führungspositionen innerhalb der HJ war mit Frauen besetzt; die höchsten Positionen blieben Männern vorbehalten. Frauen hatten keine eigenständige Entscheidungsgewalt in den Führungsebenen und wurden in ihrer Rolle als zukünftige Hausfrauen und Mütter festgelegt, ihre politische Partizipation wurde stark eingeschränkt.
Schlüsselwörter
Bund Deutscher Mädel (BDM), Nationalsozialismus, Drittes Reich, Mädchen, Erziehung, Geschlechterrollen, Führerprinzip, Hitlerjugend (HJ), Ideologie, Repression, Instrumentalisierung, Emanzipation, Hausfrauenrolle, Mutterrolle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Bund Deutscher Mädel (BDM)
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über eine wissenschaftliche Arbeit zum Bund Deutscher Mädel (BDM) im Dritten Reich. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Organisationsstruktur, der geschlechterspezifischen Aufgabenteilung und der ideologischen Vorstellungen weiblicher Erziehung im Nationalsozialismus. Die Arbeit widerlegt Thesen, die von einer repressiven Einengung, Instrumentalisierung und Bevormundung der Mädchen durch den BDM ausgehen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende zentrale Themen: Die Organisationsstruktur des BDM (inkl. Führerprinzip und hierarchischer Aufbau), die geschlechterspezifische Rollenverteilung im NS-Staat und im BDM, die Erziehungsziele und -methoden des BDM, das Bild des „deutschen Mädchens“ im NS-Regime, die scheinbare Emanzipation und die Vorbereitung auf die Hausfrauen- und Mutterrolle. Es wird auch der weibliche Körper im Kontext von Sport, Spiel, Tanz, Kleidung, Körperpflege und Sexualität beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Der Aufbau des BDM (inkl. Organisationsaufbau und geschlechterspezifischer Aufgabenteilung), Das BDM-Selbstverständnis und die Aktivitäten des Bundes (inkl. Erziehung, Mädelbild, weiblicher Körper), und Resümee.
Welche These wird in der Arbeit widerlegt?
Die Arbeit widerlegt drei Thesen aus der Sekundärliteratur, die behaupten, der BDM habe die Mädchen repressiv eingeengt, instrumentalisiert und bevormundet.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen deskriptiven und interpretativen Ansatz. Sie beginnt mit der Analyse des internen Aufbaus des BDM und erweitert dies um die Lebenswirklichkeit der Mädchen, um ein umfassendes Bild zu vermitteln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bund Deutscher Mädel (BDM), Nationalsozialismus, Drittes Reich, Mädchen, Erziehung, Geschlechterrollen, Führerprinzip, Hitlerjugend (HJ), Ideologie, Repression, Instrumentalisierung, Emanzipation, Hausfrauenrolle, Mutterrolle.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Mädchen im NS-Regime anhand des BDM und widerlegt die These von dessen repressiver Einengung, Instrumentalisierung und Bevormundung der Mädchen. Der Fokus liegt auf der Organisationsstruktur, der geschlechterspezifischen Aufgabenteilung und den ideologischen Vorstellungen weiblicher Erziehung im Nationalsozialismus.
- Quote paper
- Joana Peters (Author), 2004, Bund Deutscher Mädel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77892