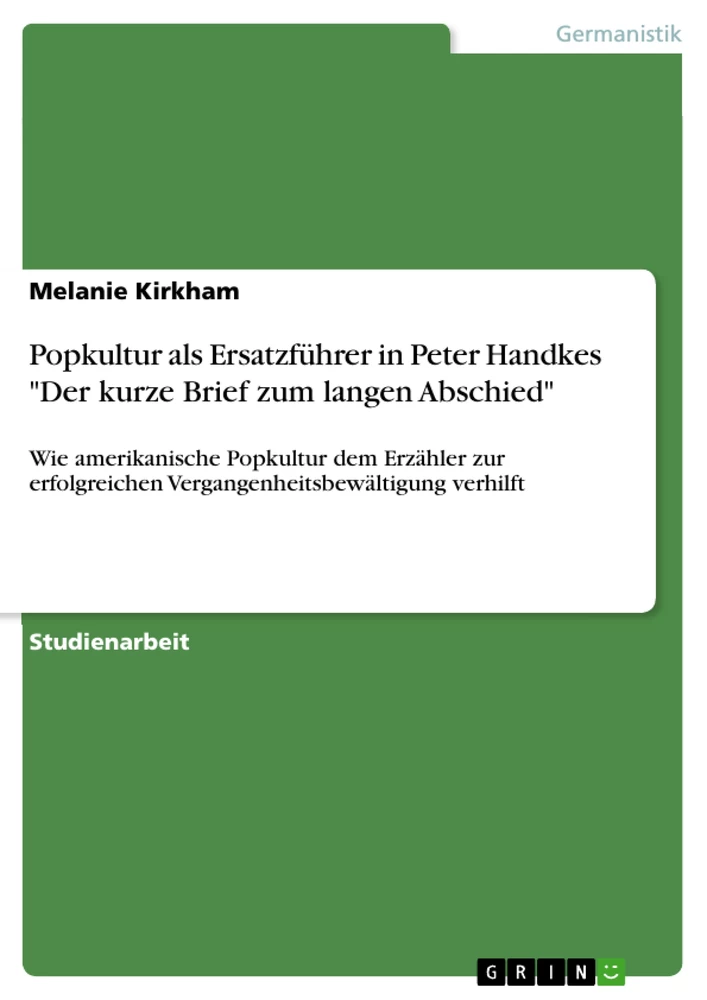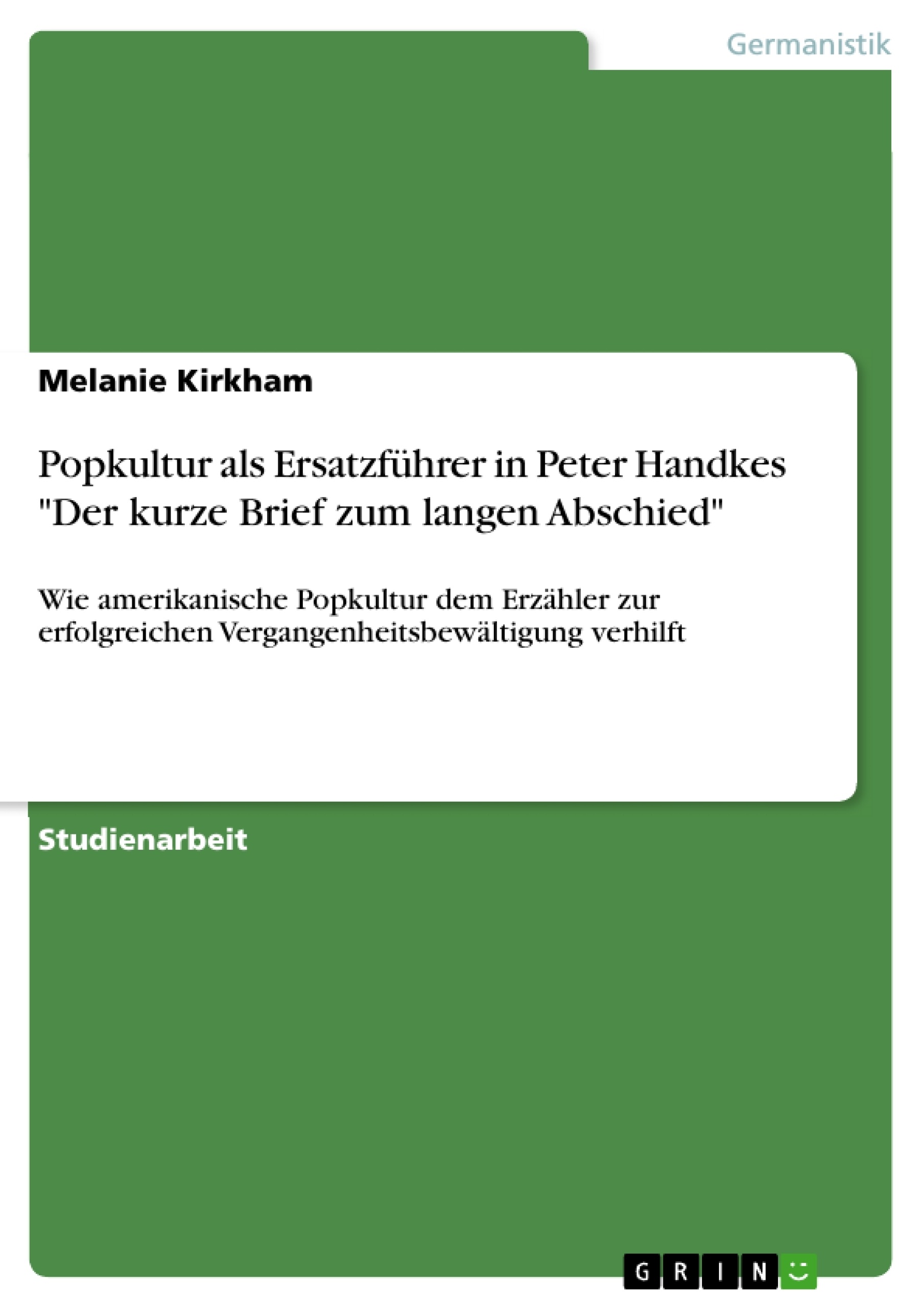In Peter Handkes "Der kurze Brief zum langen Abschied" bereist ein namenloser Oestereicher die Vereinigten Staaten von Boston, ueber New York, St. Louis, Arizona nach Oregon und schliesslich Hollywood. Man kann ihn als nicht nur namenslos, sondern als identitaetslos betrachten. Der verlorene Weltkrieg nahm im diese. Nun kommen Erinnerungen an seine Kindheit nur noch als im Unterbewusstsein unterdrueckte Clips zum Vorschein. Ein Ventil das er zur Vergangenheitsbewaeltigung fuer sich findet ist die amerikanische Popkultur. Durch Filme, Images und andere amerikanische Kultur und Popkultur versucht er sein Leben zu leben. Doch selbst hier brechen die Erinnerungen immer wieder durch. Nach einer Konfrontation mit der amerikanischen Wirklichkeit macht er sich auf seine Vegangnheit zu konfrontieren. Er faehrt nach Oregon um den Bruder zu finden. Seine Reise endet in Hollywood, wo er John Ford und den Mythen der Traumfabrik gegenueber steht.
Popkultur hatte sich fuer den Hauptcharakter zu eine Art Ersatzvater, wenn nicht Ersatzfuehrer entwickelt. Er ist der Repraesentant einer Kultur, Oesterreich, die nicht mit der Vergangenheit abgerechnet hat. Dem Hauptcharakter gelingt es trotz und mit Hilfe Amerikas diesen Vergangenheitsbewaeltigungsprozess in Gang zu setzen. In meinem Paper gehe ich genauer auf die jeweiligen Repraesentationen der Popkultur und ihrer Bedetung ein.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Amerikas Bild in der Popkultur
- Kapitel 3: Vergangenheit und Gegenwart
- Kapitel 4: Popkultur als Ersatzführerfigur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der amerikanischen Popkultur in Peter Handkes Der kurze Brief zum langen Abschied. Der Fokus liegt auf der Funktionsweise der Popkultur als Instrument der Vergangenheitsbewältigung für den Protagonisten und auf der Darstellung des amerikanischen Mythos im Roman.
- Die Konstruktion von Amerika durch Popkultur
- Die Verarbeitung der österreichischen Vergangenheit im Kontext der amerikanischen Reise
- Popkultur als Ersatzführerfigur nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Ambivalenz der Darstellung von Popkultur
- Die Verbindung zwischen persönlicher und nationaler Traumabewältigung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Rolle der amerikanischen Popkultur in Handkes Roman vor. Es skizziert die Reiseroute des Protagonisten durch Amerika und deutet bereits die Bedeutung von Popkultur als Bezugspunkt für seine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit an. Die Einleitung erwähnt die bereits bestehenden Theorien zum amerikanischen Mythos und kündigt die Analyse der Ambivalenz der Popkultur-Darstellung an.
Kapitel 2: Amerikas Bild in der Popkultur: Dieses Kapitel analysiert, wie der Protagonist Amerika durch die Brille der Popkultur wahrnimmt. Handkes Protagonist reist nicht nur physisch durch die USA, sondern auch mental, basierend auf seinen vorab geprägten Bildern aus Filmen und Büchern. Die Kapitel beschreibt, wie diese bereits existierenden Bilder seine Wahrnehmung prägen und wie bekannte amerikanische Symbole (Holiday Inn, John Ford-Western) beim Leser ein Gefühl der Vertrautheit und Zugehörigkeit erzeugen sollen. Die Kapitel analysiert die zwei Amerikas: Das reale und das imaginäre, das sich aus den kollektiven und individuellen Bedürfnissen speist.
Kapitel 3: Vergangenheit und Gegenwart: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Verbindung zwischen der traumatischen österreichischen Vergangenheit des Protagonisten und seiner Reise durch Amerika. Eine frühe Schreckenserinnerung an den Zweiten Weltkrieg wird ausgelöst durch einen Brief seiner Frau und wird in den USA wieder wachgerufen. Die Analyse zeigt, wie der Protagonist seine Vergangenheit im Kontext des amerikanischen Raumes verarbeitet, wobei die Unfähigkeit zur Bewältigung in Österreich durch ein Telefongespräch mit seiner Mutter verdeutlicht wird, das die anhaltenden Vorurteile der Nazizeit aufzeigt. Die Gewalt in seiner Beziehung zu seiner Frau wird als Ausdruck dieser unbewältigten Vergangenheit interpretiert.
Kapitel 4: Popkultur als Ersatzführerfigur: Dieser Abschnitt entwickelt die These, dass amerikanische Popkultur nach dem Zweiten Weltkrieg eine Ersatzführerfigur darstellte und eine alternative Gegenwart bot. Die Kapitel bezieht sich auf die Forschung von Rentschler, um die Gründe für diese Entwicklung zu erläutern und die besondere Anfälligkeit der Deutschen und Österreicher für diese neue Kultur aufgrund ihrer NS-Erziehung zu belegen. Es wird gezeigt, wie der Protagonist durch die Auseinandersetzung mit amerikanischer Popkultur (Filme, Musik, Bücher) seine Vergangenheit unbewusst verarbeitet, was jedoch auch kritisch betrachtet wird. Die Ambivalenz der Popkultur, die sowohl positive als auch negative Aspekte aufweist, wird hier herausgestellt.
Schlüsselwörter
Peter Handke, Der kurze Brief zum langen Abschied, amerikanische Popkultur, Vergangenheitsbewältigung, österreichische Geschichte, Zweiter Weltkrieg, Amerikanischer Mythos, Ersatzführerfigur, Trauma, Identifikation, Ambivalenz.
Häufig gestellte Fragen zu Peter Handkes "Der kurze Brief zum langen Abschied"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Rolle der amerikanischen Popkultur in Peter Handkes Roman "Der kurze Brief zum langen Abschied". Der Fokus liegt auf der Funktionsweise der Popkultur als Instrument der Vergangenheitsbewältigung für den Protagonisten und auf der Darstellung des amerikanischen Mythos im Roman.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Konstruktion von Amerika durch Popkultur, die Verarbeitung der österreichischen Vergangenheit im Kontext der amerikanischen Reise, Popkultur als Ersatzführerfigur nach dem Zweiten Weltkrieg, die Ambivalenz der Darstellung von Popkultur und die Verbindung zwischen persönlicher und nationaler Traumabewältigung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage vor. Kapitel 2 (Amerikas Bild in der Popkultur) analysiert die Wahrnehmung Amerikas durch die Brille der Popkultur. Kapitel 3 (Vergangenheit und Gegenwart) konzentriert sich auf die Verbindung zwischen der traumatischen österreichischen Vergangenheit des Protagonisten und seiner Reise durch Amerika. Kapitel 4 (Popkultur als Ersatzführerfigur) entwickelt die These von der amerikanischen Popkultur als Ersatzführerfigur nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wie wird die amerikanische Popkultur im Roman dargestellt?
Der Roman zeigt, wie der Protagonist Amerika durch die Brille seiner vorab geprägten Bilder aus Filmen und Büchern wahrnimmt. Bekannte amerikanische Symbole erzeugen ein Gefühl der Vertrautheit und Zugehörigkeit. Die Arbeit analysiert das reale und das imaginäre Amerika, das sich aus kollektiven und individuellen Bedürfnissen speist. Die Popkultur wird als ambivalent dargestellt, mit positiven und negativen Aspekten.
Welche Rolle spielt die Vergangenheitsbewältigung im Roman?
Die Vergangenheitsbewältigung des Protagonisten steht im Mittelpunkt der Analyse. Seine traumatische österreichische Vergangenheit, insbesondere seine Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, wird durch die Reise nach Amerika und die Konfrontation mit amerikanischer Popkultur verarbeitet, allerdings nur teilweise und mit anhaltenden Schwierigkeiten. Die Unfähigkeit zur vollständigen Bewältigung in Österreich wird deutlich herausgearbeitet.
Welche Bedeutung hat die amerikanische Popkultur als "Ersatzführerfigur"?
Die Arbeit argumentiert, dass amerikanische Popkultur nach dem Zweiten Weltkrieg für den Protagonisten und möglicherweise auch für eine breitere Generation als eine Art Ersatzführerfigur fungierte und eine alternative Gegenwart bot. Dies wird im Kontext der NS-Erziehung und deren Folgen diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Peter Handke, Der kurze Brief zum langen Abschied, amerikanische Popkultur, Vergangenheitsbewältigung, österreichische Geschichte, Zweiter Weltkrieg, Amerikanischer Mythos, Ersatzführerfigur, Trauma, Identifikation, Ambivalenz.
- Quote paper
- Melanie Kirkham (Author), 2007, Popkultur als Ersatzführer in Peter Handkes "Der kurze Brief zum langen Abschied", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77843