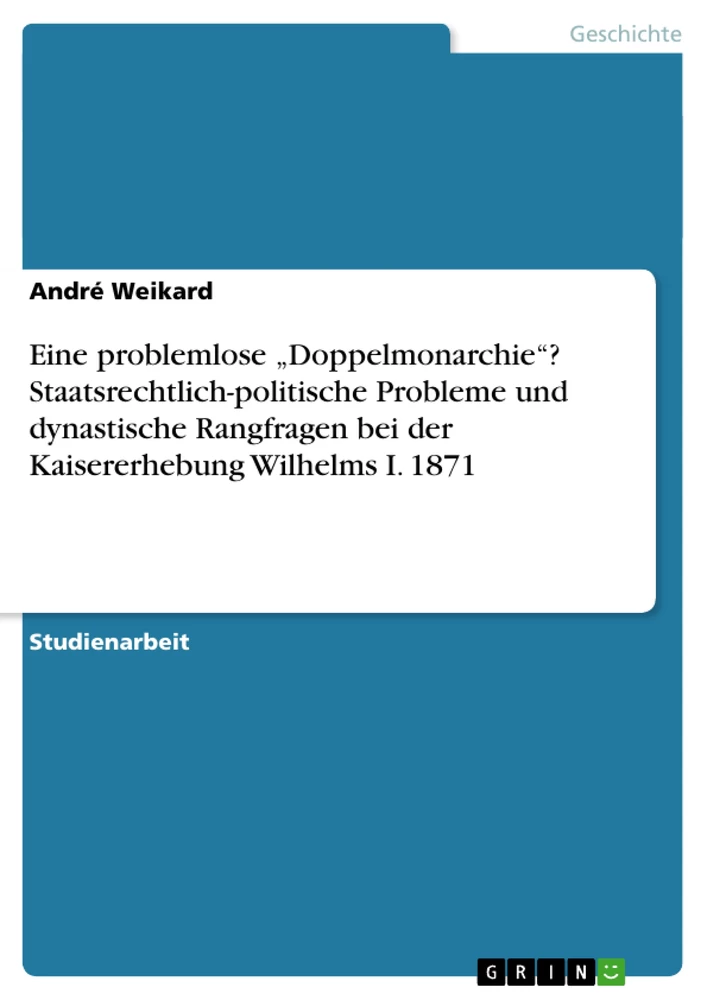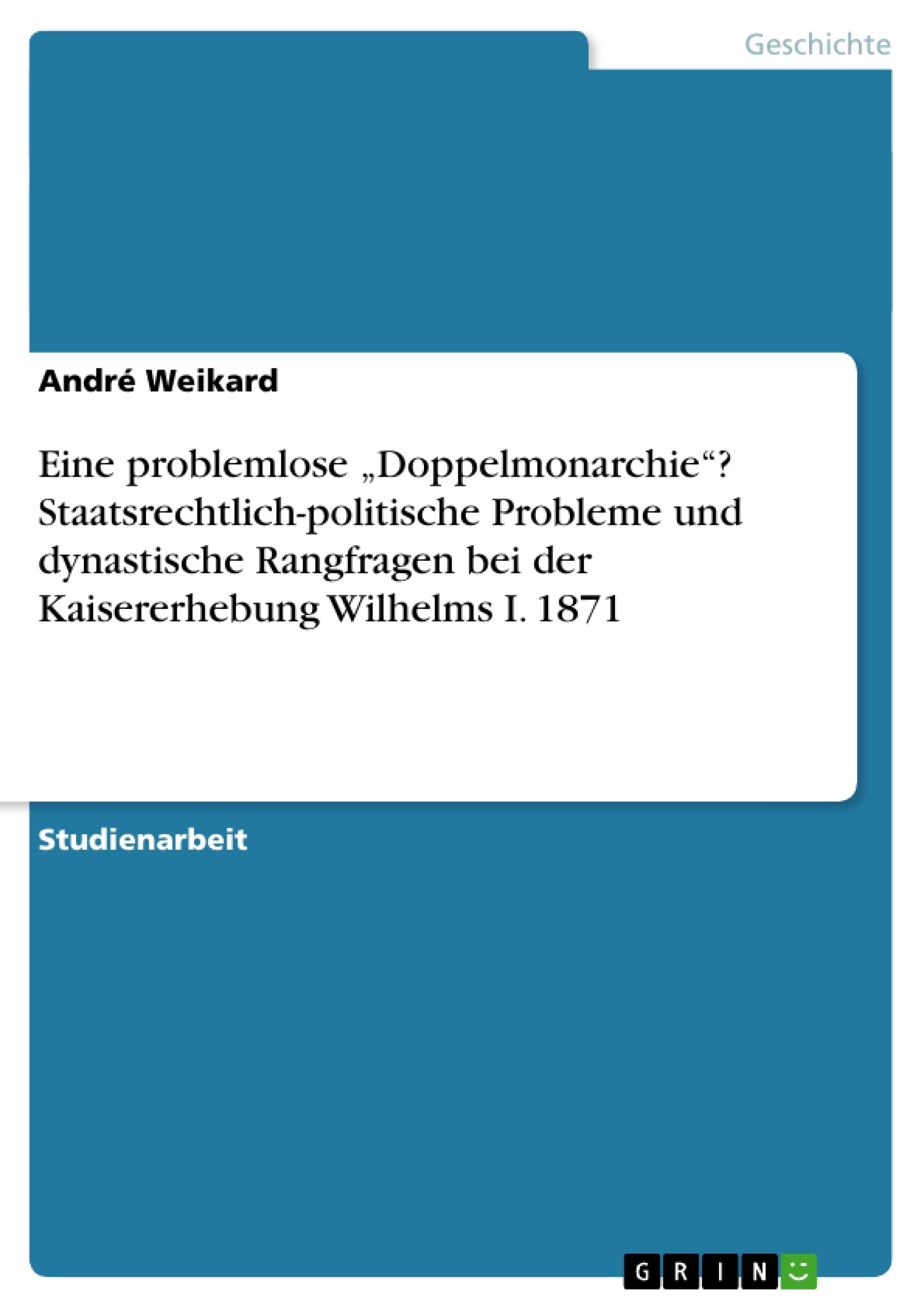Wenn im Titel der vorliegenden Arbeit die Rede von einer Doppelmonarchie ist, so steht der Ausdruck deshalb in Anführungszeichen, weil er der Erläuterung bedarf. Gemeint ist mit der Doppelmonarchie des preußischen Hauses Hohenzollern, das neben der eigenen Königswürde auch die Kaiserwürde des Deutschen Reiches übernahm, nämlich nicht die Herrschaft über zwei unterschiedliche Territorien, die in Personalunion an das gleiche Herrscherhaus fallen, wie es etwa in Österreich-Ungarn der Fall war. Gemeint ist die Vereinigung zweier Ebenen des deutschen Reiches, wie es 1870/71 entstand.
Der zweite Teil des Titels verengt den Gegenstand. Es soll nicht um das Gelingen der Doppelmonarchie gehen, oder etwa darum, welche Probleme sich aus ihr in der Folge ergeben haben, wenn solche Fragen auch nicht völlig ausgeblendet werden können, sondern vielmehr konzentriert sich die Aufmerksamkeit der Fragestellung auf den Erhebungsvorgang. Es sollen vorwiegend seine dynastisch-politischen und juristischen Komplikationen untersucht werden. Wer wollte oder betrieb gar die preußische Rangerhöhung, auf welche Art und Weise und aus welchen Gründen tat er es? Wie verhielten sich vor allem die entscheidenden Protagonisten, Bismarck, der die neue Würde politisch vorbereitet hat, das Königshaus Bayern, als dasjenige, das sie anträgt und nicht zuletzt König Wilhelm von Preußen, der sie entgegennimmt? Die Rolle des Kaisers in der Reichsverfassung wird dabei ebenso zu untersuchen sein, wie politische und mentalitätsgeschichtliche Tendenzen der Zeit. So gehört es zu den Denkvoraussetzungen der Arbeit, dass auch am Ende des 19. Jahrhunderts dynastische Prinzipien immer noch wirksam, ja von hoher Bedeutung seien. Die Gültigkeit dieser Annahme wird im Verlaufe der Betrachtungen ebenfalls nachzuweisen sein.
Des Weiteren lohnt die Beachtung von Fragen der Legitimation der Kaiserwürde, wie sie sich in den konkreten Vorgängen um den bayrischen Kaiserbrief beobachten lassen und der Ebenen auf die jene Würde mutmaßlichen Einfluss haben konnte: Die Politik im Reich, die eigene Bevölkerung, aber auch das europäische Ausland.
Schließlich soll die eigentliche Kaiserproklamation in Versailles, auch sie ein Symptom der Konflikte um das Kaisertum, betrachtet werden. In ihr kulminieren Darstellungsform und damit Selbstverständnis der neuen Würde, nationale Begeisterung und unterschiedliche Vorbehalte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die verfassungsrechtliche Stellung des Kaisers in der Reichsverfassung von 1870/71
- Dynastisches Denken im Zeitalter der Nation
- Die Initiative zur Kaisererhebung
- Bismarck und die Erhebung
- Die Rolle König Ludwigs von Bayern im Zusammenhang mit den Ereignissen um die Erneuerung der Kaiserwürde
- Der Unwille König Wilhelms von Preußen zur Annahme der Kaiserwürde
- Die Kaiserproklamation
- Die Wahrnehmung der deutschen Kaisererhebung im europäischen Ausland
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die komplizierten Prozesse, die zur Kaisererhebung Wilhelms I. von Preußen 1871 führten. Sie untersucht die dynamisch-politischen und rechtlichen Konflikte, die mit der Annahme der Kaiserwürde durch Preußen verbunden waren.
- Die verfassungsrechtliche Stellung des Kaisers in der Reichsverfassung von 1870/71
- Die Rolle von Bismarck bei der Vorbereitung der Kaisererhebung
- Die dynastischen und politischen Konflikte im Zusammenhang mit der Kaisererhebung
- Die Wahrnehmung der Kaisererhebung im europäischen Ausland
- Die Legitimation der Kaiserwürde
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die komplizierte „Doppelmonarchie“ des preußischen Hauses Hohenzollern, das sowohl die Königswürde als auch die Kaiserwürde des Deutschen Reiches innehatte. Sie konzentriert sich auf die dynastisch-politischen und rechtlichen Komplikationen, die mit der Kaisererhebung Wilhelms I. von Preußen verbunden waren.
- Die verfassungsrechtliche Stellung des Kaisers in der Reichsverfassung von 1870/71: Dieses Kapitel beleuchtet die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Deutschen Reiches von 1870/71 und die Stellung des Kaisers innerhalb dieser Verfassung. Es wird die Frage diskutiert, inwieweit der Kaisertitel eine Verhandlungsmasse Preußens war und welche Kompetenzen ihm im neuen Reich zukamen.
- Dynastisches Denken im Zeitalter der Nation: Dieses Kapitel untersucht die Rolle des dynastischen Denkens im Kontext der deutschen Reichsgründung. Es wird untersucht, inwieweit dynastische Prinzipien trotz der nationalen Euphorie des 19. Jahrhunderts weiterhin eine wichtige Rolle spielten.
- Die Initiative zur Kaisererhebung: Dieses Kapitel beleuchtet die Initiative zur Kaisererhebung und die verschiedenen Akteure, die an diesem Prozess beteiligt waren. Es werden die Motive und Ziele derjenigen beleuchtet, die die Kaisererhebung initiierten und vorantrieben.
- Bismarck und die Erhebung: Dieses Kapitel analysiert die Rolle von Otto von Bismarck bei der Vorbereitung der Kaisererhebung. Es wird untersucht, wie Bismarck die politischen und rechtlichen Voraussetzungen für die Kaisererhebung schaffte und welche Ziele er dabei verfolgte.
- Die Rolle König Ludwigs von Bayern im Zusammenhang mit den Ereignissen um die Erneuerung der Kaiserwürde: Dieses Kapitel fokussiert auf die Rolle des bayerischen Königshauses bei der Kaisererhebung. Es beleuchtet die Motive König Ludwigs von Bayern für die Unterstützung der Kaisererhebung und die Bedingungen, die er für seine Zustimmung stellte.
- Der Unwille König Wilhelms von Preußen zur Annahme der Kaiserwürde: Dieses Kapitel beleuchtet die Widerstände und Bedenken König Wilhelms von Preußen gegenüber der Annahme der Kaiserwürde. Es untersucht die Motive für seinen anfänglichen Unwillen und die Argumente, die schließlich zu seiner Zustimmung führten.
- Die Kaiserproklamation: Dieses Kapitel behandelt die Kaiserproklamation in Versailles und ihre symbolische Bedeutung. Es analysiert die Konflikte, die sich im Zusammenhang mit der Kaiserproklamation zeigten, sowie die verschiedenen Reaktionen auf dieses Ereignis.
- Die Wahrnehmung der deutschen Kaisererhebung im europäischen Ausland: Dieses Kapitel untersucht die Reaktion des europäischen Auslands auf die deutsche Kaisererhebung. Es analysiert die unterschiedlichen Perspektiven und Reaktionen der europäischen Mächte auf das neue deutsche Kaiserreich.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der Reichsgründung, der Kaisererhebung Wilhelms I. von Preußen im Jahr 1871, der verfassungsrechtlichen Stellung des Kaisers im neuen Deutschen Reich, dem Einfluss von dynastischem Denken in der Zeit der nationalen Euphorie und den politischen Konflikten im Zusammenhang mit der Kaisererhebung.
- Arbeit zitieren
- André Weikard (Autor:in), 2007, Eine problemlose „Doppelmonarchie“? Staatsrechtlich-politische Probleme und dynastische Rangfragen bei der Kaisererhebung Wilhelms I. 1871, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77676