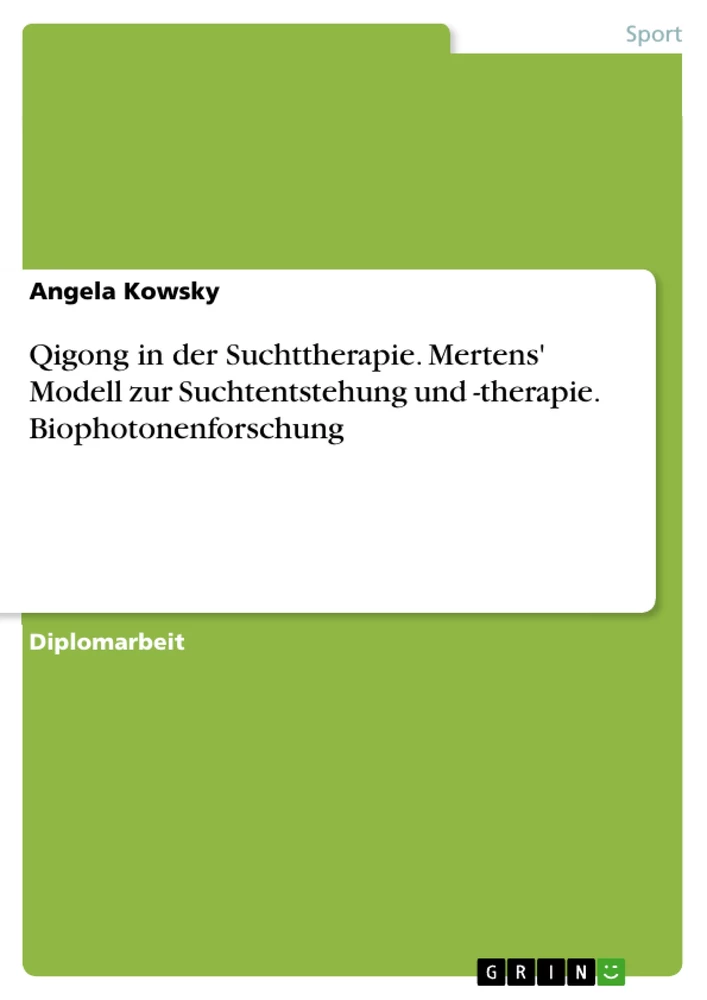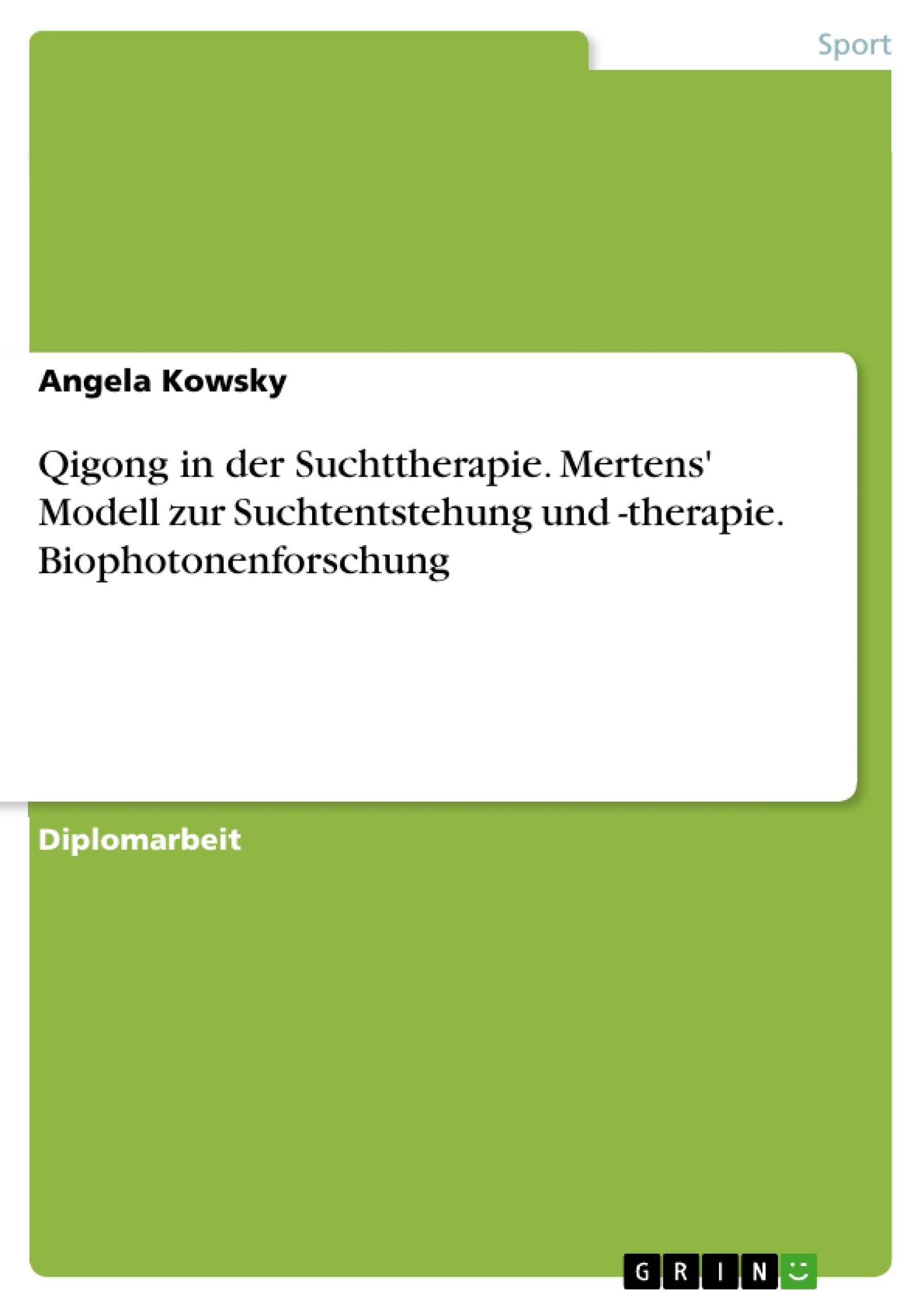Häufig scheint es gefordert, die Notwendigkeit von Bewegungs- und Entspannungsverfahren, gerade auch in der Suchttherapie, zu erläutern und gegenüber gängigen psychotherapeutischen Methoden zu verteidigen. Das Bewegen ist aber, als fortwährender, sich entfaltender Prozess, zentraler Aspekt des Lebens selbst, so dass über den Sinn und Zweck desselben nicht weiter diskutiert werden müsste. WEINBERG erläutert, dass es vielmehr wichtiger ist das Bewegen in Hinblick auf dessen Qualität, also dessen Einfluss auf beispielsweise Lebendigkeit, Gesunderhaltung, Lebensgenuss und Freizeitgestaltung, zu untersuchen.
Einen Schwerpunkt dieser Arbeit bildet die Darstellung des, bisher unveröffentlichten, Modells Wilhelm MERTENS’, zur Suchtentstehung und den Wirkmechanismen, die das Qigong für betroffenen Menschen bietet. Dieses Modell wird mit verbreiteten Thesen der Gesundheits- und Suchtforschung in Beziehung gesetzt, um so eine Standortbestimmung vornehmen zu können. An verschiedenen Punkten werden Bezüge zur Biophotonenforschung hergestellt, die einen sehr spannenden Zugang zum Verständnis lebendiger Prozesse ermöglicht. Neben eher theoretischen Hintergrundinformationen finden sich auch immer wieder sehr praxisnahe Bezüge.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Einführung in die Biophotonentheorie
- 2 Das „offene System Mensch“ nach MERTENS
- 2.1.1 Sensation
- 2.1.2 Emotion
- 2.1.3 Kognition
- 2.1.4 Handlung / äußeres Bewegen
- 2.1.5 Handlung und Selbstvertrauen
- 2.2 Weniger günstige Formen der Krisenbewältigung
- 3 MERTENS’ Modell der Suchtentstehung
- 3.1 Persönlichkeitsmerkmale Drogenabhängiger
- 3.2 Mögliche Gründe für diese Persönlichkeitsmerkmale
- 3.3 Folgende Ziele für eine therapeutische Intervention
- 3.4 Einbindung des Modells
- 3.4.1 Die Persönlichkeitsstruktur Drogenabhängiger aus der Sicht anderer Modelle
- 3.4.2 Abhängiger und Umwelt
- 3.4.3 ANTONOVSKY’s Salutogenesemodell
- 3.4.4 Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell
- 3.4.5 Meine eigenen Beobachtungen
- 3.5
- 4 Zusammenfassung Der abhängige Mensch
- 4.1.1 Die Begriffe Sucht und Abhängigkeit
- 4.1.2 Definitionen der Sucht
- 4.2 Sucht, Leib und Feld
- 4.2.1.1 Biochemische Forschung
- 4.2.1.2 Biochemie der Konditionierung
- 4.2.2 Funktionalisierung des süchtigen Körpers
- 4.2.3 Lebendigkeit und Sucht
- 5 Qigong
- 5.1 Beschreibung einer Qigong-Übung
- 5.2 Begriff, Wurzeln und Formen
- 5.2.1 Der Begriff „Qigong“
- 5.2.3 Wurzeln
- 5.2.4 Qigong-Formen
- 5.3 Vorstellungskraft, Bewegung und Atmung
- 5.3.1 Vorstellungskraft und Achtsamkeit
- 5.3.2 Atmung
- 5.3.3 Bewegung und Ruhe
- 5.4 Trad. chin. Denken im Licht der Biophotonentheorie
- 5.5 Wirkzusammenhänge
- 5.5.1 Zentrale Wirkzusammenhänge nach MERTENS
- 5.5.1.1 Eintauchen in das Wahrnehmen
- 5.5.1.2 Emotionale Regulation
- 5.5.1.3 Training mit der Belastung
- 5.5.2 Qigong als Kohärenztherapie
- 5.5.3 Erfahrungen des Einsseins bedeuten Heilung
- 5.5.4 Drogenkonsum versus Qigong
- 5.5.5 Qigong als sinnstiftendes Element
- 5.5.6 Wirkzusammenhänge aus salutogenetischer Sicht
- 5.5.7 Risiken und Widerstände
- 6 Zusammenfassung
- 7 Ausblick und Hoffnungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einsatz von Qigong in der Suchttherapie, insbesondere im Kontext des Modells von Wilhelm Mertens zur Suchtentstehung und -therapie sowie der Biophotonenforschung. Ziel ist es, die Wirkmechanismen von Qigong bei suchtkranken Menschen darzulegen und zu begründen.
- Mertens’ Modell der Suchtentstehung und seine positive Bewertung des suchtkranken Menschen
- Die Wirkmechanismen von Qigong im Hinblick auf die Bewältigung von Suchtproblematiken
- Bezüge zwischen traditionell chinesischem Denken und der Biophotonenforschung
- Vergleich mit anderen Modellen der Suchttherapie und Gesundheitsforschung (Salutogenese, Vulnerabilitäts-Stress-Modell)
- Risiken und Herausforderungen bei der Anwendung von Qigong in der Suchttherapie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Qigong in der Suchttherapie ein und begründet die Notwendigkeit der Arbeit. Sie stellt das unveröffentlichte Modell von Wilhelm Mertens vor, das die Suchtentstehung aus einer positiven Perspektive betrachtet und die besondere Sensationsfähigkeit des suchtkranken Menschen hervorhebt. Die Arbeit verknüpft Mertens’ Modell mit anderen Theorien der Gesundheits- und Krankheitsforschung und der Biophotonenforschung, deren vitalistischer und quantenphysikalischer Ansatz lebendige Prozesse anders beleuchtet. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und hebt die Bedeutung der Biophotonentheorie hervor.
2 Das „offene System Mensch“ nach MERTENS: Dieses Kapitel beschreibt das Modell von Mertens, das den Menschen als offenes System mit den vier Komponenten Sensation, Emotion, Kognition und Handlung begreift. Es analysiert die Interaktion dieser Komponenten und beleuchtet, wie eine ungünstige Bewältigung von Krisen zur Sucht führen kann. Das Modell betont die Bedeutung der Selbstregulation und der Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit. Die detaillierte Beschreibung der vier Komponenten und ihrer Wechselwirkung bildet die Grundlage für das Verständnis von Mertens' Suchtmodell.
3 MERTENS’ Modell der Suchtentstehung: Dieses Kapitel erläutert im Detail Mertens' Modell der Suchtentstehung. Es beschreibt die Persönlichkeitsmerkmale von Drogenabhängigen, die nach Mertens nicht auf einen Mangel, sondern auf eine besondere, nicht ausreichend bewältigte Sensationsfähigkeit zurückzuführen sind. Es werden mögliche Gründe für diese Persönlichkeitsmerkmale diskutiert und therapeutische Interventionsziele formuliert. Das Modell wird in Beziehung zu anderen Modellen wie dem Salutogenesemodell und dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell gesetzt, um ein ganzheitliches Verständnis zu schaffen.
4 Zusammenfassung Der abhängige Mensch: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Sucht und Abhängigkeit und beleuchtet das Phänomen Sucht aus biochemischer, lerntheoretischer und lebendigkeitstheoretischer Perspektive. Es diskutiert die Schwierigkeiten bei der Definition von Sucht und Abhängigkeit und versucht, ein umfassendes Bild des süchtigen Menschen zu zeichnen, das sowohl die biochemischen als auch die psychosozialen Aspekte berücksichtigt. Die Verbindung von Sucht, Leib und Feld wird besonders hervorgehoben.
5 Qigong: Dieses Kapitel führt in die Praxis und Theorie des Qigong ein. Es beschreibt eine Qigong-Übung und beleuchtet den Begriff, die Wurzeln und Formen des Qigong. Der Fokus liegt auf den Wirkzusammenhängen von Qigong, insbesondere dem Eintauchen in das Wahrnehmen, der emotionalen und physiologischen Regulation, sowie Erfahrungen des Einsseins und sinnstiftenden Aspekten. Parallelen zwischen traditionell chinesischem Denken und der Biophotonentheorie werden aufgezeigt und die möglichen positiven Auswirkungen auf suchtkranke Menschen diskutiert. Die Kapitel behandelt auch Risiken und Widerstände bei der Anwendung von Qigong.
Schlüsselwörter
Qigong, Suchttherapie, Wilhelm Mertens, Biophotonenforschung, Salutogenese, Vulnerabilitäts-Stress-Modell, Sensationsfähigkeit, Emotionale Regulation, Kohärenztherapie, Traditionelle Chinesische Medizin, Selbstwirksamkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Qigong in der Suchttherapie"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einsatz von Qigong in der Suchttherapie. Sie verknüpft das unveröffentlichte Suchtmodell von Wilhelm Mertens mit der Biophotonenforschung und anderen relevanten Theorien (Salutogenese, Vulnerabilitäts-Stress-Modell). Der Fokus liegt auf den Wirkmechanismen von Qigong bei suchtkranken Menschen und dem Vergleich mit anderen Therapieansätzen.
Welches Suchtmodell wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem Modell von Wilhelm Mertens, das den Menschen als offenes System mit den Komponenten Sensation, Emotion, Kognition und Handlung beschreibt. Dieses Modell betont die besondere Sensationsfähigkeit suchtkranker Menschen und bietet eine positive Bewertung der Person, im Gegensatz zu Defizitmodellen.
Welche Rolle spielt die Biophotonenforschung?
Die Biophotonenforschung liefert einen vitalistischen und quantenphysikalischen Ansatz, der lebendige Prozesse anders beleuchtet und die Wirkungsweise von Qigong auf einer tieferen Ebene erklärt. Die Arbeit sucht nach Parallelen zwischen dem traditionellen chinesischen Denken und der Biophotonenforschung.
Wie wird Qigong in der Suchttherapie eingesetzt?
Die Arbeit beschreibt Qigong-Übungen und beleuchtet die Wirkzusammenhänge von Qigong, insbesondere das Eintauchen in das Wahrnehmen, die emotionale und physiologische Regulation, Erfahrungen des Einsseins und sinnstiftende Aspekte. Es wird untersucht, wie Qigong als Kohärenztherapie wirken kann.
Welche anderen Modelle werden verglichen?
Das Mertens’sche Modell wird mit dem Salutogenesemodell von Antonovsky und dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell verglichen, um ein ganzheitliches Verständnis der Suchtentstehung und -behandlung zu ermöglichen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Mertens' Modell des offenen Systems und seiner Suchtentstehungstheorie, ein Kapitel zur Zusammenfassung des abhängigen Menschen aus verschiedenen Perspektiven, ein ausführliches Kapitel zu Qigong, eine Zusammenfassung und einen Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Qigong, Suchttherapie, Wilhelm Mertens, Biophotonenforschung, Salutogenese, Vulnerabilitäts-Stress-Modell, Sensationsfähigkeit, Emotionale Regulation, Kohärenztherapie, Traditionelle Chinesische Medizin, Selbstwirksamkeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, die Wirkmechanismen von Qigong bei suchtkranken Menschen darzulegen und zu begründen, indem Mertens’ Modell mit der Biophotonenforschung und anderen Therapieansätzen verknüpft wird. Die Arbeit untersucht auch Risiken und Herausforderungen bei der Anwendung von Qigong in der Suchttherapie.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse jedes Abschnitts zusammenfasst.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Zielgruppe umfasst Wissenschaftler, Therapeuten, und alle Interessierten, die sich mit Suchttherapie, Qigong und ganzheitlichen Therapieansätzen beschäftigen.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Sportwissenschaftlerin Angela Kowsky (Autor:in), 2005, Qigong in der Suchttherapie. Mertens' Modell zur Suchtentstehung und -therapie. Biophotonenforschung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77612