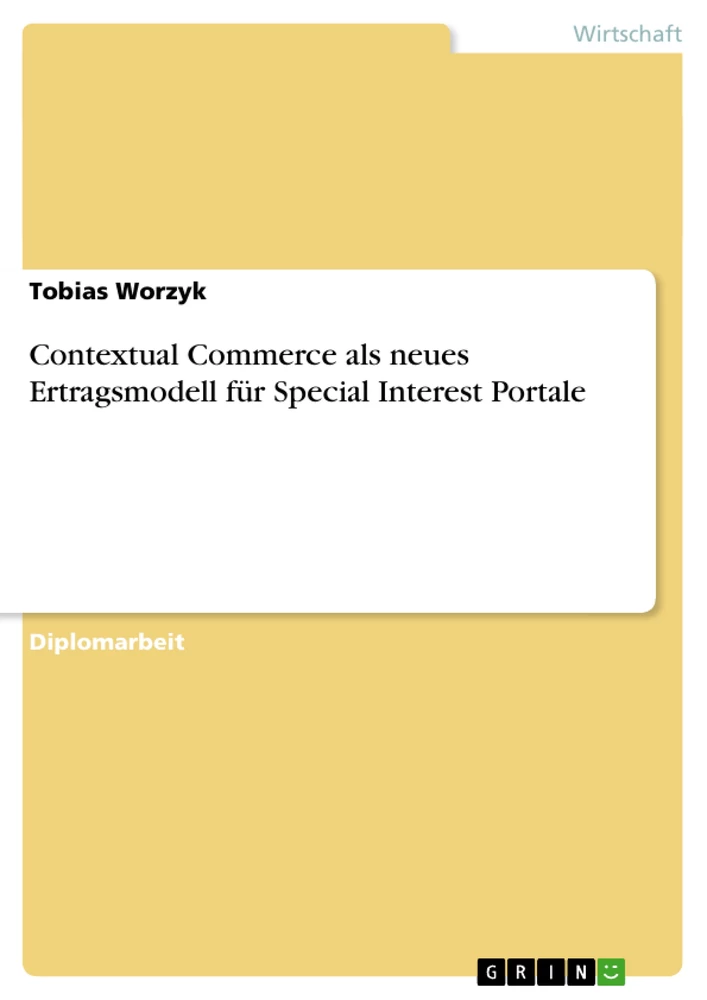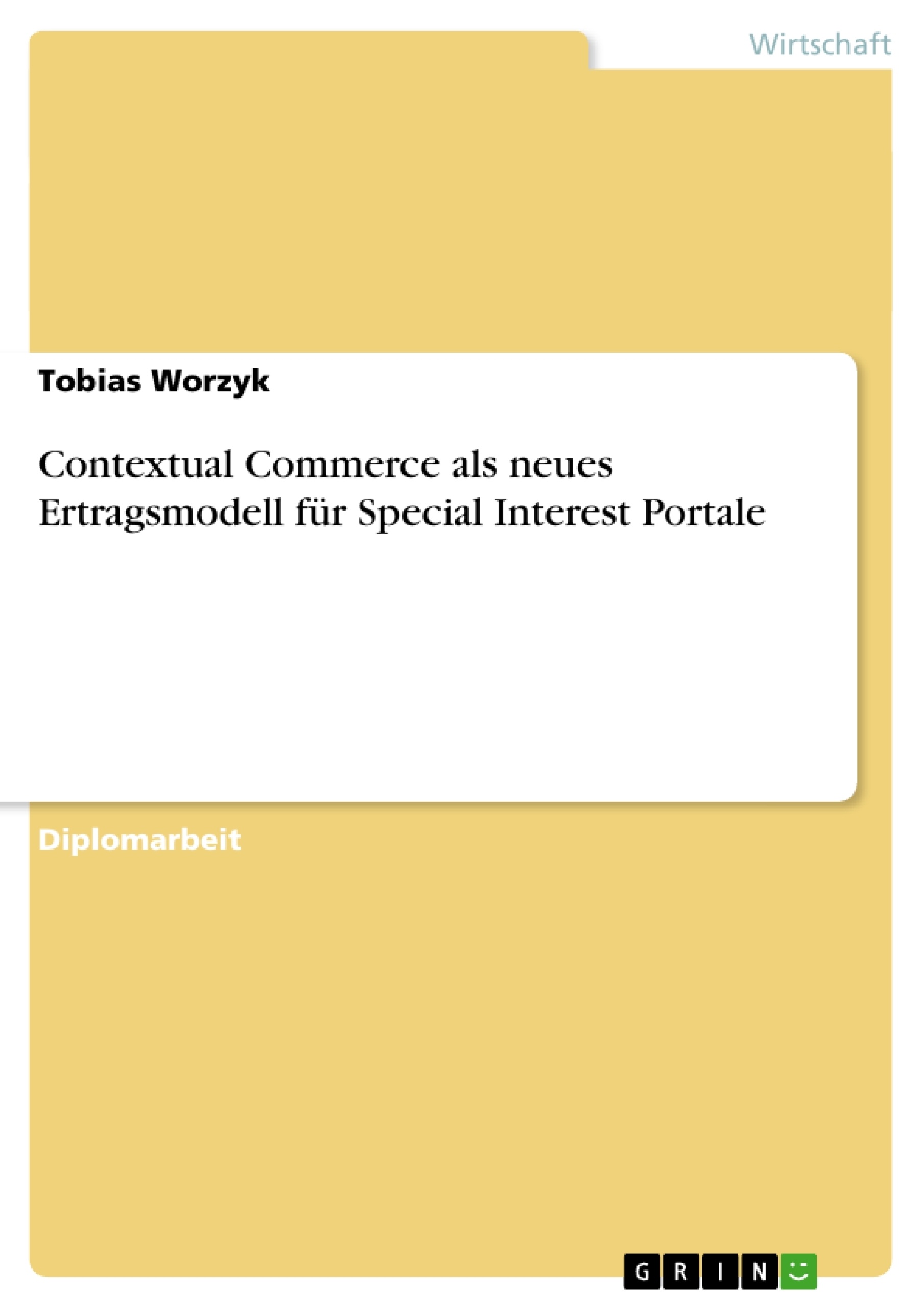Noch Anfang 2000 schienen die Gesetze der Ökonomie auf den Kopf gestellt: Etablierte Unternehmen, die seit Jahren zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn vorweisen konnten, sich aber mit Produkten wie klassischen Konsum- und Investitionsgütern beschäftigen, fanden an der Börse nur wenig Beachtung. Dagegen genügten Stichworte wie "Internet" oder "E-Commerce", ein ".com" im Namen und ehrgeizige Geschäftspläne, um die Aktienkurse junger Internetfirmen in schwindelerregende Höhen zu treiben, obwohl sie immer höhere Verluste auftürmten. Die Entschlossenheit, kühne Wachstumsvisionen, koste es, was es wolle, in die Tat umzusetzen, zählte mehr als nüchterne Kalkulation. Geschwindigkeit war das oberste Gebot, Parolen wie "die schnelle fressen die langsamen" wurden ausgegeben. Oftmals wurde dabei der Erfolg nicht etwa am Cashflow oder sogar am Gewinn (der häufig nicht abzusehen war) des Unternehmens gemessen, sondern vielmehr in der Zahl der Besucher der entsprechenden Website oder bestenfalls in der Zahl der registrierten "Stammbesucher".
Mittlerweile ist der Traum vom ökonomischen Perpetuum mobile allerdings auf dem Boden der Realitäten zerschellt.1 Immer mehr Internet-Start-Ups geht das Geld aus, weil sie die nötigen Anlaufinvestitionen für Markterschließung und Logistik unterschätzt, sie sich im Wachstumsrausch übernommen oder das Erlöspotenzial - insbesondere auf Online-Werbung basierender Ertragsmodelle - überschätzt haben. Zudem wächst der Wettbewerbsdruck durch führende Unternehmen der Old Economy, die derzeit mit Macht ins E-Business drängen.2
So verwundert es nicht, dass auch an den Börsen nicht mehr viel von Internet-Euphorie zu spüren ist, sondern genau hingeschaut wird, ob ein junges E-Business-Unternehmen die Chance hat, in absehbarer Zeit die Gewinnzone zu erreichen. Die Ära der sorglosen und unkomplizierten Geldbeschaffung durch Neuemissionen und Kapitalerhöhungen ist vorbei. Ernüchtert müssen die Internet-Unternehmen heute feststellen, dass auch in der New Economy die altbekannten ökonomischen Gesetze gelten3 - also letztendlich der Gewinn das Maß aller Dinge und Liquidität ein kostbares, weil für das unternehmerische Überleben kritisches, Gut ist.
[...]
______
1 vgl. Schulte Döinghaus, U., 2001, S. 49.
2 vgl. Keller, R., 2001a, S. 58.
3 vgl. Schulte Döinghaus, U., 2001, S. 4.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2. Abgrenzung und Gang der Untersuchung
- 2. Grundlegung
- 2.1. Special Interest Portale
- 2.1.1. Definition und Abgrenzung
- 2.1.2. Aufbau und Funktionsweise
- 2.2. Herkömmliche Ertragsmodelle für Special Interest Portale
- 2.2.1. Ertragsmodell „Werbebanner“
- 2.2.2. Ertragsmodell „Affiliate Programme“
- 2.2.3. Ertragsmodell „Kostenpflichtige Inhalte“
- 2.2.3.1. Verkauf von Inhalten an User
- 2.2.3.2. Verkauf von Inhalten an Content-Broker
- 2.2.4. Sonstige herkömmliche Ertragsmodelle
- 2.2.5. Zwischenfazit
- 3. Konzeptioneller Ansatz des Contextual Commerce
- 3.1. Psychologische Sichtweise
- 3.2. Technische Sichtweise
- 3.3. Organisationale Sichtweise
- 3.4. Zwischenfazit
- 4. Markt und Wettbewerber
- 4.1. Der E-Commerce-Markt in Deutschland
- 4.2. Potenzielle Wettbewerber
- 5. Wahl eines Organisationskonzepts für die Implementierung des Ertragsmodells „Contextual Commerce“
- 5.1. Planung und Implementierung eines Online-Shopsystems vor dem Hintergrund von Contextual Commerce
- 5.1.1. Komponenten eines Online-Shopsystems
- 5.1.2. Planung, Realisierung und Betrieb
- 5.2. Chancen und Risiken durch Outsourcing der Wertschöpfungskette
- 5.2.1. Outsourcing von Teilprozessen
- 5.2.2. Outsourcing der gesamten Wertschöpfungskette an E-Commerce Service Provider
- 5.2.2.1. E-Commerce Service Provider in Deutschland
- 5.2.2.2. Wahl eines adäquaten E-Commerce Service Providers
- 5.3. Entscheidungsmodell zum Einsatz von Contextual Commerce
- 5.3.1. Bewertung der Wirtschaftlichkeit
- 5.3.2. Entscheidungskriterien für die Auslagerung der Wertschöpfungskette an einen E-Commerce Service Provider
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Ertragsmodell „Contextual Commerce“ als eine neue Möglichkeit, Special Interest Portale (SIP) zu monetarisieren. Der Fokus liegt auf der Analyse der Funktionsweise und der Potenziale dieses Modells, sowie auf den Herausforderungen bei dessen Implementierung. Die Arbeit betrachtet dabei die psychologischen, technischen und organisatorischen Aspekte von Contextual Commerce.
- Analyse der Funktionsweise von Contextual Commerce
- Bewertung der Potenziale von Contextual Commerce für SIP
- Untersuchung der Implementierung von Contextual Commerce
- Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Contextual Commerce
- Beurteilung der Chancen und Risiken von Outsourcing im Kontext von Contextual Commerce
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit vor. Sie erläutert die Abgrenzung der Untersuchung und den Gang der Arbeit. Im zweiten Kapitel werden Special Interest Portale definiert und abgegrenzt. Es werden die Funktionsweisen und herkömmlichen Ertragsmodelle von SIP beleuchtet. Kapitel 3 behandelt den konzeptionellen Ansatz von Contextual Commerce. Die psychologischen, technischen und organisatorischen Aspekte werden dabei näher betrachtet. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem E-Commerce-Markt in Deutschland und potenziellen Wettbewerbern. Kapitel 5 widmet sich der Wahl eines Organisationskonzepts für die Implementierung von Contextual Commerce. Hierbei werden die Komponenten eines Online-Shopsystems, die Chancen und Risiken des Outsourcings und das Entscheidungsmodell für den Einsatz von Contextual Commerce betrachtet.
Schlüsselwörter
Contextual Commerce, Special Interest Portale, E-Commerce, Ertragsmodell, Monetarisierung, Online-Shopsysteme, Outsourcing, Wirtschaftlichkeit, E-Commerce Service Provider.
- Quote paper
- Tobias Worzyk (Author), 2001, Contextual Commerce als neues Ertragsmodell für Special Interest Portale, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7737