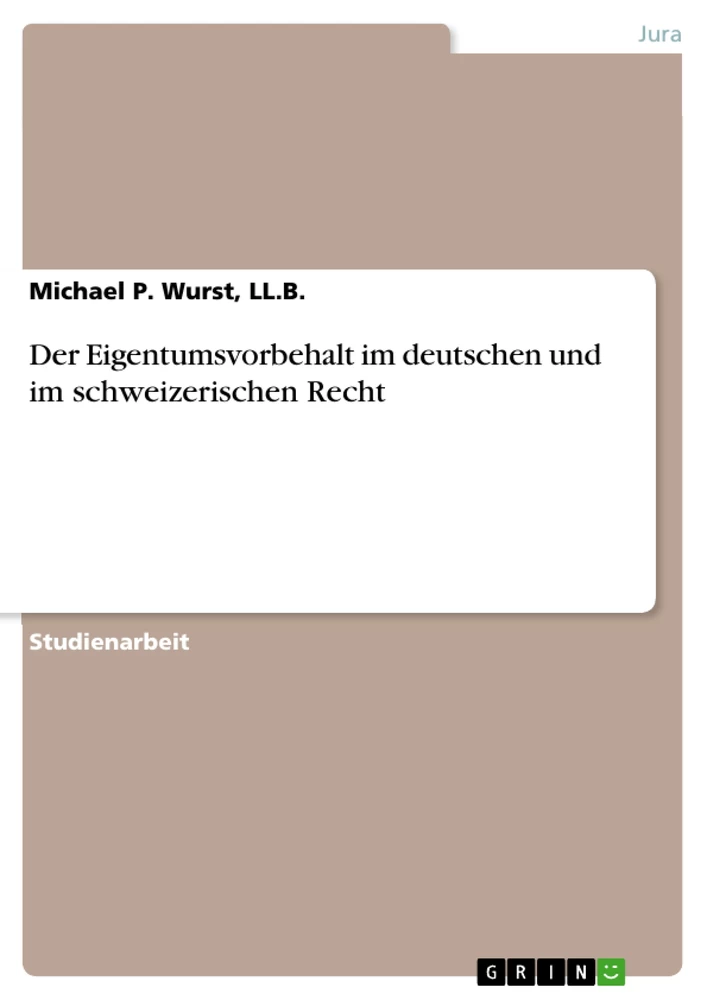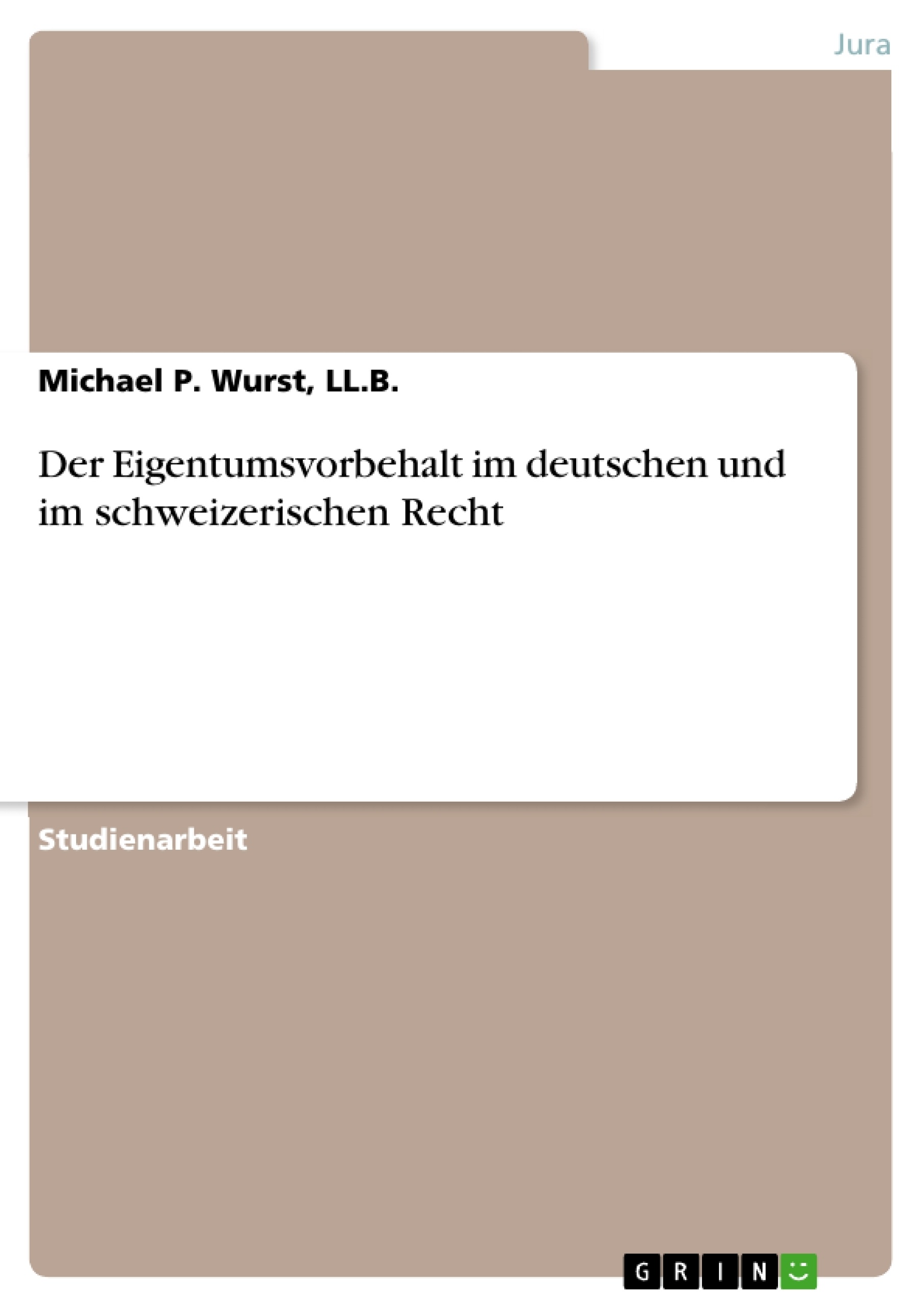Diese Arbeit dient der rechtsvergleichenden Betrachtung des Rechtsinstituts des Eigentumsvorbehalts im deutschen und im schweizerischen Recht. Hierzu erfolgt nach einer kurzen Einführung die Vorstellung der Problemstellung (B.), die eine solche Betrachtung nicht nur aus wissenschaftlichen Gründen lehrreich, sondern auch aus praktischen Gründen notwendig erscheinen lässt. Es folgenden die Darstellungen des Eigentumsvorbehalts im deutschen (C.), wie im schweizerischen (D.) Recht, wobei diese jeweils mit einem allgemeinen Teil (jeweils zu I.), der die gesetzliche Regelung des Eigentumsvorbehalts in seiner Grundform vorstellt und auf die eventuellen Erweiterungsformen eingeht, beginnt. Es folgt eine Betrachtung der möglichen Gegenstände des Eigentumsvorbehalts (jeweils zu II.), an die sich Abschnitte über die Begründung des Eigentumsvorbehalts (jeweils zu III.), die Wirkungen des Eigentumsvorbehalts (jeweils zu IV.), sowie das Erlöschen des Eigentumsvorbehalts (jeweils zu V.) anschließen. Aufgrund der besonderen Bedeutung werden die Problemfelder Eigentumsvorbehalt in der Zwangsvollstreckung und in der Insolvenz / im Konkurs (jeweils zu VI.) und Eigentumsvorbehalt im internationalen Warenverkehr (jeweils zu VII.) in eigenen Abschnitten betrachtet.
An die Vorstellung des Eigentumsvorbehalts in beiden Rechtsordnungen schließen sich die rechtsvergleichende Betrachtung (E.), sowie die Bewertung aus komparativer Sicht (F.) an. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung (G.).
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Problemstellung
- I. Definition des Eigentumsvorbehalts
- II. Problemfeld Internationaler Warenverkehr
- C. Der Eigentumsvorbehalt im deutschen Recht
- I. Allgemein
- 1. Der verlängerte Eigentumsvorbehalt
- 2. Der erweiterte Eigentumsvorbehalt
- 3. Weitergeleiteter und nachgeschalteter Eigentumsvorbehalt
- II. Gegenstand des Eigentumsvorbehalts
- III. Begründung des Eigentumsvorbehaltes
- 1. Die schuldrechtliche Einigung
- 2. Die dingliche Einigung
- IV. Wirkungen des Eigentumsvorbehalts
- 1. Die schuldrechtlichen Wirkungen
- 2. Die dinglichen Wirkungen
- V. Erlöschen des Eigentumsvorbehalts
- VI. Der Eigentumsvorbehalt in der Zwangsvollstreckung und der Insolvenz
- 1. Zwangsvollstreckung
- a. Vollstreckung gegen den Verkäufer
- b. Vollstreckung gegen den Käufer
- 2. Insolvenz
- a. Insolvenz des Verkäufers
- b. Insolvenz des Käufers
- VII. Der Eigentumsvorbehalt im internationalen Warenverkehr
- VIII. Schlusswort
- D. Der Eigentumsvorbehalt im schweizerischen Recht
- I. Allgemein
- 1. Meinungsstreits und juristische Konstruktion
- a. Notwendigkeit der dinglichen Einigung
- b. Suspensiv- oder Resolutivbedingung
- c. Konstitutive oder deklaratorische Wirkung des Registereintrags
- 2. Erweiterungsformen
- a. Erweiterter Eigentumsvorbehalt
- b. Der Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungsklausel
- c. Der Eigentumsvorbehalt mit Zessionsklausel
- II. Gegenstand des Eigentumsvorbehalts
- III. Begründung des Eigentumsvorbehaltes
- 1. Veräußerungsgeschäft und Übergabe
- 2. Eintragung
- IV. Wirkungen des Eigentumsvorbehalts
- V. Erlöschen des Eigentumsvorbehalts
- VI. Der Eigentumsvorbehalt in der Zwangsvollstreckung und im Konkurs
- 1. Zwangsvollstreckung
- 2. Konkurs
- VII. Der Eigentumsvorbehalt im internationalen Warenverkehr
- VIII. Schlusswort
- E. Rechtsvergleichende Betrachtung
- I. Kurz zur historischen Entwicklung
- II. Allgemein
- III. Erweiterungsformen
- IV. Gegenstand und Begründung des Eigentumsvorbehalts
- V. Wirkungen des Eigentumsvorbehalts
- VI. Erlöschen des Eigentumsvorbehalts
- VII. Der Eigentumsvorbehalt in der Zwangsvollstreckung und in der Insolvenz / im Konkurs
- 1. Zwangsvollstreckung
- 2. Insolvenz / Konkurs
- VIII. Der Eigentumsvorbehalt im internationalen Warenverkehr
- F. Bewertung aus komparativer Sicht
- G. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit verfolgt das Ziel, den Eigentumsvorbehalt im deutschen und schweizerischen Recht zu vergleichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf der Begründung, den Wirkungen und dem Erlöschen des Eigentumsvorbehalts in beiden Rechtssystemen. Besonderes Augenmerk wird auf die Problematik im internationalen Warenverkehr gelegt.
- Vergleich des Eigentumsvorbehalts im deutschen und schweizerischen Recht
- Untersuchung der Begründung des Eigentumsvorbehalts
- Analyse der Wirkungen des Eigentumsvorbehalts
- Erlöschen des Eigentumsvorbehalts
- Der Eigentumsvorbehalt im internationalen Warenverkehr
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung: Diese Einführung dient als Einleitung in die Thematik des Eigentumsvorbehalts und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie legt den Fokus auf den bevorstehenden Rechtsvergleich zwischen deutschem und schweizerischem Recht und benennt die zentralen Fragestellungen.
B. Problemstellung: Dieser Abschnitt definiert den Eigentumsvorbehalt und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, die sich im internationalen Warenverkehr ergeben. Er stellt die Grundlage für die folgende detaillierte Untersuchung dar und hebt die Relevanz des Themas hervor.
C. Der Eigentumsvorbehalt im deutschen Recht: Dieses Kapitel analysiert umfassend den Eigentumsvorbehalt im deutschen Recht. Es untersucht verschiedene Formen des Eigentumsvorbehalts (verlängert, erweitert, weitergeleitet, nachgeschaltet), seinen Gegenstand und seine Begründung (schuldrechtliche und dingliche Einigung). Darüber hinaus werden die schuldrechtlichen und dinglichen Wirkungen sowie das Erlöschen des Eigentumsvorbehalts ausführlich behandelt. Der Einfluss des Eigentumsvorbehalts auf Zwangsvollstreckung und Insolvenz wird ebenfalls beleuchtet, sowie seine Relevanz im internationalen Warenverkehr.
D. Der Eigentumsvorbehalt im schweizerischen Recht: Analog zu Kapitel C, widmet sich dieses Kapitel dem Eigentumsvorbehalt im schweizerischen Recht. Es erörtert Meinungsstreitigkeiten über die juristische Konstruktion, verschiedene Erweiterungsformen (erweiterter Eigentumsvorbehalt, Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungsklausel, Eigentumsvorbehalt mit Zessionsklausel), sowie den Gegenstand und die Begründung des Eigentumsvorbehalts. Die Wirkungen, das Erlöschen, und die Behandlung im Kontext von Zwangsvollstreckung und Konkurs werden ebenfalls detailliert analysiert, mit besonderem Fokus auf die spezifischen Besonderheiten des schweizerischen Rechts. Auch hier wird der internationale Aspekt im Warenverkehr beleuchtet.
E. Rechtsvergleichende Betrachtung: Dieser Abschnitt stellt einen direkten Vergleich zwischen dem deutschen und dem schweizerischen Recht dar. Er betrachtet die historische Entwicklung, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf die verschiedenen Aspekte des Eigentumsvorbehalts (Begründung, Wirkungen, Erlöschen). Der Fokus liegt auf der systematischen Gegenüberstellung und der Herausarbeitung von Übereinstimmungen und Abweichungen in der rechtlichen Behandlung. Die Behandlung im Kontext von Zwangsvollstreckung und Insolvenz wird ebenfalls verglichen, mit einer ausführlichen Analyse der jeweiligen Besonderheiten in beiden Rechtssystemen.
F. Bewertung aus komparativer Sicht: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Bewertung der Ergebnisse des Rechtsvergleichs. Es analysiert die Stärken und Schwächen der jeweiligen Systeme und diskutiert mögliche Verbesserungen oder Anpassungen. Die Bewertung berücksichtigt die praktische Relevanz und die Auswirkungen der Unterschiede auf den internationalen Warenverkehr.
Schlüsselwörter
Eigentumsvorbehalt, deutsches Recht, schweizerisches Recht, Rechtsvergleichung, internationaler Warenverkehr, Begründung, Wirkungen, Erlöschen, Zwangsvollstreckung, Insolvenz, Verarbeitungsklausel, Zessionsklausel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Eigentumsvorbehalt im deutschen und schweizerischen Recht
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit vergleicht den Eigentumsvorbehalt im deutschen und schweizerischen Recht. Sie untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Begründung, den Wirkungen und dem Erlöschen des Eigentumsvorbehalts in beiden Rechtssystemen, mit besonderem Augenmerk auf die Herausforderungen im internationalen Warenverkehr.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition des Eigentumsvorbehalts, Problemstellung im internationalen Warenverkehr, der Eigentumsvorbehalt im deutschen Recht (einschließlich verschiedener Formen wie verlängerter, erweiterter, weitergeleiteter und nachgeschalteter Eigentumsvorbehalt, Gegenstand, Begründung, Wirkungen, Erlöschen, Auswirkungen auf Zwangsvollstreckung und Insolvenz), der Eigentumsvorbehalt im schweizerischen Recht (inkl. Meinungsstreitigkeiten zur juristischen Konstruktion, Erweiterungsformen wie erweiterter Eigentumsvorbehalt, Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungsklausel und Zessionsklausel, Gegenstand, Begründung, Wirkungen, Erlöschen, Auswirkungen auf Zwangsvollstreckung und Konkurs), ein rechtsvergleichender Abschnitt, der die beiden Rechtssysteme gegenüberstellt und eine abschließende Bewertung der Ergebnisse aus komparativer Sicht.
Welche Arten von Eigentumsvorbehalten werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht im Detail den verlängerten, erweiterten, weitergeleiteten und nachgeschalteten Eigentumsvorbehalt im deutschen Recht sowie den erweiterten Eigentumsvorbehalt, den Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungsklausel und den Eigentumsvorbehalt mit Zessionsklausel im schweizerischen Recht.
Wie wird der internationale Warenverkehr berücksichtigt?
Die Problematik des Eigentumsvorbehalts im internationalen Warenverkehr wird in mehreren Kapiteln behandelt, sowohl im Kontext des deutschen als auch des schweizerischen Rechts und im rechtsvergleichenden Abschnitt. Die Arbeit analysiert die spezifischen Herausforderungen, die sich im internationalen Kontext ergeben.
Wie wird der Eigentumsvorbehalt in der Zwangsvollstreckung und Insolvenz behandelt?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des Eigentumsvorbehalts auf Zwangsvollstreckung und Insolvenz sowohl im deutschen (Zwangsvollstreckung gegen Verkäufer und Käufer, Insolvenz des Verkäufers und Käufers) als auch im schweizerischen Recht (Zwangsvollstreckung und Konkurs). Die jeweiligen Besonderheiten beider Rechtssysteme werden detailliert analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in die Kapitel A. Einführung, B. Problemstellung, C. Der Eigentumsvorbehalt im deutschen Recht, D. Der Eigentumsvorbehalt im schweizerischen Recht, E. Rechtsvergleichende Betrachtung, F. Bewertung aus komparativer Sicht und G. Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel ist in Unterkapitel und -punkte unterteilt, die im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgelistet sind.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist der Vergleich des Eigentumsvorbehalts im deutschen und schweizerischen Recht, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf der Begründung, den Wirkungen und dem Erlöschen des Eigentumsvorbehalts in beiden Rechtssystemen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Eigentumsvorbehalt, deutsches Recht, schweizerisches Recht, Rechtsvergleichung, internationaler Warenverkehr, Begründung, Wirkungen, Erlöschen, Zwangsvollstreckung, Insolvenz, Verarbeitungsklausel, Zessionsklausel.
- Arbeit zitieren
- Michael P. Wurst, LL.B. (Autor:in), 2007, Der Eigentumsvorbehalt im deutschen und im schweizerischen Recht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77251