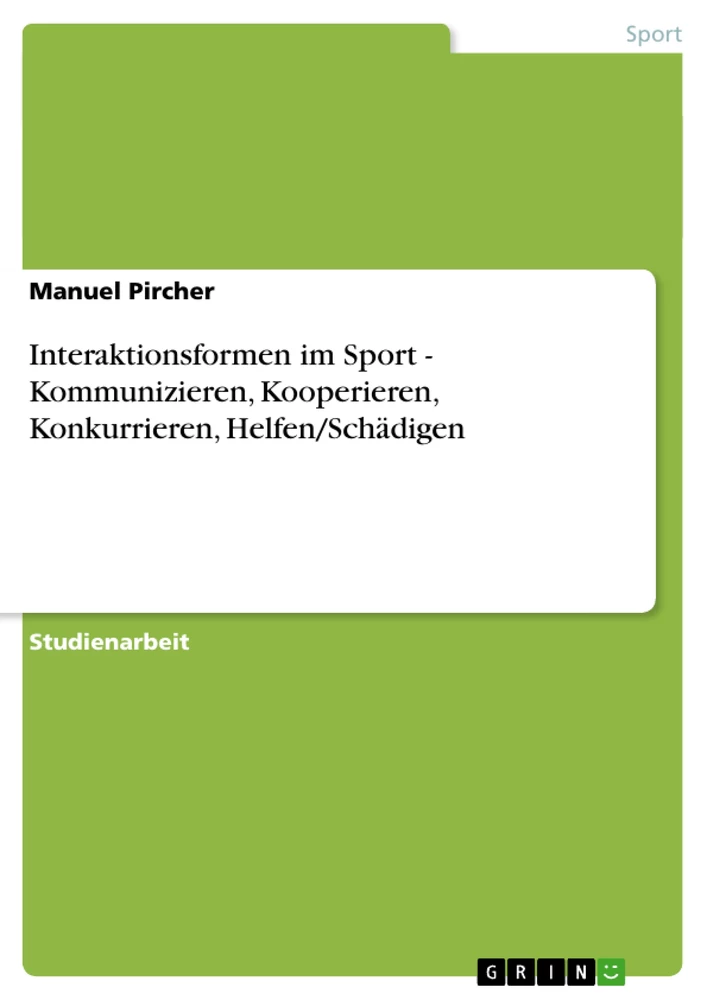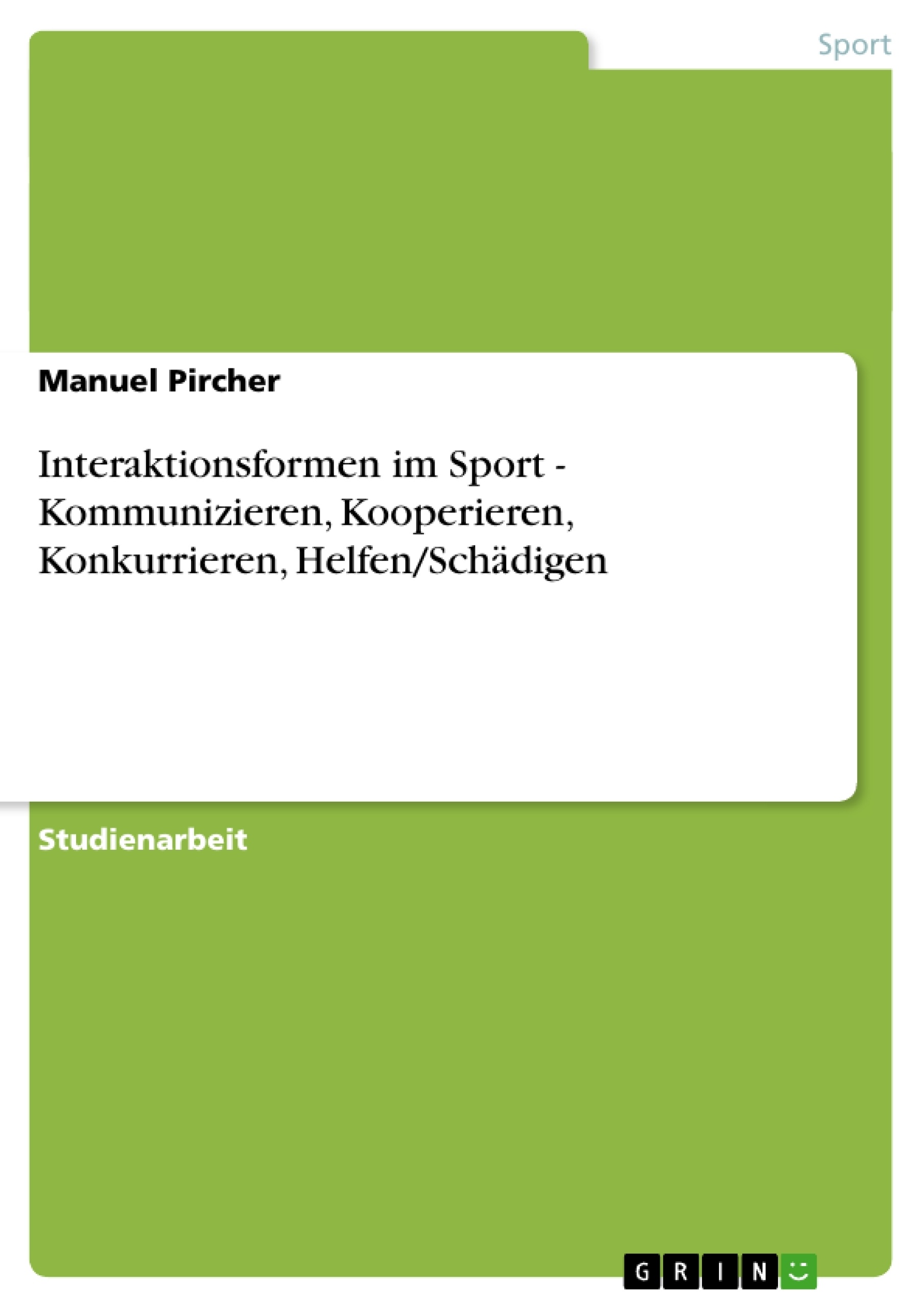Die sportliche Tätigkeit bietet eine günstige Gelegenheit soziales Verhalten zu Erleben und Erlernen. Bei vielen gemeinsamen sportlichen Tätigkeiten lernen Sportler die Wechselseitigkeit des Gebens und Nehmens, indem sie Vereinbarungen treffen und sie auch selbst einhalten. Nach Müller (1999) zählen Verlässlichkeit, Hilfe, Akzeptanz und Vertrauen zu den Gewünschten sozialen Eigenschaften auf die sich soziales lernen in der Bewegungserziehung beziehen kann.
Thomas (1995) beschreibt, dass sich in nahezu allen sportlichen Tätigkeiten soziale Interaktionsformen wieder finden: Während bei Mannschaftssportarten Kooperation und Kommunikation das zentrale Thema ist, stehen beispielsweise bei Kampfsportarten die Auseinandersetzung zweier Sportler mit den Regeln und der Taktik des Gegenübers im Vordergrund. Sogar Individualsportler werden subtil beeinflusst durch Reaktionen von Zuschauern oder von Leistungen anderer Sportler.
Dem Sport wird ein großer Stellewert zur Vermittlung der oben genannten wünschenswerten sozialen Werte attestiert, welche als prosoziales Verhalten zusammengefasst werden. Jedoch geht aus der aktuellen Literatur keine einheitliche Gliederung der Interaktionsformen im Sport hervor.
Mit dieser Arbeit wird versucht eine klare Gliederung der Interaktionsformen im Sport zu schaffen, im Hauptteil wird beschrieben wie sich diese Prozesse Interagierenden Handelns charakterisieren, welche von besonderer Wichtigkeit in der Bewegungserziehung sind und welche möglichen Konsequenzen sich für die praktische Umsetzung ergeben.
Im empirischen Teil der Arbeit wird mittels Experteninterviews der Frage nachgegangen, welche Interaktionsformen häufig beim Sporttreiben beobachtet werden können und welche Vorraussetzungen und Ziele gegeben sein müssen, damit eine funktionierende Kooperation zwischen Sportlern zustande kommt. Spieler von Mannschaftssportarten (Fußball, Eishockey, Handball, Basketball, Volleyball) bilden hierbei das Feld meiner Untersuchung.
Am Ende der Arbeit steht eine Zusammenfassung, die einen Grobüberblick über die gesamte Arbeit gibt und die wichtigsten Punkte in kompakter Form schildert.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung: Interaktionsformen im Sport
- Die vier Interaktionsformen
- Kommunizieren
- Das Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun
- Die fünf Axiome der Kommunikation
- Kommunikation innerhalb einer Mannschaft
- Pädagogische Bedeutsamkeit der Interaktionsform Kommunizieren
- Kooperieren
- Aufgaben- und Sozialkooperation
- Vorraussetzungen um zu Kooperieren
- Pädagogische Bedeutsamkeit der Interaktionsform Kooperieren
- Konkurrieren
- Arten des Konkurrierens
- Vorraussetzungen um zu Konkurrieren
- Pädagogische Bedeutsamkeit der Interaktionsform Konkurrieren
- Helfen/Schädigen
- Zum Begriff der Schädigung
- Klassen schädigender Handlungen im Sport
- Zum Begriff des Helfens
- Pädagogische Bedeutsamkeit der Interaktionsform Helfen/Schädigen
- Kommunizieren
- Darstellung der Untersuchung
- Zielsetzung
- Untersuchungsmethodik
- Darstellung der Ergebnisse, Interpretation
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, eine übersichtliche Gliederung von Interaktionsformen im Sport zu schaffen. Sie beschreibt die Charakteristika dieser Interaktionsprozesse, ihre Bedeutung in der Bewegungserziehung und mögliche Konsequenzen für die praktische Umsetzung. Ein empirischer Teil untersucht mittels Experteninterviews häufig beobachtete Interaktionsformen und die notwendigen Voraussetzungen für funktionierende Kooperation im Mannschaftssport.
- Kategorisierung von Interaktionsformen im Sport
- Analyse der Prozesse des interaktiven Handelns im Sport
- Bedeutung der Interaktionsformen für die Bewegungserziehung
- Empirische Untersuchung von Kooperationsformen im Mannschaftssport
- Konsequenzen für die praktische Umsetzung im Sportunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung: Interaktionsformen im Sport: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung sozialer Interaktion im Sport und weist auf die fehlende einheitliche Gliederung von Interaktionsformen in der Literatur hin. Es werden verschiedene Ansätze von Autoren wie Müller (1999), Thomas (1995) und Baumann (2000) vorgestellt und schließlich die vier Hauptkategorien – Kommunizieren, Kooperieren, Konkurrieren und Helfen/Schädigen – als Grundlage der Arbeit eingeführt. Die Einleitung betont den Stellenwert des Sports für die Vermittlung prosozialen Verhaltens und begründet die Notwendigkeit einer klaren Strukturierung der Interaktionsformen.
Die vier Interaktionsformen: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Beschreibung der vier Hauptkategorien von Interaktionsformen im Sport. Es werden für jede Kategorie Definitionen, detaillierte Informationen über den interaktiven Prozess und deren pädagogische Bedeutung dargelegt. Die Schwierigkeit einer eindeutigen Kategorisierung aufgrund der gegenseitigen Bedingtheit der Interaktionen wird hervorgehoben, aber gleichzeitig die Sinnhaftigkeit der gewählten Einteilung zur umfassenden Beschreibung der interaktiven Möglichkeiten im Sport betont.
Schlüsselwörter
Interaktionsformen, Sport, Kommunikation, Kooperation, Konkurrenz, Helfen, Schädigen, Bewegungserziehung, Mannschaftssport, Experteninterviews, soziales Lernen, prosoziales Verhalten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Interaktionsformen im Sport
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der systematischen Gliederung und Analyse von Interaktionsformen im Sport. Sie kategorisiert Interaktionen, beschreibt deren Prozesse, Bedeutung für die Bewegungserziehung und Konsequenzen für die Praxis. Ein empirischer Teil untersucht mittels Experteninterviews Kooperation im Mannschaftssport.
Welche Interaktionsformen werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf vier Hauptkategorien von Interaktionsformen: Kommunizieren, Kooperieren, Konkurrieren und Helfen/Schädigen. Jede Kategorie wird detailliert beschrieben, inklusive Definitionen, Prozessanalyse und pädagogischer Bedeutung. Die gegenseitige Bedingtheit der Interaktionen wird dabei berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Problemstellung, die die Bedeutung sozialer Interaktion im Sport und die fehlende einheitliche Gliederung in der Literatur aufzeigt. Es folgt eine detaillierte Beschreibung der vier Interaktionsformen. Ein Kapitel widmet sich der Darstellung der empirischen Untersuchung (Zielsetzung, Methodik, Ergebnisse und Interpretation). Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit nutzt eine qualitative Forschungsmethode: Experteninterviews. Diese dienen der empirischen Untersuchung von Kooperationsformen im Mannschaftssport. Die genaue Methodik wird im entsprechenden Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Kategorisierung von Interaktionsformen im Sport, die Analyse interaktiven Handelns, die Bedeutung der Interaktionsformen für die Bewegungserziehung, die empirische Untersuchung von Kooperationsformen im Mannschaftssport und die Konsequenzen für die praktische Umsetzung im Sportunterricht.
Welche Autoren werden zitiert?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Autoren, darunter Müller (1999), Thomas (1995) und Baumann (2000), um verschiedene Ansätze zur Beschreibung von Interaktionsformen im Sport zu beleuchten.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die Schaffung einer übersichtlichen Gliederung von Interaktionsformen im Sport, die Beschreibung der Charakteristika dieser Interaktionsprozesse, deren Bedeutung in der Bewegungserziehung und mögliche Konsequenzen für die praktische Umsetzung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Interaktionsformen, Sport, Kommunikation, Kooperation, Konkurrenz, Helfen, Schädigen, Bewegungserziehung, Mannschaftssport, Experteninterviews, soziales Lernen, prosoziales Verhalten.
- Quote paper
- Bacc. Manuel Pircher (Author), 2007, Interaktionsformen im Sport - Kommunizieren, Kooperieren, Konkurrieren, Helfen/Schädigen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77099