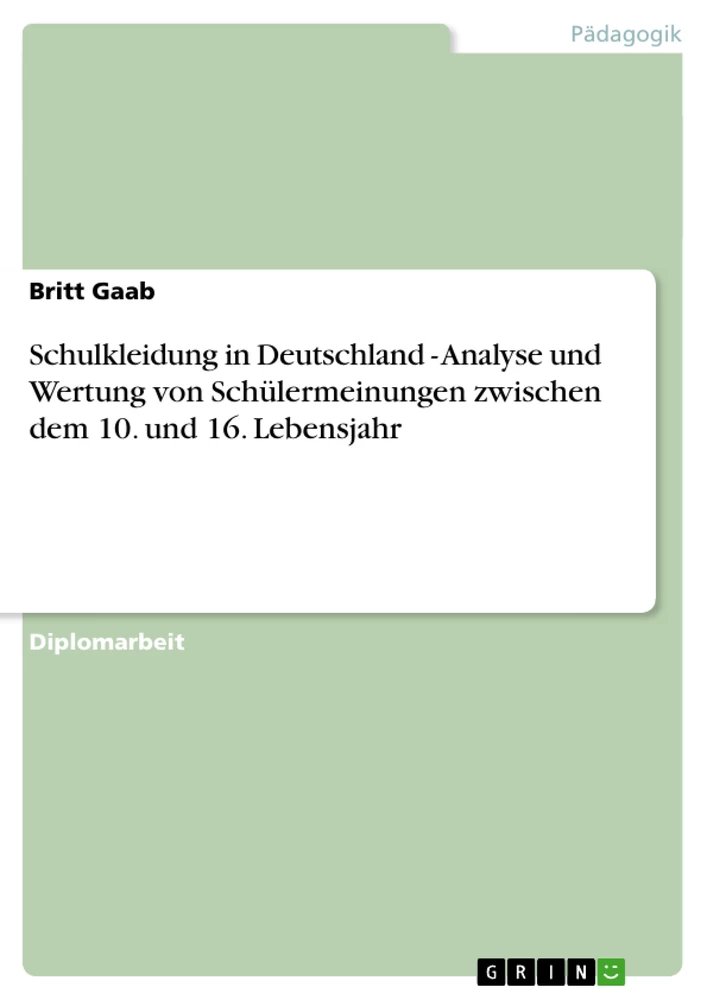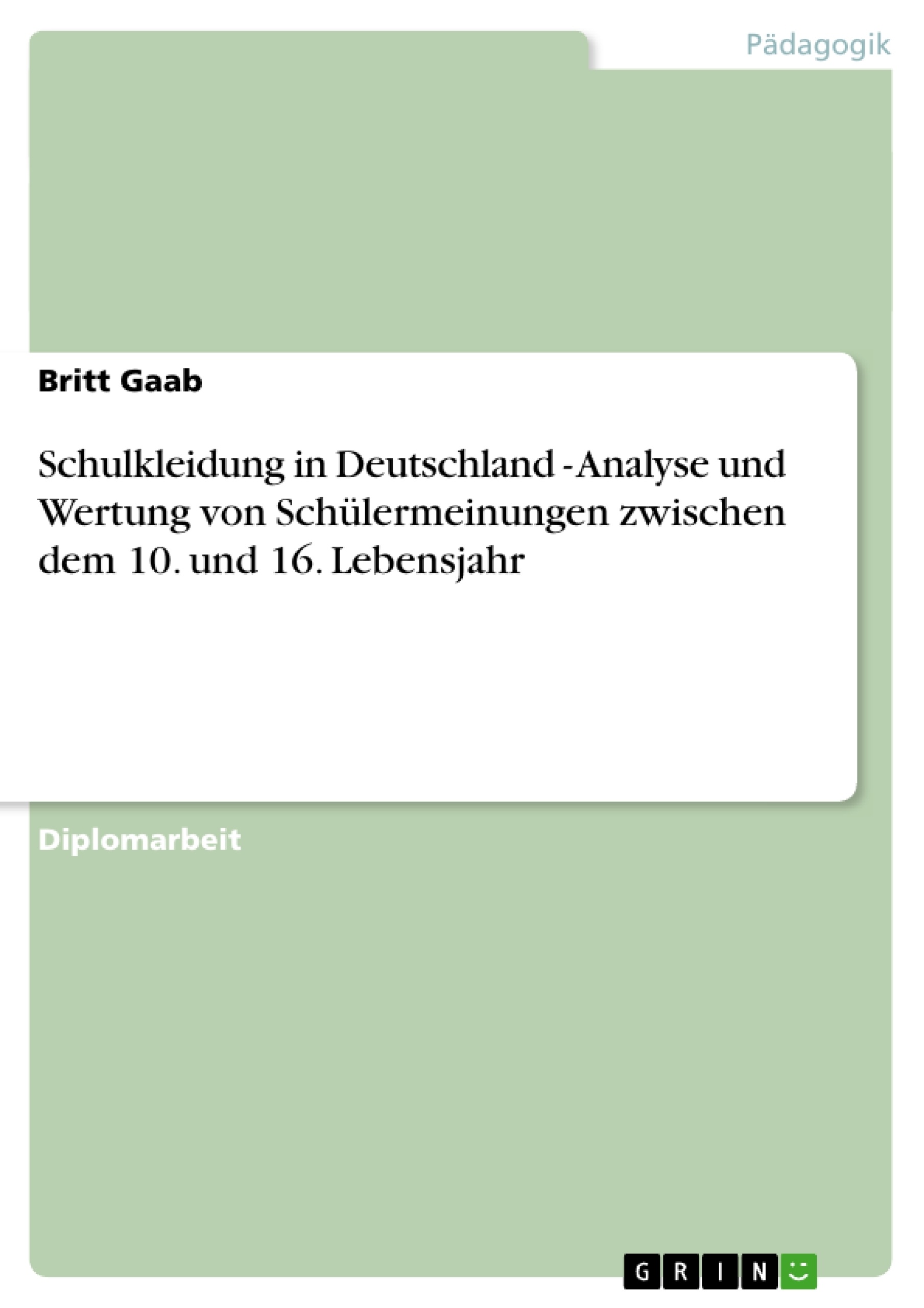Schulkleidung in Deutschland: Analyse und Wertung von Schülermeinungen zwischen dem 10. und 16. Lebensjahr
1 Einleitung
Die Schule als Lern- und Entwicklungsraum für Kinder und Jugendliche ist auch der soziale Platz, an dem sie ihre Wirkung auf andere testen und ihre eigene Identität beginnen zu entwickeln. Dabei spielt das äußere Erscheinungsbild, welches zu einem großen Teil über die Kleidung mitbestimmt wird, eine bedeutende Rolle. Der heute oft zu beobachtende Markenzwang hinsichtlich der Kleidung wird gerne von den Schülern mit Individualität erklärt. Längst geht es nicht mehr nur um das Markenzeichen, sondern das Label bestimmt den Wert des Menschen. Altersspezifische Normen, die durch die Medien, durch die Kleidungsindustrie, aber auch durch die Gleichaltrigengruppe propagiert und transportiert werden, bewirken u. a., dass die vestimentäre Kommunikation das Vorzeigen wirklicher Leistungen überlagert. Mit dem Tragen bestimmter Kleidung gehen dabei oft Akzeptanz bzw. Nicht-Akzeptanz in der Schulklasse einher. Dieses führt letztlich auch zu einer teilweise mit negativen Effekten einhergehenden Beeinflussung des Unterrichts- und Klassenklimas.
Die vorliegende Arbeit zum Thema „Schulkleidung“ geht Fragen nach, die sich mit der Situation und den Beziehungsgeflechten in Schulklassen befassen: „Ist die Schulkleidung ein geeignetes Instrument, den Markenzwang in der Schule abzubauen?“ und „Kann die Schulkleidung den Zusammenhalt in der Klasse stärken und das Klassen- und Unterrichtsklima fördern?“ sollen zentrale Fragestellungen dieser Arbeit sein.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Erklärungsmodelle der Modenutzung
- 2.1 Historisch-pädagogische Bezüge der Schulkleidung
- 2.2 Mode als Symbol
- 2.2.1 Mode im Sinne des symbolischen Interaktionismus
- 2.2.2 Sozialisations- und Entwicklungsprozesse im Verständnis des symbolischen Interaktionismus
- 2.2.3 Interaktionistischer Ansatz
- 2.3 Kinder- und Jugendsoziologie
- 2.3.1 Markenkonsum
- 2.3.2 Die Gleichaltrigengruppe
- 2.4 Kinder- und Jugendpsychologie
- 2.4.1 Identität
- 2.4.2 Attraktivität der Schüler
- 2.4.3 Prosoziales Verhalten in der Schule
- 2.5 Schulpädagogik
- 2.6 Unterrichtsklima
- 3 Beispiele für schulbezogene Veränderung der Modenutzung: Einführung der Schulkleidung
- 3.1 Das Hamburger Projekt
- 3.2 Berliner Projekt
- 3.3 Medienrezeption und politisches Meinungsbild
- 4 Spezielle Einstellung der Schüler zur Schulkleidung
- 4.1 Aspekte der Einstellungsbildung
- 4.2 Datenerhebung
- 4.3 Zu den Ergebnissen der „Pilotstudie Berlin“
- 4.4 Zu den Ergebnissen der „Untersuchung Hamburg“
- 5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Schulkleidung auf das Klassenklima und den Markenzwang unter Schülern im Alter zwischen 10 und 16 Jahren. Die zentralen Fragestellungen lauten: Ist Schulkleidung ein geeignetes Instrument zum Abbau des Markenzwangs und kann sie den Zusammenhalt in der Klasse stärken sowie das Klassen- und Unterrichtsklima fördern? Die Arbeit analysiert dazu verschiedene soziologische und psychologische Aspekte der Modenutzung im Jugendalter.
- Historische Entwicklung und pädagogische Bezüge von Schulkleidung in Deutschland
- Einfluss von Mode und Markenkleidung auf die soziale Identität und das Selbstwertgefühl von Schülern
- Rolle der Gleichaltrigengruppe und soziale Normen im Kontext von Kleidung und Konformität
- Auswirkungen von Schulkleidung auf das Klassenklima und das Unterrichtsverhalten
- Analyse empirischer Daten aus Pilotstudien in Hamburg und Berlin
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Schulkleidung in Deutschland ein und beschreibt den Kontext von Markenzwang, sozialer Akzeptanz und dem Einfluss der Kleidung auf das Klassen- und Unterrichtsklima. Die Arbeit untersucht, ob Schulkleidung ein geeignetes Mittel ist, um diese Probleme anzugehen.
2 Erklärungsmodelle der Modenutzung: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene theoretische Modelle, die die Modenutzung im Jugendalter erklären. Es werden historische Beispiele von Schulkleidung in Deutschland analysiert, um den pädagogischen Kontext zu beleuchten. Die Rolle der Mode als Symbol im Sinne des symbolischen Interaktionismus wird diskutiert, ebenso wie Aspekte der Kinder- und Jugendsoziologie (Markenbewusstsein, Konformität, Gleichaltrigengruppe) und der Kinder- und Jugendpsychologie (Identitätsentwicklung, Attraktivität, prosoziales Verhalten). Der Einfluss dieser Faktoren auf das Unterrichtsklima wird ausführlich untersucht.
3 Beispiele für schulbezogene Veränderung der Modenutzung: Einführung der Schulkleidung: Dieses Kapitel präsentiert und vergleicht zwei Fallstudien zur Einführung von Schulkleidung: ein Projekt in Hamburg und ein Projekt in Berlin. Es werden die methodischen Ansätze und die Ergebnisse dieser Projekte vorgestellt, um die praktischen Auswirkungen von Schulkleidung zu illustrieren. Der Einfluss der Medienrezeption und das politische Meinungsbild werden ebenfalls berücksichtigt.
4 Spezielle Einstellung der Schüler zur Schulkleidung: Dieses Kapitel befasst sich mit der empirischen Erhebung von Schülermeinungen zur Schulkleidung. Es werden die Ergebnisse der Pilotstudie in Berlin und der Untersuchung in Hamburg detailliert dargestellt und interpretiert. Die Analyse umfasst sozioökonomische Daten, den Einfluss von Markenkleidung, die Wirkungserwartungen und die Bedeutung von Kleidung für die Schüler. Die Ergebnisse der Landauer Skala zum Sozialklima werden ebenfalls ausgewertet und diskutiert.
Schlüsselwörter
Schulkleidung, Markenzwang, Klassenklima, Unterrichtsklima, Jugendalter, Identität, Soziale Akzeptanz, Konformität, Gleichaltrigengruppe, Symbolischer Interaktionismus, Empirische Forschung, Pilotstudie, Hamburg, Berlin.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Auswirkungen von Schulkleidung auf Klassenklima und Markenzwang
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von Schulkleidung auf das Klassenklima und den Markenzwang bei Schülern im Alter von 10 bis 16 Jahren. Die zentralen Fragen sind, ob Schulkleidung den Markenzwang abbaut und den Zusammenhalt in der Klasse sowie das Klassen- und Unterrichtsklima verbessert.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert verschiedene soziologische und psychologische Aspekte der Modenutzung im Jugendalter. Konkret untersucht sie den Einfluss von Schulkleidung auf soziale Identität, Selbstwertgefühl, Konformität, das Klassenklima und das Unterrichtsverhalten.
Welche theoretischen Modelle werden verwendet?
Die Arbeit nutzt verschiedene Erklärungsmodelle der Modenutzung, darunter der symbolische Interaktionismus, Konzepte der Kinder- und Jugendsoziologie (Markenkonsum, Gleichaltrigengruppe) und der Kinder- und Jugendpsychologie (Identität, Attraktivität, prosoziales Verhalten). Der Einfluss dieser Faktoren auf das Unterrichtsklima wird eingehend untersucht.
Welche empirischen Daten werden verwendet?
Die Arbeit analysiert empirische Daten aus zwei Pilotstudien: eine in Hamburg und eine in Berlin. Die Ergebnisse dieser Studien werden detailliert dargestellt und interpretiert, inklusive sozioökonomischer Daten, des Einflusses von Markenkleidung, der Wirkungserwartungen und der Bedeutung von Kleidung für die Schüler. Die Ergebnisse der Landauer Skala zum Sozialklima werden ebenfalls ausgewertet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Erklärungsmodelle der Modenutzung, Beispiele für schulbezogene Veränderungen der Modenutzung (Einführung der Schulkleidung in Hamburg und Berlin), Spezielle Einstellung der Schüler zur Schulkleidung (mit Auswertung der Pilotstudien), und Zusammenfassung.
Welche konkreten Beispiele werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit präsentiert und vergleicht zwei Fallstudien zur Einführung von Schulkleidung: ein Projekt in Hamburg und ein Projekt in Berlin. Die methodischen Ansätze und Ergebnisse dieser Projekte werden vorgestellt, um die praktischen Auswirkungen von Schulkleidung zu illustrieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schulkleidung, Markenzwang, Klassenklima, Unterrichtsklima, Jugendalter, Identität, Soziale Akzeptanz, Konformität, Gleichaltrigengruppe, Symbolischer Interaktionismus, Empirische Forschung, Pilotstudie, Hamburg, Berlin.
Welche historischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung und pädagogischen Bezüge von Schulkleidung in Deutschland, um den Kontext der heutigen Diskussion besser zu verstehen.
Welche Rolle spielt der Medienrezeption und das politische Meinungsbild?
Der Einfluss der Medienrezeption und das politische Meinungsbild zur Einführung von Schulkleidung werden im Kapitel über die Fallstudien in Hamburg und Berlin berücksichtigt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Implikationen der Forschungsergebnisse für die Schulpolitik und die pädagogische Praxis.
- Quote paper
- Britt Gaab (Author), 2002, Schulkleidung in Deutschland - Analyse und Wertung von Schülermeinungen zwischen dem 10. und 16. Lebensjahr, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7703