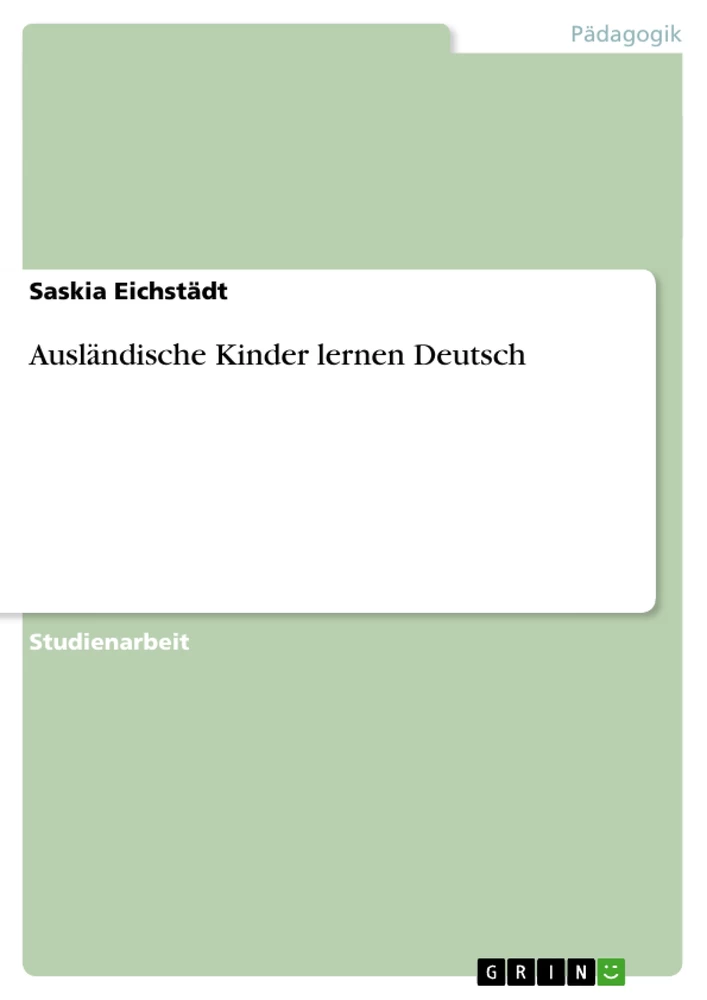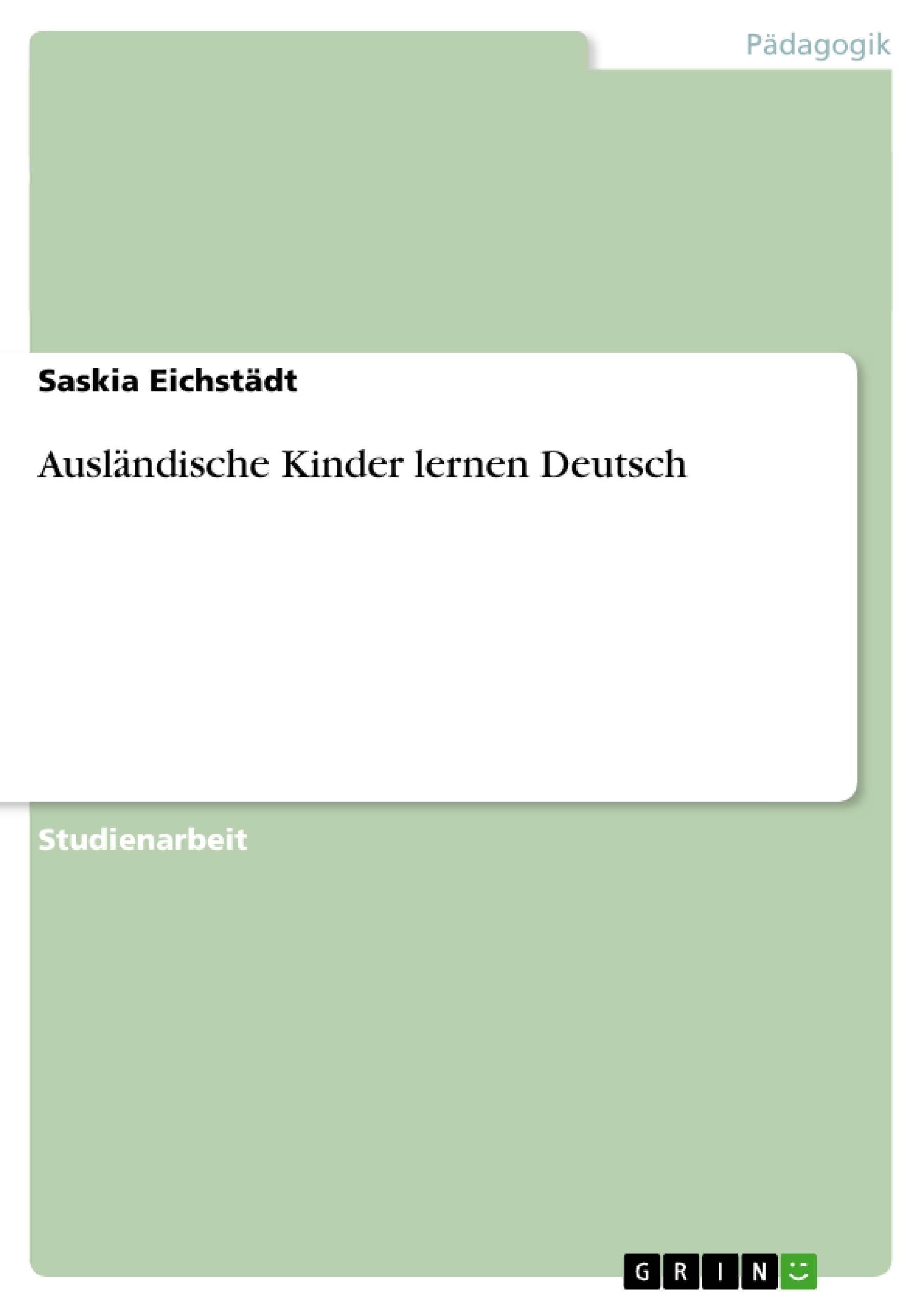In dieser Arbeit soll vor allem ein Überblick über die unterschiedlich vorkommenden Lernstadien gegeben werden und die Probleme und Gefahren, denen Kinder ausgesetzt sind, wenn sie eine fremde Sprache erlernen müssen, werden hinterfragt. Als grundlegende Hinführung zum Thema habe ich zu Beginn einen allgemeinen Überblick über die interkulturelle Erziehung in der Grundschule und die Rolle des Lehrers gewählt.
Des Weiteren werde ich verschiedene Sprachlernstadien darstellen und jeweils die Vor- und Nachteile erläutern. So wird deutlich werden, dass das Erlernen einer Zweit- oder sogar Drittsprache bei einem Kind unter Umständen zu schwerwiegenden Problemen führen kann, wenn diese nicht von Anfang an erkannt werden.
Zum Schluss möchte ich zwei Programme zur Zweitsprachenvermittlung vorstellen und von einigen Erfahrungen berichten, die ich in meinen Schulpraktika mit diesen Programmen gemacht habe.
Abschließend werde ich in der Schlussbemerkung die gewonnenen Ergebnisse dieser Arbeit näher erörtern und meine eigene Meinung kundtun.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Interkulturelle Erziehung in der Grundschule
- 3. Die Sprachentwicklung
- 4. Erst- und Zweitspracherwerb
- 4.1. Erstsprache = Muttersprache?
- 4.2. Der gleichzeitige Erwerb von zwei Sprachen
- 4.3. Der nachzeitige Erwerb einer Zweitsprache
- 4.4. Spracherwerbstypen
- 4.5. Spracherwerbsstadien
- 4.6. Was unterscheidet den Zweitspracherwerb vom Fremdspracherwerb?
- 4.7. Der Unterschied zwischen ungesteuertem Erwerb und gesteuertem Lernen einer Zweitsprache
- 4.8. Die Entstehung von Sprachdomänen
- 4.9. Das Erlernen von Sprachlernstrategien
- 4.9.1. Sprachlernstrategien
- 4.9.2. Kommunikationsstrategien
- 4.9.3. Kompensationsstrategien
- 5. Methoden zur Vermittlung von Fremdsprache
- 6. Vorstellung zweier Sprachförderungsprogramme
- 6.1 „Wir verstehen uns gut“ von Elke Schlösser
- 6.1.1. Programmbedingungen
- 6.1.2. Programmziel
- 6.1.3. Programmaufbau und -themen
- 6.2 „10 kleine Zappelmänner“ von Rotraud Cros
- 6.2.1. Programmbedingungen
- 6.2.2. Programmziel
- 6.2.3. Programmaufbau und -themen
- 6.1 „Wir verstehen uns gut“ von Elke Schlösser
- 7. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Deutsch-Zweitspracherwerb bei ausländischen Kindern. Sie beleuchtet die verschiedenen Lernstadien, die damit verbundenen Herausforderungen und Risiken. Ein Fokus liegt auf der Bedeutung interkultureller Erziehung in der Grundschule.
- Deutsch als Zweitsprache erwerben
- Interkulturelle Erziehung in der Grundschule
- Verschiedene Stadien des Spracherwerbs
- Herausforderungen und Probleme beim Zweitspracherwerb
- Sprachförderungsprogramme
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert das Ziel der Arbeit: die Beleuchtung des Deutschlernprozesses bei ausländischen Kindern in der Grundschule. Es wird ein Überblick über die Lernstadien gegeben und die damit verbundenen Schwierigkeiten thematisiert. Als Einführung wird die interkulturelle Erziehung in der Grundschule und die Rolle der Lehrkraft angesprochen. Die Arbeit soll die möglichen schwerwiegenden Probleme aufzeigen, die beim Erlernen einer Zweit- oder Drittsprache auftreten können, wenn diese nicht frühzeitig erkannt werden. Abschließend werden zwei Programme zur Zweitsprachenvermittlung vorgestellt und eigene Erfahrungen aus Schulpraktika erwähnt.
2. Interkulturelle Erziehung in der Grundschule: Dieses Kapitel betont die Bedeutung interkultureller Erziehung, die nicht nur die Integration ausländischer Kinder, sondern auch die Förderung der sozialen und kulturellen Eigenständigkeit aller Schüler zum Ziel hat. Es wird der Grundsatz der Gleichwertigkeit verschiedener Kulturen innerhalb eines Landes hervorgehoben und die Rolle der Grundschule als Ort interkultureller Begegnung betont. Der Fokus liegt auf der Schaffung von Chancengleichheit und dem respektvollen Umgang miteinander.
3. Die Sprachentwicklung: Kapitel 3 verwendet das Metapher des wachsenden Baumes, um die kindliche Sprachentwicklung zu veranschaulichen. Die "Wurzeln" symbolisieren die physiologischen und sozio-emotionalen Voraussetzungen, der "Stamm" die sensorische Integration, die "Äste" verschiedene Sprachebenen, und die "Krone" das ausgebildete Sprachvermögen. Der "Gärtner" repräsentiert den Pädagogen, dessen Rolle und Einfluss auf den Entwicklungsprozess betont werden. Das Kapitel veranschaulicht die Komplexität der Sprachentwicklung und die Bedeutung der pädagogischen Unterstützung.
4. Erst- und Zweitspracherwerb: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Erst- und Zweitspracherwerb, unterscheidet zwischen gleichzeitigem und nachzeitigem Erwerb, und beleuchtet verschiedene Spracherwerbstypen und -stadien. Es werden die Unterschiede zwischen Zweit- und Fremdspracherwerb sowie zwischen ungesteuertem Erwerb und gesteuertem Lernen detailliert erläutert. Die Entstehung von Sprachdomänen und das Erlernen von Sprachlernstrategien (Kommunikations- und Kompensationsstrategien) bilden weitere Schwerpunkte.
Schlüsselwörter
Deutsch als Zweitsprache, Interkulturelle Erziehung, Grundschule, Spracherwerb, Sprachentwicklung, Sprachförderung, Zweitsprachenvermittlung, Sprachlernstrategien, Integration, Chancengleichheit.
Häufig gestellte Fragen zu: Deutsch-Zweitspracherwerb bei ausländischen Kindern in der Grundschule
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Deutsch-Zweitspracherwerb bei ausländischen Kindern in der Grundschule. Sie beleuchtet die verschiedenen Lernstadien, die damit verbundenen Herausforderungen und Risiken, die Bedeutung interkultureller Erziehung und stellt zwei Sprachförderungsprogramme vor.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie Deutsch als Zweitsprache, interkulturelle Erziehung in der Grundschule, verschiedene Stadien des Spracherwerbs (Erst- und Zweitspracherwerb, gleichzeitiger und nachzeitiger Erwerb), Herausforderungen und Probleme beim Zweitspracherwerb, Sprachlernstrategien (Kommunikations- und Kompensationsstrategien), Sprachförderungsprogramme und die Schaffung von Chancengleichheit.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Interkulturelle Erziehung in der Grundschule, Sprachentwicklung, Erst- und Zweitspracherwerb (mit detaillierten Unterkapiteln zu Spracherwerbstypen, -stadien, Sprachdomänen und Lernstrategien), Methoden zur Vermittlung von Fremdsprachen, Vorstellung zweier Sprachförderungsprogramme ("Wir verstehen uns gut" und "10 kleine Zappelmänner"), und Schlussbemerkung. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Welche Sprachförderungsprogramme werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt zwei Sprachförderungsprogramme vor: "Wir verstehen uns gut" von Elke Schlösser und "10 kleine Zappelmänner" von Rotraud Cros. Für jedes Programm werden Programmbedingungen, Programmziele und der Programmaufbau/die -themen detailliert beschrieben.
Welche Herausforderungen werden beim Zweitspracherwerb beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Risiken, die mit dem Deutsch-Zweitspracherwerb bei ausländischen Kindern verbunden sind. Dies beinhaltet die verschiedenen Stadien des Spracherwerbs, die Entwicklung von Sprachdomänen und die Notwendigkeit von geeigneten Sprachlernstrategien. Die Bedeutung frühzeitiger Erkennung von Problemen wird betont.
Welche Rolle spielt die interkulturelle Erziehung?
Die Arbeit betont die Bedeutung interkultureller Erziehung in der Grundschule für die Integration ausländischer Kinder und die Förderung der sozialen und kulturellen Eigenständigkeit aller Schüler. Der respektvolle Umgang miteinander und die Schaffung von Chancengleichheit stehen im Mittelpunkt.
Wie wird die Sprachentwicklung beschrieben?
Die Sprachentwicklung wird mithilfe des Metapher eines wachsenden Baumes veranschaulicht. Die "Wurzeln" symbolisieren die physiologischen und sozio-emotionalen Voraussetzungen, der "Stamm" die sensorische Integration, die "Äste" verschiedene Sprachebenen und die "Krone" das ausgebildete Sprachvermögen. Der "Gärtner" repräsentiert den Pädagogen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Deutsch als Zweitsprache, Interkulturelle Erziehung, Grundschule, Spracherwerb, Sprachentwicklung, Sprachförderung, Zweitsprachenvermittlung, Sprachlernstrategien, Integration, Chancengleichheit.
- Quote paper
- Saskia Eichstädt (Author), 2006, Ausländische Kinder lernen Deutsch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76898