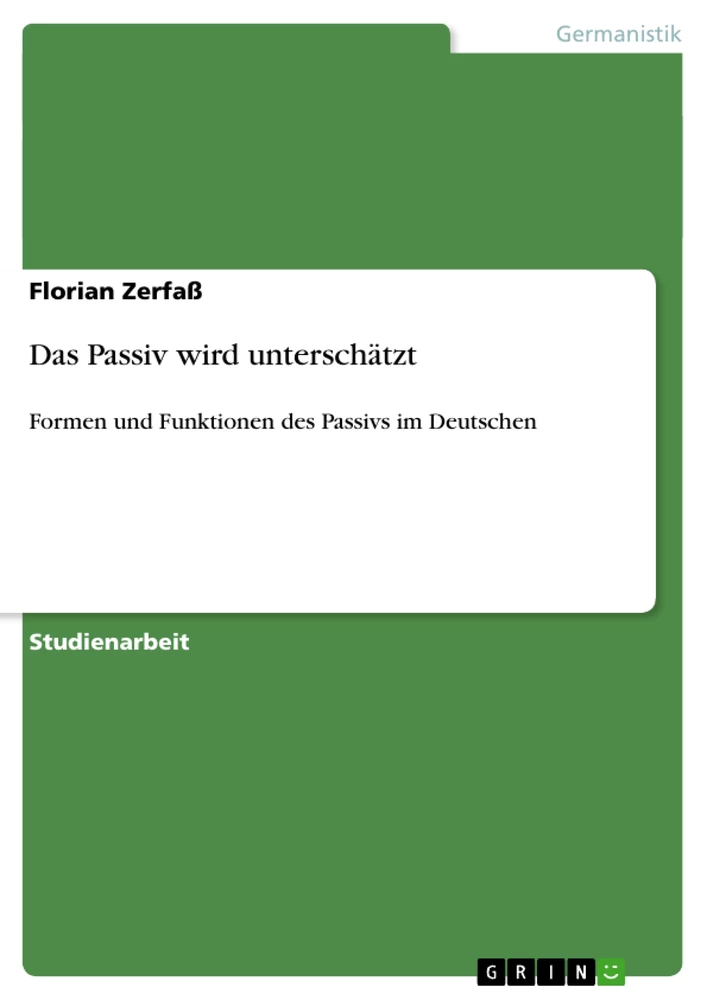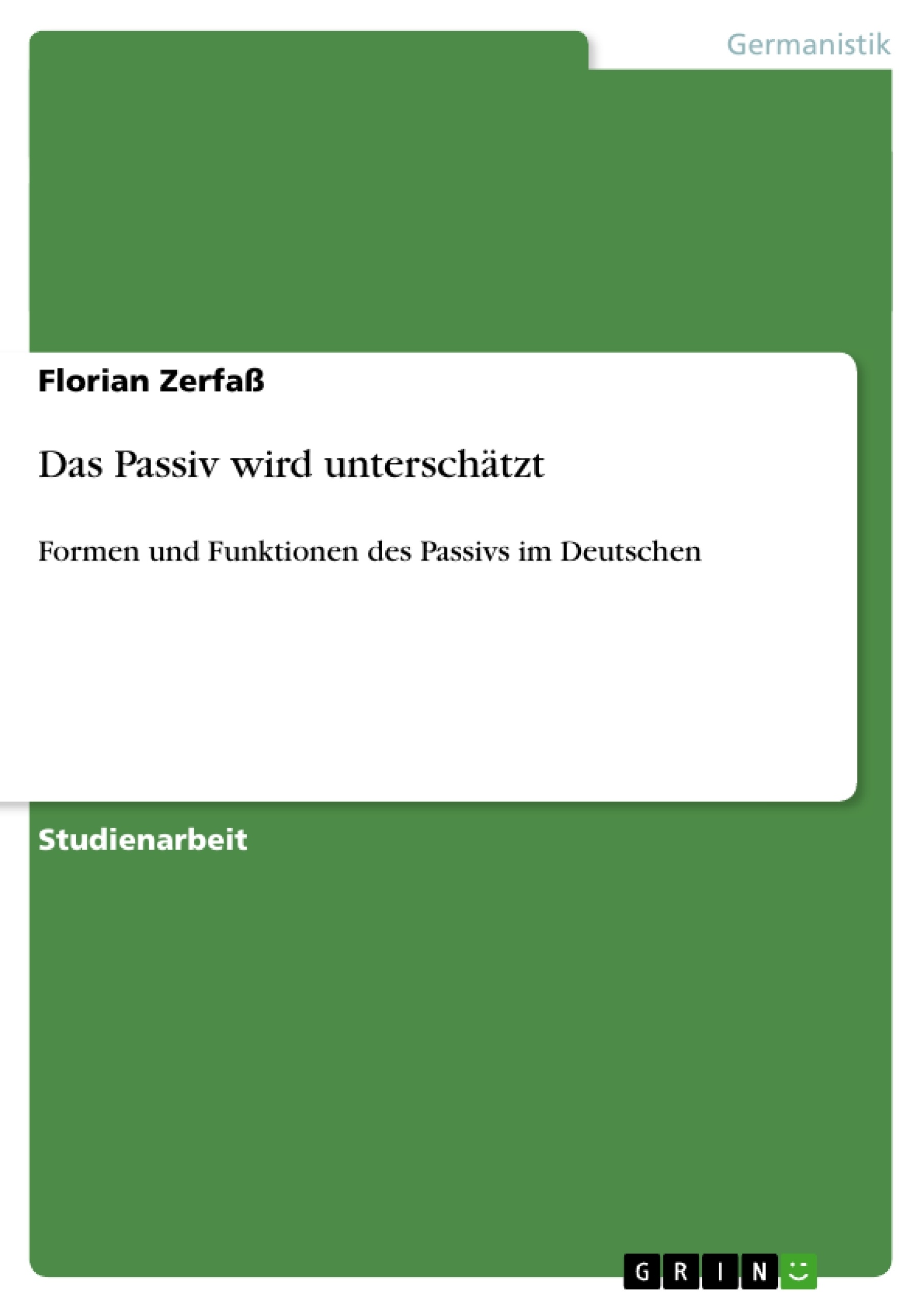Unter deutschen Sprachstilisten hat das Passiv einen schweren Stand - sie raten von der Verwendung dieser Verbform ab.
Wolf Schneider etwa geißelt das Passiv als eine "späte, künstliche, gleichsam entmenschlichte Form des Verbs".
In dieser Arbeit werden die Formen und Funktionen des Passivs im Deutschen beschrieben und anhand der Analyse von Beispielsätzen demonstriert. Dies führt zur Unterstützung der Gegenthese, wonach das Passiv keineswegs zu verdammen ist, sondern die kommunikativen Möglichkeiten sinnvoll durch das Passiv sinnvoll ergänzt und erweitert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formen des Passivs
- Syntaktische Funktionen und thematische Rollen
- Funktionen des Passivs
- Analyse von Beispielsätzen
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktionen und Formen des Passivs im Deutschen und widerlegt die gängige Ansicht, dass es eine zu vermeidende Stilfigur darstellt. Ziel ist es, die Nützlichkeit des Passivs in bestimmten Kontexten aufzuzeigen.
- Formen des deutschen Passivs (Vorgangs-, Zustands-, Rezipientenpassiv)
- Syntaktische Funktionen und thematische Rollen im Passiv
- Semantische Funktionen des Passivs
- Vorteile des Passivs gegenüber dem Aktiv
- Widerlegung der gängigen Kritik am Passivgebrauch
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die kontroverse Debatte um den Gebrauch des Passivs in der deutschen Sprache dar. Sie präsentiert die gegensätzlichen Positionen von Sprachstilisten, die das Aktiv bevorzugen, und die Argumentation von Wolf Schneider, der das Passiv als „späte, künstliche, gleichsam entmenschlichte Form des Verbs“ bezeichnet. Die Arbeit kündigt an, die verschiedenen Passivformen und ihre Funktionen zu untersuchen und die Vorteile des Passivs gegenüber dem Aktiv aufzuzeigen, womit sie Schneiders pauschale Verurteilung des Passivs widerlegen möchte.
Formen des Passivs: Dieses Kapitel beschreibt die drei Hauptformen des deutschen Passivs: Vorgangspassiv (werden-Passiv), Zustandspassiv (sein-Passiv) und Rezipientenpassiv (bekommen/erhalten/kriegen-Passiv). Es erläutert die Bildung dieser Passivformen anhand von Hilfsverben und Partizip II, wobei die Argumentstruktur des Verbs im Passiv unverändert bleibt. Anhand von Beispielsätzen werden die jeweiligen Unterschiede im Satzbau und in der Bedeutung verdeutlicht. Es wird hervorgehoben, dass das Akkusativobjekt des Aktivsatzes zum Subjekt des Passivsatzes wird (Vorgangs- und Zustandspassiv), während beim Rezipientenpassiv das Dativobjekt zum Subjekt wird. Die unterschiedliche stilistische Wertigkeit der Rezipientenpassiv-Formen wird ebenfalls angesprochen.
Schlüsselwörter
Passiv, Aktiv, Vorgangspassiv, Zustandspassiv, Rezipientenpassiv, syntaktische Funktionen, thematische Rollen, Genus verbi, Diathese, Stilistik, deutsche Grammatik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Analyse des Passivs im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text analysiert die Funktionen und Formen des Passivs im Deutschen und widerlegt die gängige negative Sichtweise auf dessen Verwendung. Er untersucht verschiedene Passivformen, deren syntaktische und semantische Funktionen sowie die Vorteile gegenüber dem Aktiv.
Welche Passivformen werden behandelt?
Der Text beschreibt die drei Hauptformen des deutschen Passivs: das Vorgangspassiv (werden-Passiv), das Zustandspassiv (sein-Passiv) und das Rezipientenpassiv (bekommen/erhalten/kriegen-Passiv). Die Bildung und die Unterschiede im Satzbau und in der Bedeutung werden detailliert erläutert.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, die Nützlichkeit des Passivs in bestimmten Kontexten aufzuzeigen und die gängige Ansicht, dass es eine zu vermeidende Stilfigur darstellt, zu widerlegen. Er möchte die Vorteile des Passivs gegenüber dem Aktiv belegen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Formen des deutschen Passivs, deren syntaktische Funktionen und thematische Rollen, die semantischen Funktionen des Passivs, die Vorteile des Passivs gegenüber dem Aktiv und die Widerlegung der Kritik am Passivgebrauch.
Wie wird die Kritik am Passiv behandelt?
Der Text greift die Kritik am Passiv auf, insbesondere die Argumentation von Wolf Schneider, der das Passiv als „späte, künstliche, gleichsam entmenschlichte Form des Verbs“ bezeichnet. Er widerlegt diese pauschale Verurteilung, indem er die Funktionen und Vorteile des Passivs herausarbeitet.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst eine Einleitung, ein Kapitel über die Formen des Passivs (inkl. syntaktischer Funktionen und thematischer Rollen sowie Funktionen des Passivs), ein Kapitel mit der Analyse von Beispielsätzen und abschließende Schlussbemerkungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind Passiv, Aktiv, Vorgangspassiv, Zustandspassiv, Rezipientenpassiv, syntaktische Funktionen, thematische Rollen, Genus verbi, Diathese, Stilistik und deutsche Grammatik.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, der Text enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die Kernaussagen und den Inhalt jedes Kapitels kurz und prägnant beschreibt.
- Quote paper
- Florian Zerfaß (Author), 2006, Das Passiv wird unterschätzt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76881