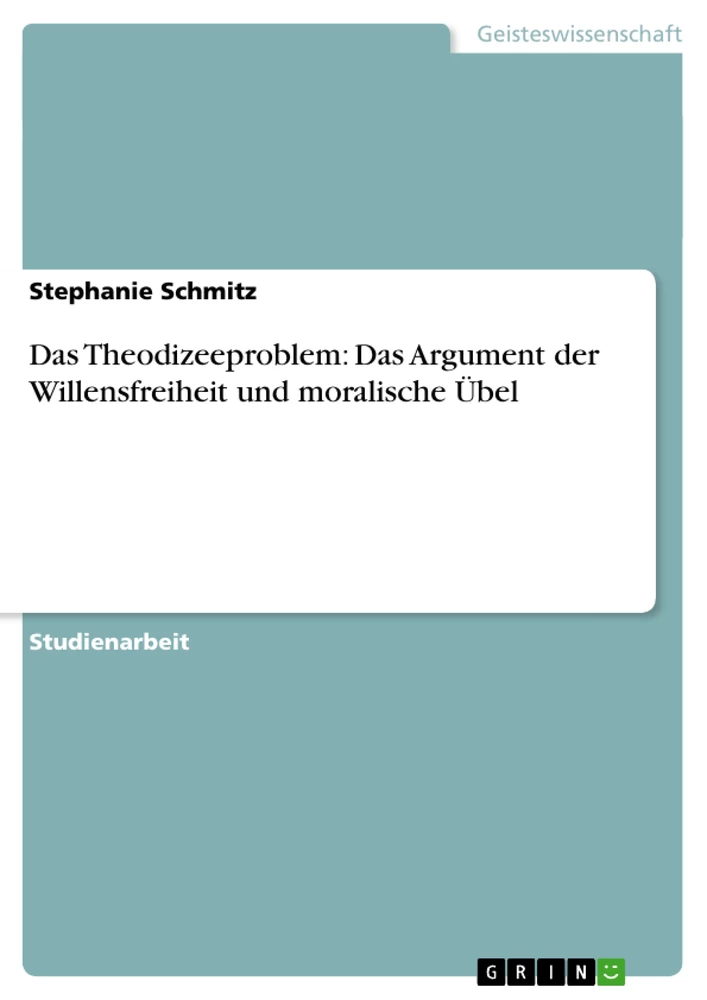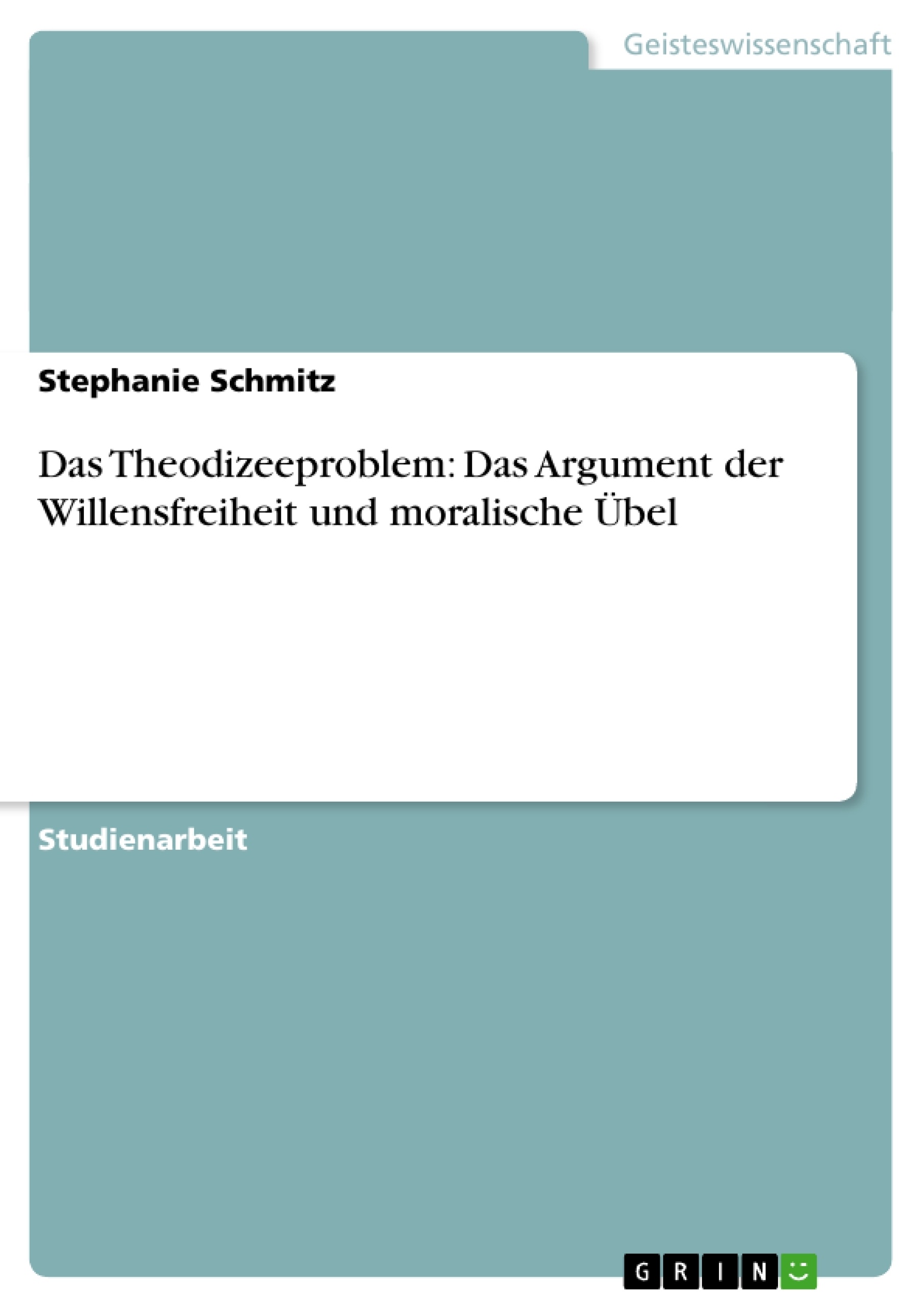Der Begriff Theodizee wurde von Leibniz geprägt und stellt das Widerspruchsproblem zwischen der christlichen Annahme von der Existenz eines allmächtigen und gütigen Gottes und dem offenkundigen Vorhandensein von Leid und Übel in der von ihm geschaffenen Welt dar. Das Theodizee-Problem bezeichnet den Versuch einer Rechtfertigung Gottes bzw. des Glaubens an Gott angesichts des physischen Übels, des moralischen Bösen und des Leidens der von Gott geschaffenen Lebewesen in der Welt. Das Theodizee-Problem lässt sich bis ins Alte Testament zurückverfolgen, wo es insbesondere im Buch Hiob behandelt wird. Dass Gott allmächtig und gütig ist, stellt eine Grundvoraussetzung des christlichen Glaubens dar und dass unsere Welt zu jeder Zeit voller Leid war und ist, steht außer Frage, das wohl erschreckenste Beispiel für unfassbares Übel und Leid stellt der Massenmord an den Juden im Dritten Reich dar. Durch diesen Gegensatz drängen sich Fragen auf wie zum Beispiel warum Gott eine solch leidvolle Welt erschaffen hat und ob es ihm möglich gewesen wäre, eine Welt, die weniger Leid beinhaltet, zu erschaffen. Wenn es ihm möglich war, aus welchem Grund hat er es nicht getan und ist es zu rechtfertigen ihn weiterhin als gütig zu bezeichnen? Wenn es ihm nicht möglich war, kann er dann noch als allmächtig bezeichnet werden?
Es bestehen verschiedenste Theorien und Ansätze zur Lösung des Theodizee-Problems. So halten viele beispielsweise die Ästhetisierung des Leidens für eine mögliche Lösung des Theodizee-Problems, indem sie behaupten, dass Gott Schönheit nur schaffen konnte, indem er auch die Übel schuf. Leibniz veranschaulicht diese Sicht mit dem Beispiel, dass Missklang die Harmonie hervortreten lässt und stellt die rhetorische Frage, ob ein Mensch, der noch nie krank war, seine Gesundheit genügend schätzt und Gott genug dafür dankt. Eine solche Ansicht ist jedoch menschenverachtend und es wäre unmoralisch, Elend in Kauf zu nehmen, um eine ästhetisch schöne Welt zu schaffen. Wenn man nur an Geschehnisse wie die Völkermorde in Ruanda oder die Schoa denkt, so darf weder eine Gläubiger noch ein Ungläubiger jemals zu der Antwort kommen, dass das Leiden und Sterben unschuldiger Kinder irgendeinen Sinn hat.
Wie aber ist es möglich, die Existenz von Leid und Übel in der Welt zu erklären und gleichzeitig an einen sittlich guten und allmächtigen Gott zu glauben?
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Thematik
- Einleitung in das Thema Theodizee
- Grundsätzliche Überlegungen zur free will defense
- Diskussion der Prämissen nach Kreiner
- Prämisse [1]: Die Existenz der Willensfreiheit
- Prämisse [2]: Die Werthaftigkeit der Freiheit
- Prämisse [3] und [4]: Die Möglichkeit leidverursachender Freiheit und die Unausweichlichkeit des Freiheitsmissbrauchs
- Prämisse [5]: Der Preis der Freiheit
- Auswertung und Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Theodizee-Problem, insbesondere im Kontext der „free will defense“. Ziel ist es, die Argumentation der „free will defense“ anhand der fünf Prämissen von Kreiner zu analysieren und deren Stichhaltigkeit zu untersuchen. Der Fokus liegt dabei auf der Erklärung der Existenz von moralischem Übel in der Welt, wobei die Verbindung zwischen Gottes Allmacht und Güte sowie der Freiheit des Menschen im Vordergrund steht.
- Die „free will defense“ als zentrale Theorie zur Lösung des Theodizee-Problems
- Die fünf Prämissen von Kreiner, die die Argumentation der „free will defense“ formulieren
- Die Unterscheidung zwischen moralischem Übel (malum morale) und natürlichem Übel (malum physicum) im Kontext der „free will defense“
- Die Frage, ob der positive Wert des freien Willens das Risiko des moralischen Übels aufwiegen kann
- Die Rolle der Freiheit des Menschen in der Schöpfung und die Frage nach Gottes Verantwortung für das Leid in der Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Theodizee-Problem ein und erläutert den Begriff sowie die zentrale Frage, wie die Existenz von Leid und Übel in der Welt mit der Annahme eines allmächtigen und gütigen Gottes vereinbar ist. Darüber hinaus werden grundsätzliche Überlegungen zur „free will defense“ vorgestellt, die das Theodizee-Problem durch die Betonung des freien Willens des Menschen zu lösen versucht.
Im zweiten Kapitel werden die fünf Prämissen von Kreiner, die das Argument der „free will defense“ formulieren, detailliert diskutiert. Besondere Aufmerksamkeit wird den Prämissen 3-5 gewidmet, die die Möglichkeit und Unausweichlichkeit des moralischen Übels im Kontext der menschlichen Freiheit behandeln.
Schlüsselwörter
Theodizee, free will defense, Willensfreiheit, moralische Übel, malum morale, malum physicum, Gottes Allmacht, Gottes Güte, Leid, Freiheit, Verantwortung, Prämissen, Kreiner, Leibniz.
- Quote paper
- Stephanie Schmitz (Author), 2004, Das Theodizeeproblem: Das Argument der Willensfreiheit und moralische Übel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76768