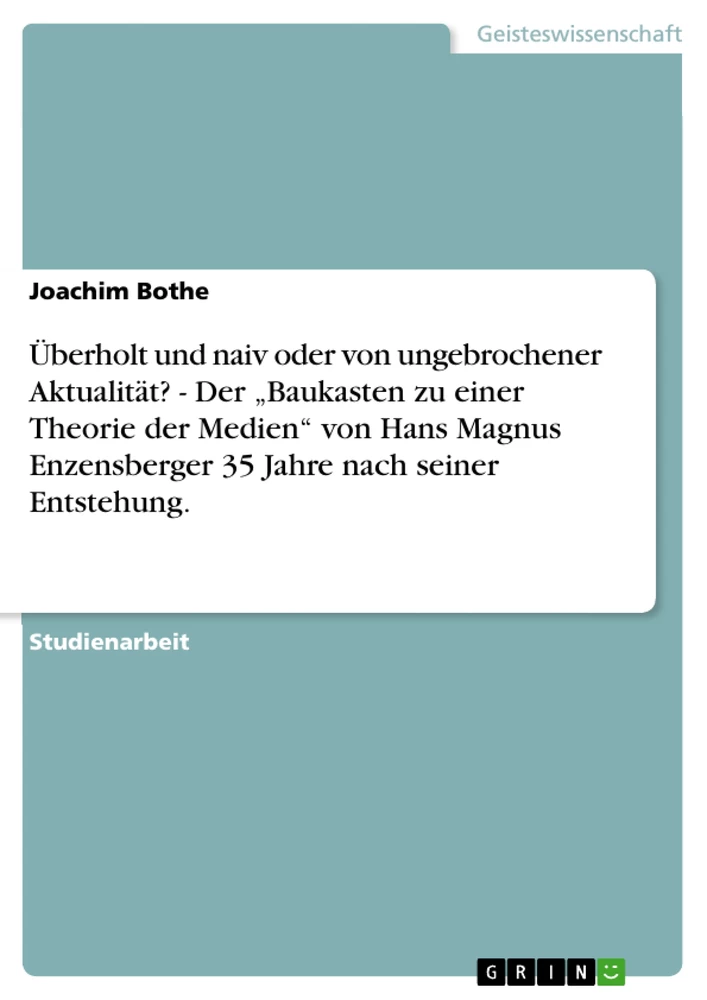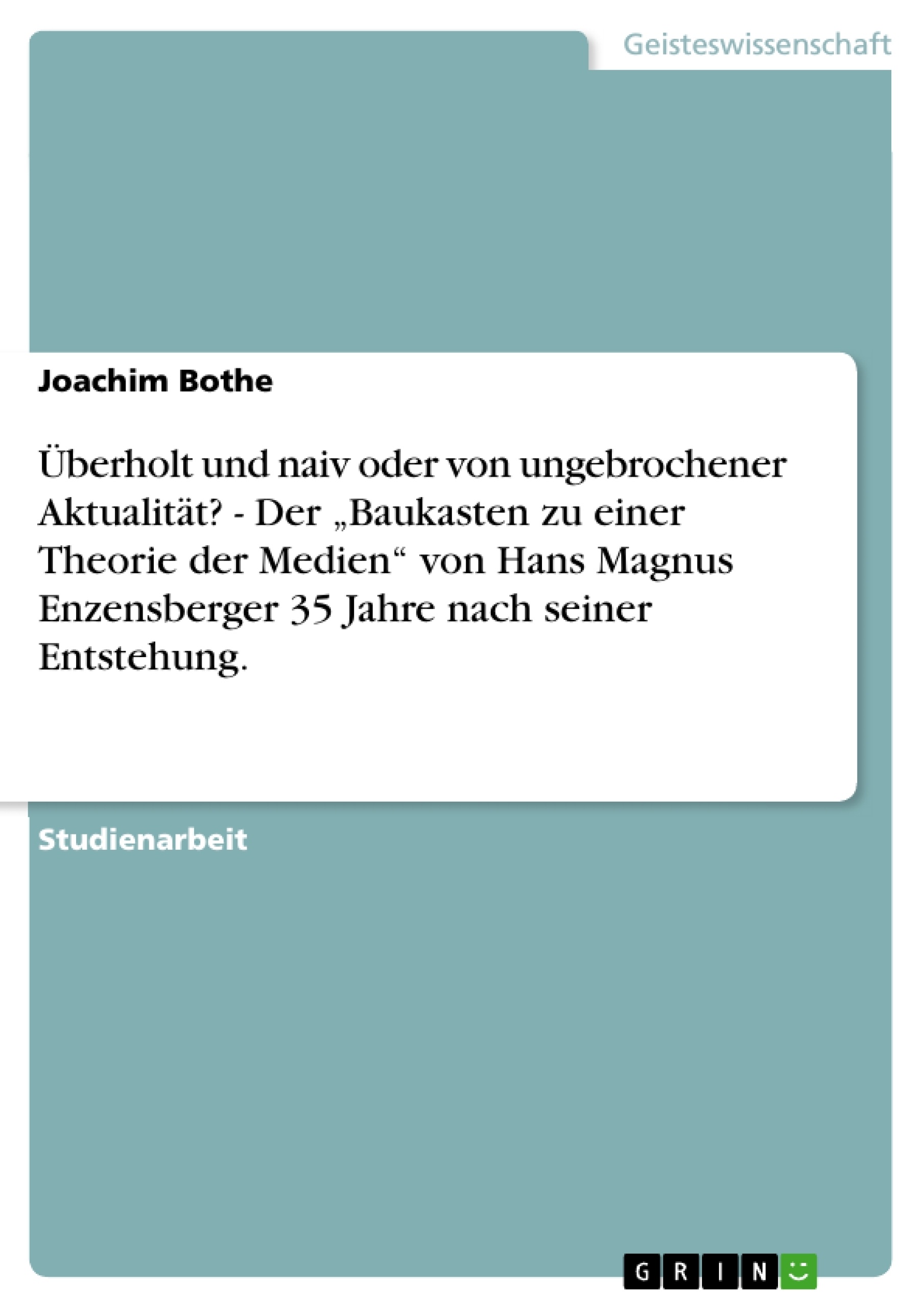Es mag durchaus ungewöhnlich erscheinen, sich den immer aktuellen Zusammenhängen zwischen neuen Medien, technischer Zivilisation und kulturellem Wandel mittels eines Textes zu nähern, der aus dem Jahr 1970 stammt. Aus mehreren Gründen ist der „Baukasten zu einer Theorie der Medien“ von Hans Magnus Enzensberger jedoch gerade geeignet, um sich dieser Trias zu widmen. Zum Ersten denkt Enzensberger sehr konsequent alle drei Bereiche zusammen und formuliert eine starke Position, die Aspekte der Entwicklungsgeschichte der Medien exemplarisch verdeutlicht und zur Diskussion herausfordert; er thematisiert grundlegende Fragen der Kommunikationssoziologie bzw. der Medienwissenschaft. Zum Zweiten lassen sich ausgehend von diesem Text drei Klassiker aus dem Bereich der Kritischen Theorie (Bertolt Brecht, Walter Benjamin und Theodor W. Adorno) diskutieren, auf die Enzensberger Bezug nimmt und die sich ebenfalls und auf sehr unterschiedliche Art und Weise den Zusammenhängen von neuen Medien, technischer Zivilisation und kulturellem Wandel gewidmet haben – wenn auch der Schwerpunkt dieser Arbeit darauf liegt, die Theorie des Baukastens zu rekonstruieren. Zum Dritten ist jedes Medium bei seiner Einführung ein „neues“, und insofern sind – wie die Darstellung zeigen wird – manche Prozesse und Mechanismen gleich, egal, ob es um den Buchdruck mit beweglichen Lettern, das Fernsehen oder das Internet geht. Deshalb lassen sich Enzensbergers Argumente und Anliegen auch auf später aufkommende Medien beziehen.
Zunächst wird die Argumentation im Baukasten zu einer Theorie der Medien systematisiert dargestellt und diskutiert. Anschließend werden die Bezüge zu Brecht, Benjamin und Adorno nachvollzogen und kritisch betrachtet. Im abschließenden Kapitel wird dann – vor allem anhand späterer Äußerungen Enzensbergers – die Frage behandelt, was aus den damaligen Hoffnungen Enzensbergers geworden ist, welche Prognosen sich erfüllt und welche sich als falsch herausgestellt haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Baukasten zu einer Theorie der Medien“: Mobilisierende Kraft statt Bewußtseins-Industrie
- Kommunikation statt Distribution (Bertolt Brecht)
- Technische Reproduzierbarkeit statt Aura (Walter Benjamin)
- Industrie statt Kultur (Theodor W. Adorno)
- Eine gewisse Nüchternheit Fazit und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Relevanz von Hans Magnus Enzensbergers „Baukasten zu einer Theorie der Medien“ im Kontext neuer Medien, technischer Zivilisation und kulturellem Wandel. Der Text aus dem Jahr 1970 bietet eine fundierte Analyse der Wechselwirkungen zwischen Medien, Technologie und Gesellschaft und stellt wichtige Fragen zur Nutzung neuer Medien und deren Einfluss auf den kulturellen Wandel.
- Beziehung zwischen neuen Medien und kulturellem Wandel
- Kausalitäten zwischen neuen Medien und kulturellem Wandel
- Einfluss der Medien auf die Kultur
- Bewertung des kulturellen Wandels
- Nutzung neuer Medien
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel präsentiert die Argumentation von Enzensbergers „Baukasten“ und analysiert seine Kernaussagen.
- Das zweite Kapitel beleuchtet Bertolt Brechts Position zur Medienentwicklung und setzt sie in Relation zu Enzensbergers Theorie.
- Das dritte Kapitel untersucht Walter Benjamins Theorie der technischen Reproduzierbarkeit und seine Kritik an der Aura von Kunstwerken im Kontext der Medienentwicklung.
- Das vierte Kapitel widmet sich Theodor W. Adornos Theorie der Kulturindustrie und betrachtet seine Kritik an den Massenmedien im Vergleich zu Enzensbergers Ansatz.
Schlüsselwörter
Neue Medien, technische Zivilisation, kultureller Wandel, „Baukasten zu einer Theorie der Medien“, Hans Magnus Enzensberger, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Kommunikationssoziologie, Medienwissenschaft, Kritische Theorie, Mobilisierende Kraft, Technische Reproduzierbarkeit, Kulturindustrie.
- Citar trabajo
- Joachim Bothe (Autor), 2006, Überholt und naiv oder von ungebrochener Aktualität? - Der „Baukasten zu einer Theorie der Medien“ von Hans Magnus Enzensberger 35 Jahre nach seiner Entstehung., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76735