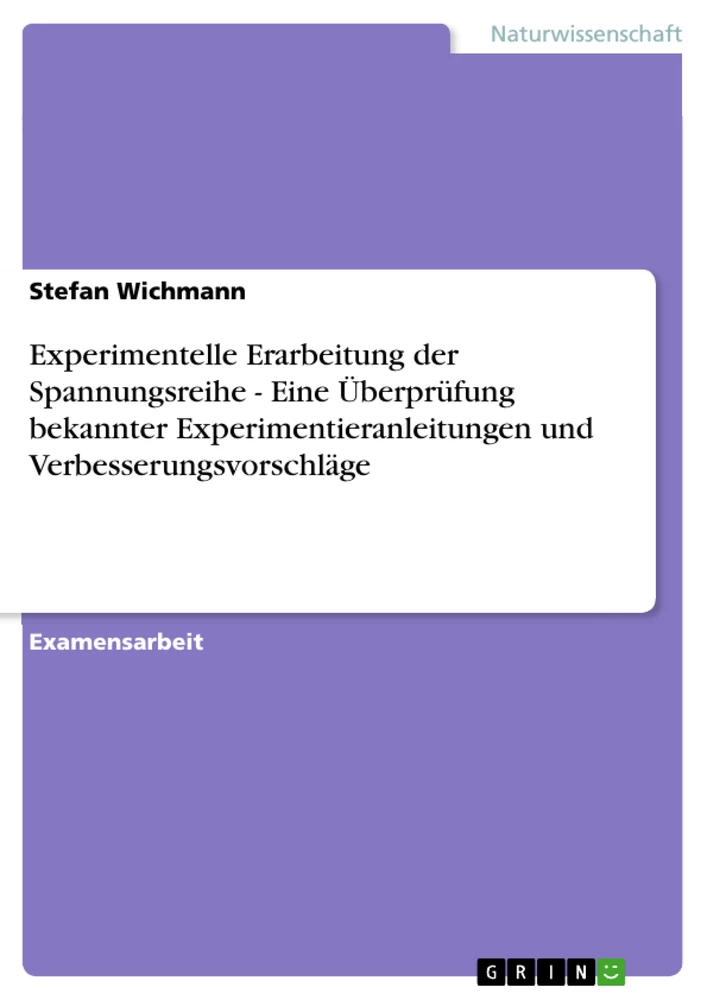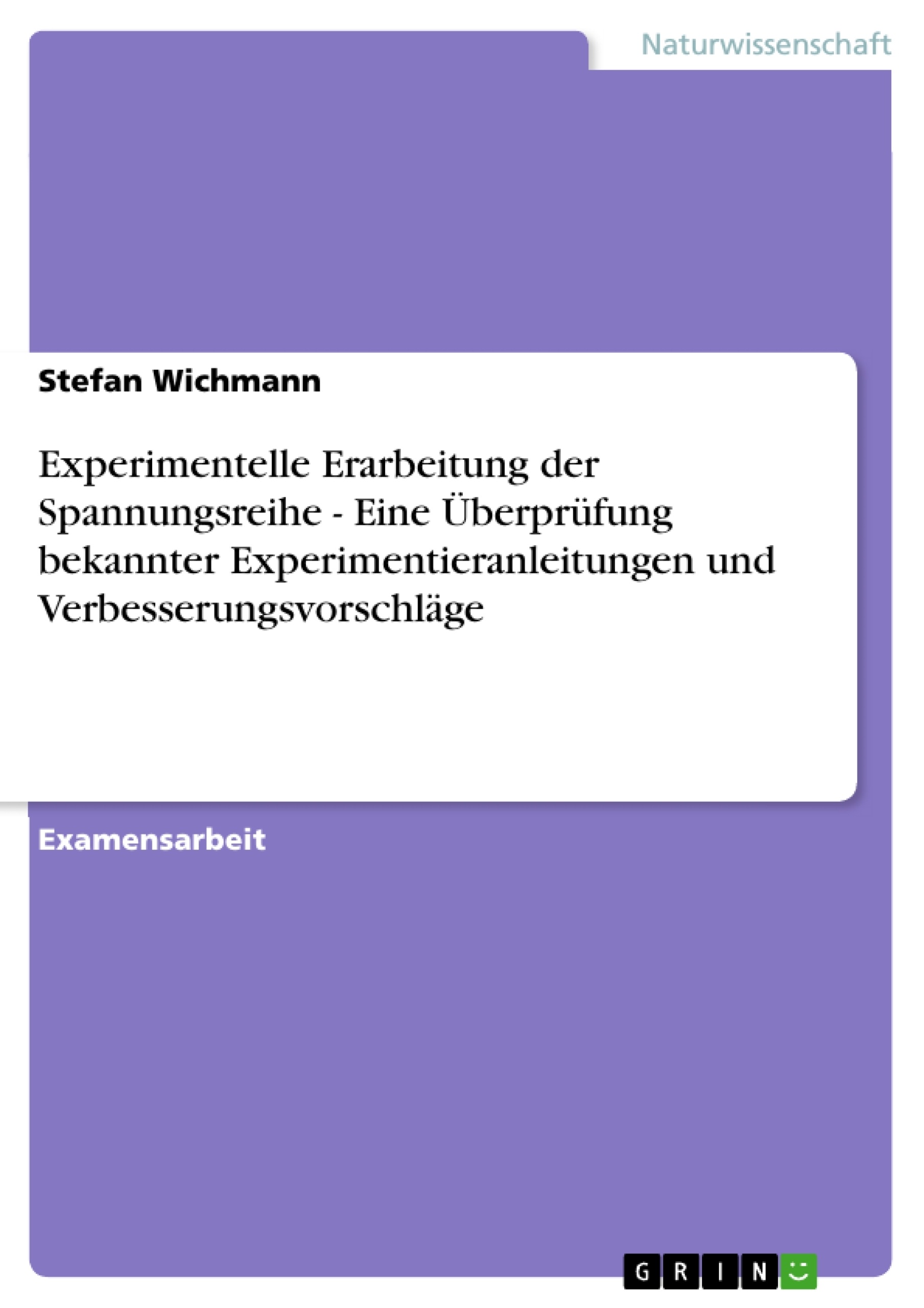Die ersten bedeutenden Experimente mit elektrischen Strömen führten die italienischen Physiker Luigi Galvani und Alessandro Volta durch. Galvani erzeugte Muskelkontraktionen in Froschbeinen indem er elektrischen Strom durch sie fließen ließ. Volta stellte 1800 die erste künstliche elektrochemische Spannungsquelle in Form der VOLTAschen Säule vor. Der Grundstein für eine neue, in ihrer Entwicklung damals nicht absehbare, technische Richtung war somit gelegt. Anfangs strebte man durch Experimentieren und Ausprobieren nach technischen Verbesserungen, während nach und nach das Interesse zur Erforschung der theoretischen, elektrochemischen Vorgänge wuchs. Der Titel der vorliegenden Examensarbeit: "Experimentelle Erarbeitung der Spannungsreihe - Eine Überprüfung bekannter Experimentieranleitungen und Verbesserungsvorschläge" zielt im Besonderen auf die Verwendung in der Schule. Dabei soll den Lehrkräften ein Werk gegeben werden, welches in der Schulpraxis verwendet werden kann. Die großen und vielen Abbildungen dienen dabei als Kopiervorlagen für das visuelle Verständnis der Lehrer, zusätzlich können die Abbildungen in Arbeitsblättern mit integriert werden. Kurz werden hier die wesentlichen Kapitel aufgelistet: Kapitel 1 – Fachlicher Hintergrund, Kapitel 1-4 Visualisierung des Diffusionspotenzials, Kapitel 2 – Die Spannungsreihe im Unterricht,
Kapitel 3 – Spezielle Galvanische Elemente, Kapitel 4 – Aktuelle Experimentieranleitungen und Verbesserungsvorschläge. Bei der Untersuchung der aktuellen Experimentieranleitungen werden folgende Aspekte besonders berücksichtigt: • Reproduzierbarkeit der Versuche und Messwerte, • einfache Handhabung der Geräte, • Anzahl der erhaltenen Meßwerte, • Anschaffungskosten, • Versuchsbeschreibung. Verbesserungsvorschläge sind in den Versuchsanleitungen mit aufgeführt und teilweise schon verwendet worden. Kapitel 5 – Eigene Experimentieranleitungen, Kapitel 6 – Zusammenfassung, Kapitel 7 – Literaturangaben, Internetadressen, Bildnachweis
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Fachlicher Hintergrund
- 1-1 Elektrochemie
- 1-2 Galvanische Zellen
- 1-3 Visualisierung des Elektronenflusses
- 1-4 Visualisierung des Diffusionspotenzials
- 1-5 Redoxpotenziale
- 1-6 Die Spannungsreihe
- 1-7 Konzentrationsabhängigkeit des Redoxpotenzials
- 1-8 Berechnung von Redoxpotenzialen
- 1-9 Ermittlung der Potenziale von Konzentrationszellen mit Hilfe der NERNSTschen Gleichung
- 1-10 Diaphragmen und Ausführungsformen Galvanischer Elemente
- 1-11 Elektroden 2.Art
- 1-12 Elektrolyse
- 2 Die Spannungsreihe im Unterricht
- 2-1 Schulbuchvergleich
- 2-2 Edutainment - Lernsoftware
- 3 Spezielle Galvanische Elemente
- 3-1 Zitronenbatterie und Vergleichbare
- 3-2 VOLTAsche Säule
- 3-3 Bleiakkumulatoren
- 3-4 Gängige Batterietechnologien
- 4 Aktuelle Experimentieranleitungen und Verbesserungsvorschläge
- 4-1 Versuchsabbildungen in Schulbüchern
- 4-2 Experimentierkasten von LEYBOLD-HERAEUS
- 4-3 Petrischalenhalbzellen nach Ruf und Ful
- 4-4 Küvettenhalbzellen nach Kometz
- 4-5 Vertikalhalbzellen nach Menzel
- 5 Eigene Experimentieranleitungen
- 5-1 Filmdöschenhalbzellen
- 6 Zusammenfassung
- 7 Literaturangaben, Internetadressen, Bildnachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt auf die Verbesserung des Unterrichts zur Spannungsreihe in der Schule ab. Sie überprüft bestehende Experimentieranleitungen und bietet Verbesserungsvorschläge, um das Verständnis der Schüler zu fördern. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung und der Bereitstellung von anschaulichem Material für Lehrkräfte.
- Experimentelle Erarbeitung der Spannungsreihe
- Überprüfung bestehender Experimentieranleitungen
- Verbesserungsvorschläge für den Schulunterricht
- Visualisierung elektrochemischer Prozesse
- Einsatz von Alltagsmaterialien in Experimenten
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Einleitung skizziert die historischen Anfänge der Elektrochemie mit Galvani und Volta und führt in die Zielsetzung der Arbeit ein. Sie betont den praktischen Nutzen für den Schulunterricht und die Verwendung der Arbeit als Ressource für Lehrkräfte mit vielen Abbildungen als Kopiervorlagen für Arbeitsblätter. Die Arbeit untersucht kritisch die Fachliteratur auf Lücken und Fehler und widmet sich insbesondere der Visualisierung des Diffusionspotenzials, einem Aspekt, der in der Literatur oft fehlt, aber für das Verständnis der Messergebnisse relevant ist.
1 Fachlicher Hintergrund: Dieses Kapitel liefert das elektrochemische Grundwissen, das für das Verständnis der Spannungsreihe notwendig ist. Es behandelt Themen wie Galvanische Zellen, Elektronenfluss, Diffusionspotenzial, Redoxpotenziale, die Spannungsreihe selbst, die Konzentrationsabhängigkeit von Redoxpotenzialen, die Berechnung von Redoxpotenzialen, die Ermittlung von Potenzialen von Konzentrationszellen mit Hilfe der Nernstschen Gleichung, Diaphragmen und Ausführungsformen galvanischer Elemente, Elektroden 2. Art und Elektrolyse. Der kritische Umgang mit der Fachliteratur hinsichtlich Lücken und Fehlern wird hervorgehoben.
2 Die Spannungsreihe im Unterricht: Dieses Kapitel analysiert kurz zwei Schulbücher und ein Lehrerbegleitbuch, wobei der Fokus nicht auf einer umfassenden Schulbuchanalyse liegt, sondern auf der Überprüfung der fachlichen Korrektheit und der Qualität der Visualisierung des Themas. Der kurze Umfang dieses Kapitels wird begründet mit dem Schwerpunkt der Arbeit auf der Verbesserung von Experimenten und nicht auf der Schulbuchanalyse. Es wird der Bedarf an einem breiteren Lehrangebot zur Spannungsreihe, insbesondere in der Sekundarstufe I, betont.
3 Spezielle Galvanische Elemente: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene galvanische Elemente, wie die Zitronenbatterie und vergleichbare Elemente, die Voltasche Säule, Bleiakkumulatoren und gängige Batterietechnologien. Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Erarbeitung der Spannungsreihe anhand von anschaulichen und motivierenden Beispielen mit Alltagsbezug und der Integration weiterer fächerübergreifender Themen.
Schlüsselwörter
Spannungsreihe, Elektrochemie, Galvanische Zellen, Redoxpotenziale, Experimentieranleitungen, Schulunterricht, Visualisierung, Diffusionspotenzial, Nernstsche Gleichung, Elektrolyse, Batterien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Verbesserung des Unterrichts zur Spannungsreihe in der Schule
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Der Hauptfokus liegt auf der Verbesserung des Unterrichts zur Spannungsreihe in der Schule. Die Arbeit überprüft bestehende Experimentieranleitungen, bietet Verbesserungsvorschläge und konzentriert sich auf die praktische Anwendung und anschauliche Materialien für Lehrkräfte. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Visualisierung elektrochemischer Prozesse, insbesondere des Diffusionspotenzials.
Welche Themen werden im Fachlichen Hintergrund behandelt?
Kapitel 1 bietet ein umfassendes elektrochemisches Grundwissen, das für das Verständnis der Spannungsreihe notwendig ist. Es deckt Themen wie Galvanische Zellen, Elektronenfluss, Diffusionspotenzial, Redoxpotenziale, die Spannungsreihe, Konzentrationsabhängigkeit von Redoxpotenzialen, Berechnung von Redoxpotenzialen, Nernstsche Gleichung, Diaphragmen, Elektroden 2. Art und Elektrolyse ab. Die kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Lücken und Fehlern in der Fachliteratur wird hervorgehoben.
Wie wird die Spannungsreihe im Unterricht behandelt?
Kapitel 2 analysiert kurz Schulbücher und ein Lehrerbegleitbuch hinsichtlich fachlicher Korrektheit und der Qualität der Visualisierung. Der Schwerpunkt liegt jedoch weniger auf einer umfassenden Schulbuchanalyse, sondern auf der Verbesserung von Experimenten. Der Bedarf an einem breiteren Lehrangebot zur Spannungsreihe, insbesondere in der Sekundarstufe I, wird betont.
Welche speziellen galvanischen Elemente werden beschrieben?
Kapitel 3 beschreibt verschiedene galvanische Elemente wie die Zitronenbatterie, die Voltasche Säule, Bleiakkumulatoren und gängige Batterietechnologien. Der Fokus liegt auf der praktischen Erarbeitung der Spannungsreihe anhand anschaulicher und motivierender Beispiele mit Alltagsbezug und der Integration fächerübergreifender Themen.
Welche Experimentieranleitungen werden untersucht und vorgeschlagen?
Kapitel 4 untersucht verschiedene Experimentieranleitungen aus Schulbüchern und Experimentalkästen (z.B. LEYBOLD-HERAEUS) sowie Petrischalenhalbzellen, Küvettenhalbzellen und Vertikalhalbzellen. Kapitel 5 präsentiert eigene Verbesserungsvorschläge, beispielsweise die Verwendung von Filmdöschenhalbzellen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter beschrieben: Spannungsreihe, Elektrochemie, Galvanische Zellen, Redoxpotenziale, Experimentieranleitungen, Schulunterricht, Visualisierung, Diffusionspotenzial, Nernstsche Gleichung, Elektrolyse, Batterien.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt auf die Verbesserung des Unterrichts zur Spannungsreihe ab, indem sie bestehende Experimentieranleitungen überprüft, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und anschauliches Material für Lehrkräfte bereitstellt. Der Fokus liegt auf der experimentellen Erarbeitung der Spannungsreihe, der Visualisierung elektrochemischer Prozesse und dem Einsatz von Alltagsmaterialien in Experimenten.
Welche Kapitelzusammenfassung wird gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels, beginnend mit einer Einleitung zur historischen Entwicklung der Elektrochemie und der Zielsetzung der Arbeit. Die Kapitel beschreiben den fachlichen Hintergrund, die Analyse der Spannungsreihe im Unterricht, spezielle galvanische Elemente und eigene Experimentieranleitungen mit Verbesserungsvorschlägen. Der kritische Umgang mit der Fachliteratur und die Bedeutung der Visualisierung, insbesondere des Diffusionspotenzials, werden hervorgehoben.
- Quote paper
- Stefan Wichmann (Author), 2000, Experimentelle Erarbeitung der Spannungsreihe - Eine Überprüfung bekannter Experimentieranleitungen und Verbesserungsvorschläge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/765